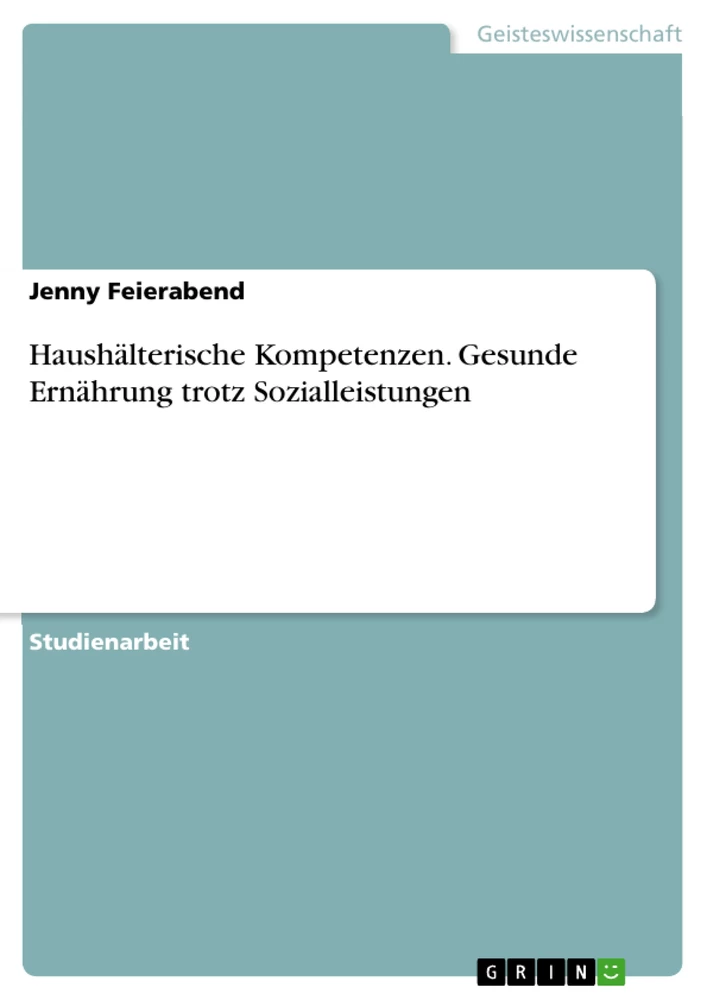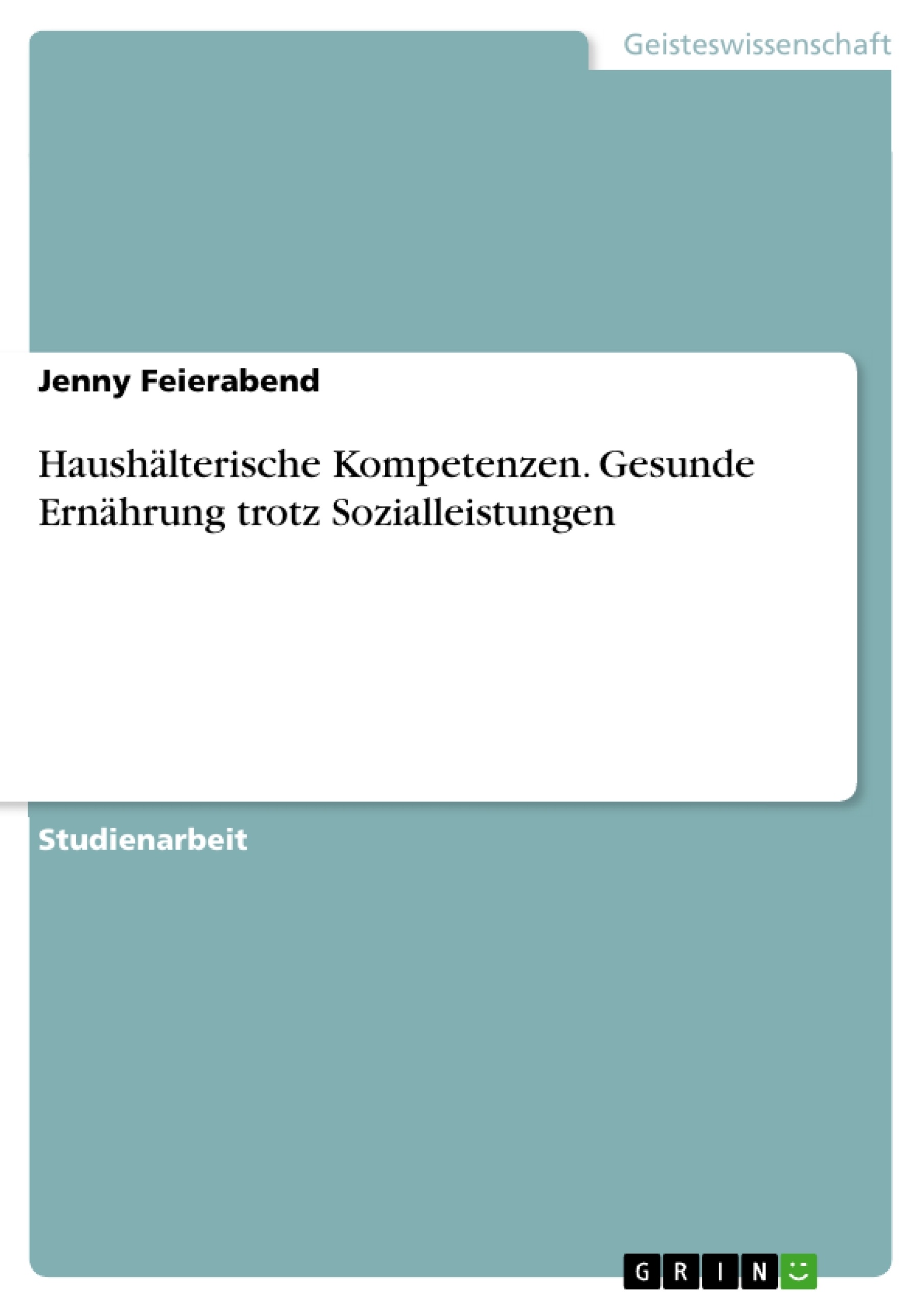Eine ungesunde Ernährung in den unteren sozialen Schichten wird oftmals auf das eine Problem der fehlenden finanziellen Mittel reduziert. Gesunde, abwechslungsreiche Nahrung mit viel Obst und Gemüse sowie ausreichend Ballaststoffen, gesättigten Fettsäuren etc. sei mit Sozialleistungen nicht realisierbar. Die Leistungen werden jedoch kaum und wenn, dann nicht aus diesem Grunde erhöht. Dies liegt an der Befürchtung, dass eine Leistungserhöhung die Motivation bei der Arbeitssuche verringern könnte. Ebenso besteht die Sorge, das zusätzliche Geld werde in Genussgüter, wie Zigaretten und Alkohol, anstatt in eine gesunde Ernährung der Kinder investiert.
Ernährungsbedingte Erkrankungen, wie Adipositas, Diabetes Mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in dieser sozialen Schicht viel häufiger anzutreffen, als in anderen. Doch ist der Zustand der wachsenden „dicken Unterschicht“ mit mangelndem Interesse, Passivität und schlichtweg zu geringem Einkommen zu erklären? Stecken vielleicht noch mehr Gründe dahinter?
Diese Fragen werden in der folgenden Hausarbeit beleuchtet und auch, ob es wirklich nur diese scheinbar eindeutigen Ursachen gibt oder nicht noch mehr Gründe dahinterstecken. Dabei wird außerdem der Frage nachgegangen, inwieweit es überhaupt möglich ist, sich von Sozialleistungen, durch den Einsatz von haushälterischen Kompetenzen gesund zu ernähren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definition Armut
- 2. Armut und Ernährung
- 3. Bedeutung der Ernährung
- 4. Vollwertige Ernährung
- 5. Ursachen für Fehlernährung
- 6. Ernährung in der armen Familie
- 7. Kann man sich von Sozialleistungen gesund ernähren?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob eine gesunde Ernährung trotz Sozialleistungen möglich ist, wenn haushälterische Kompetenzen vorhanden sind. Sie analysiert die Zusammenhänge zwischen Armut, Ernährung und haushälterischen Fähigkeiten und untersucht, ob die gängige Annahme, dass gesunde Ernährung in den unteren sozialen Schichten aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht möglich ist, zutrifft.
- Definition von Armut und ihre Auswirkungen auf die Ernährung
- Bedeutung der Ernährung für die körperliche und soziale Entwicklung
- Ursachen für Fehlernährung in armen Familien
- Rolle von haushälterischen Kompetenzen für eine gesunde Ernährung
- Möglichkeiten und Grenzen der Ernährung mit Sozialleistungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der ungesunden Ernährung in den unteren sozialen Schichten dar und führt die Forschungsfrage ein. Sie hinterfragt die gängige Annahme, dass fehlende finanzielle Mittel die Hauptursache für eine ungesunde Ernährung sind. Die Arbeit untersucht, ob es weitere Gründe für diese Entwicklung gibt und ob eine gesunde Ernährung mit Sozialleistungen möglich ist.
Kapitel 1 definiert den Begriff der Armut und unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Es wird erläutert, dass in Deutschland kaum jemand von absoluter Armut betroffen ist und die folgenden Ausführungen sich auf Menschen in relativer Armut beziehen. Diese Menschen erhalten zwar Sozialleistungen, sind aber durch die fehlenden finanziellen Mittel meist von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen.
Kapitel 2 beleuchtet den Zusammenhang zwischen Armut und Ernährung. Es wird dargestellt, dass Armut mit Hunger verbunden ist, da sie einen Mangel an finanziellen Mitteln darstellt, die für eine ausreichende Lebensgrundlage benötigt werden. Die Ausgaben für Lebensmittel gehören zu den wenigen variablen Kosten im Haushalt und können daher bei Bedarf reduziert werden. Allerdings müssen Familien aus der unteren sozialen Schicht den Großteil ihres Einkommens bereits für Lebensmittel aufwenden. Dies führt dazu, dass bei unerwarteten Ausgaben an den Nahrungsmitteln gespart werden muss oder gar Mahlzeiten entfallen. Dies ist ein Grund für eine verstärkte Inanspruchnahme von Tafeln, Mittagstischen und Schulspeisungen. Alleinerziehende haben ein höheres Risiko von Armut betroffen zu sein, als Familien mit beiden Elternteilen, da in der Regel ein Einkommen fehlt. Unterhaltszahlungen des ehemaligen Lebenspartners sind in unteren sozialen Schichten eher die Ausnahme, da dieser meist die finanziellen Mittel dafür nicht aufbringen kann. Somit besteht für Kinder aus solchen familiären Verhältnissen auch ein erhöhtes Risiko für Fehlernährung.
Kapitel 3 behandelt die Bedeutung der Ernährung. Es wird erläutert, dass die Ernährung der Versorgung des Körpers mit Nährstoffen zur Deckung des täglichen Energiebedarfs dient. Dabei sollte ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlehydraten, Eiweißen und Fetten erreicht werden. Eine Trinkmenge von mindestens 1,5l kalorienarmer Flüssigkeiten am Tag ist wichtig für einen physiologischen Flüssigkeitshaushalt. Allerdings hat Ernährung in einer Wohlstandsgesellschaft wie Deutschland längst nicht mehr die Bedeutung der bloßen Energieversorgung. Sie gestaltet unser soziales und kulturelles Leben und kann moralische sowie religiöse Überzeugungen ausdrücken.
Kapitel 4 befasst sich mit der vollwertigen Ernährung. Es werden die verschiedenen Nährstoffe und ihre Bedeutung für den Körper erläutert. Es wird betont, dass eine vollwertige Ernährung nicht nur die ausreichende Versorgung mit Energie, sondern auch mit allen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen gewährleisten muss. Die Bedeutung von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten für eine gesunde Ernährung wird hervorgehoben.
Kapitel 5 untersucht die Ursachen für Fehlernährung. Es werden verschiedene Faktoren wie fehlendes Wissen über gesunde Ernährung, mangelnde finanzielle Mittel, Zeitmangel und ungesunde Essgewohnheiten als Ursachen für Fehlernährung in armen Familien genannt. Es wird auch auf die Rolle von Werbung und Medien in der Entstehung von ungesunden Essgewohnheiten eingegangen.
Kapitel 6 beleuchtet die Ernährung in der armen Familie. Es wird dargestellt, wie sich die Armut auf die Ernährungspraktiken in armen Familien auswirkt. Es werden die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Ernährungsplanung und -umsetzung in diesen Familien beschrieben. Es wird auch auf die Bedeutung von haushälterischen Kompetenzen für eine gesunde Ernährung eingegangen.
Kapitel 7 untersucht die Frage, ob man sich von Sozialleistungen gesund ernähren kann. Es wird analysiert, ob die Sozialleistungen ausreichend sind, um eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Es werden die Möglichkeiten und Grenzen der Ernährung mit Sozialleistungen diskutiert. Es wird auch auf die Rolle von haushälterischen Kompetenzen für eine gesunde Ernährung mit Sozialleistungen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Armut, Ernährung, haushälterische Kompetenzen, gesunde Ernährung, Sozialleistungen, Fehlernährung, Familien, Kinder, Wohlstandsgesellschaft, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Ist gesunde Ernährung trotz Bezug von Sozialleistungen möglich?
Die Hausarbeit untersucht, ob durch den gezielten Einsatz von haushälterischen Kompetenzen eine vollwertige Ernährung auch mit dem knappen Budget von Sozialleistungen realisierbar ist.
Warum sparen arme Familien oft an Lebensmitteln?
Lebensmittelkosten gehören zu den variablen Kosten im Haushalt. Wenn unerwartete Ausgaben anfallen, wird oft zuerst am Essen gespart, da Fixkosten wie Miete nicht kurzfristig reduziert werden können.
Welche Rolle spielen „haushälterische Kompetenzen“?
Dazu gehören Fähigkeiten wie Preisvergleiche, Kenntnisse über saisonale Produkte, Kochen mit Grundnahrungsmitteln und effiziente Vorratshaltung. Diese Kompetenzen können helfen, trotz geringer Mittel gesund zu essen.
Warum sind ernährungsbedingte Krankheiten in unteren Schichten häufiger?
Neben finanziellen Engpässen spielen oft fehlendes Wissen über gesunde Ernährung, ungesunde Essgewohnheiten, Zeitmangel und der Einfluss von Werbung für billige, kalorienreiche Produkte eine Rolle.
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bedroht das physische Überleben (Mangel an Nahrung/Obdach). Relative Armut in Deutschland bedeutet, dass man deutlich weniger Mittel hat als der Durchschnitt und somit von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen ist.
Welche sozialen Folgen hat Fehlernährung bei Kindern?
Fehlernährung kann zu Entwicklungsverzögerungen und Krankheiten wie Adipositas führen, was wiederum die soziale Ausgrenzung verstärken und die Bildungschancen negativ beeinflussen kann.
- Quote paper
- Jenny Feierabend (Author), 2013, Haushälterische Kompetenzen. Gesunde Ernährung trotz Sozialleistungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288632