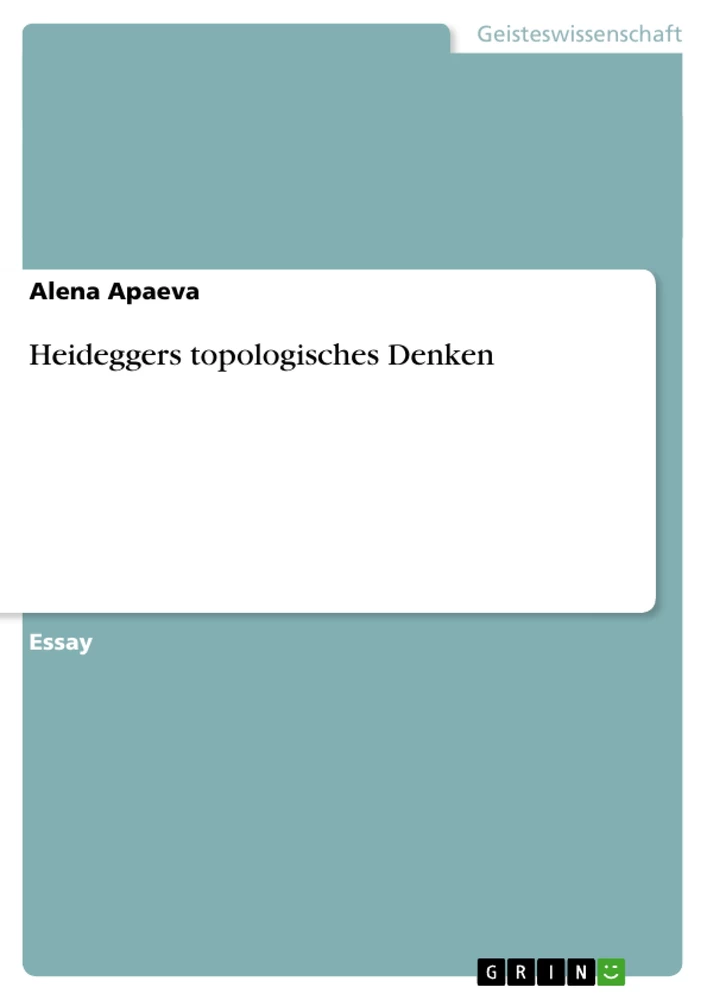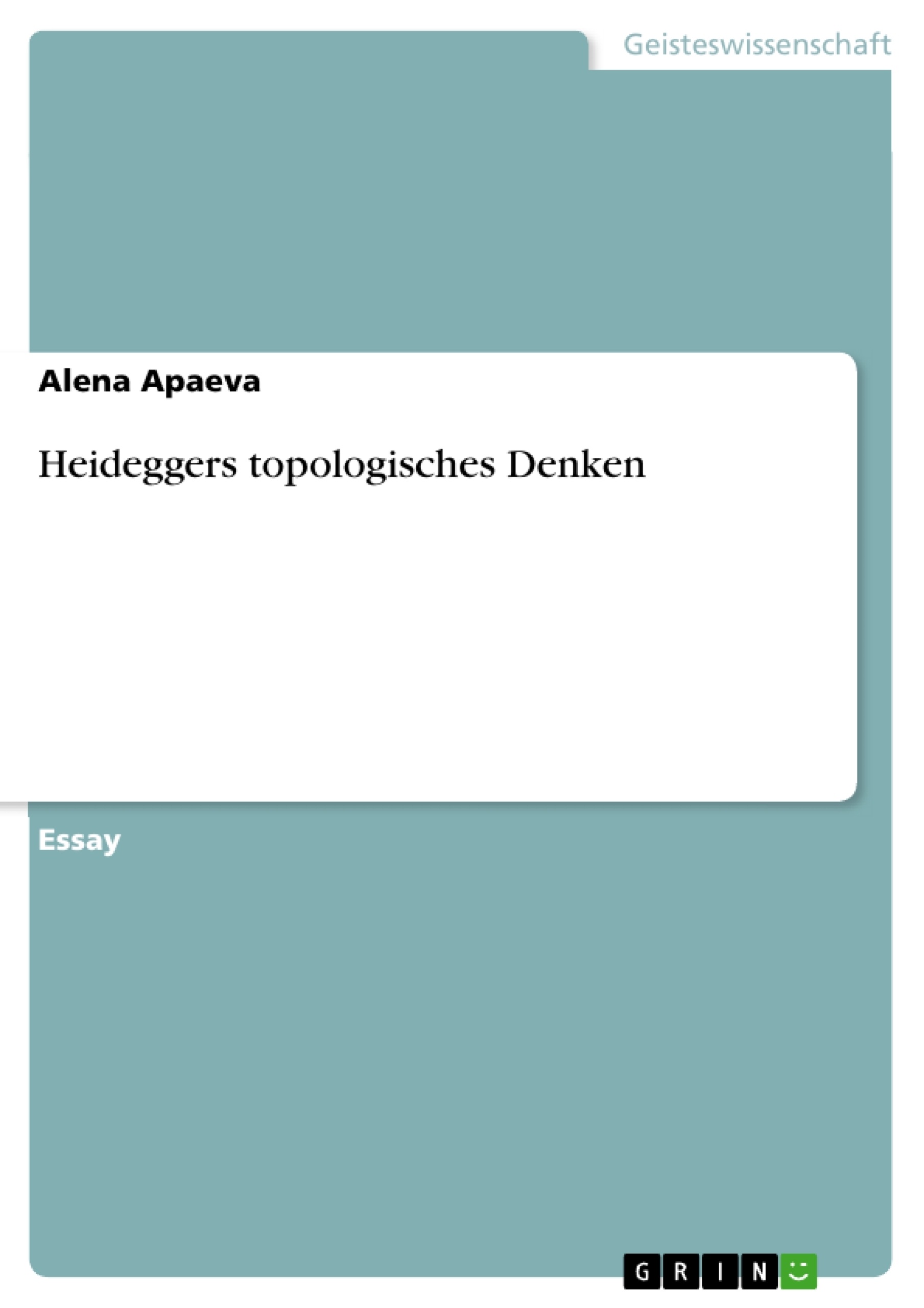In diesem Essay geht es um Heideggers Landschaft von einem Bild des Denkens und der Sprache in der Interpretation vom russischen Philosoph Valeriy Podoroga. Heideggers Landschaft ist kein biographischer Ort, sondern ein Ort des Denkens.
Martin Heideggers Denken kann nach Walerij Podoroga als topologisch definiert werden. “Aber das denkende Dichten ist in der Wahrheit die Topologie des Seyns. Sie sagt diesem die Ortschaft seines Wesens”. Aber der Erste, der auf das topologische Denken Heideggers aufmerksam machte, war Otto Pöggeler. Er “hat in seinem Aufsatz Dichtungstheorie und Toposforschung an einen dichtungstheoretischen Topos erinnert”.
Podoroga kommt in seiner Forschung über die Philosophie der Sprache von Martin Heidegger aus der französisch postmodernen Tradition des Verstehens von Heidegger, vor allem, des Derrida und Deleuze. Zum Beispiel, borgt er den Begriff “Deterritorialisierung” von Deleuze. “Deterritorialisierung ist… die Befreiung der Sprache. Schriftsteller bringen die Sprache an ihre Grenzen, suchen ein ‚Außerhalb‘ der Sprache”.
Inhaltsverzeichnis
- Heideggers Topologisches Denken
- Deterritorialisierung des Denkens
- Die Landschaft als Ort des Undenkbaren
- Raum und Ort in Heideggers Denken
- Das Geviert als Struktur des Daseins
- Die Erde und die Welt im Geviert
- Der Riss als Ursprung des Werkes
- Die Kräfte der Erde und der Welt
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Beitrag analysiert Martin Heideggers Denken aus der Perspektive der Topologie, wie sie vom russischen Philosophen Valeriy Podoroga interpretiert wird. Podoroga untersucht Heideggers Konzept der Landschaft als Ort des Denkens und der Sprache und zeigt, wie Heidegger die Idee "wieder deterritorialisieren" will, um eine neue Beziehung zwischen Denken und Landschaft zu etablieren.
- Heideggers topologisches Denken
- Die Rolle der Landschaft im Denken
- Deterritorialisierung und die Beziehung zwischen Denken und Sprache
- Das Geviert als Struktur des Daseins
- Die Kräfte der Erde und der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Der Beitrag beginnt mit einer Einführung in Heideggers topologisches Denken, wie es von Podoroga interpretiert wird. Podoroga argumentiert, dass Heideggers Denken als topologisch definiert werden kann, da es sich mit der "Ortschaft des Seyns" beschäftigt. Er bezieht sich dabei auf die Arbeiten von Otto Pöggeler, der als erster auf das topologische Denken Heideggers aufmerksam machte.
Im zweiten Kapitel wird die Deterritorialisierung des Denkens von Heidegger untersucht. Podoroga greift dabei auf Deleuzes Konzept der Deterritorialisierung zurück und zeigt, wie Heidegger versucht, die Idee zu "wieder deterritorialisieren" und eine neue Beziehung mit der Landschaft zu etablieren. Der Gedanke ist der Riss zwischen sichtbaren und unsichtbaren Räumen, zwischen physischen und nicht physischen Landschaften.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Landschaft als Ort des Undenkbaren. Podoroga argumentiert, dass die Landschaft ein "undenkbarer Ort" ist, der von den Menschen konzipiert werden muss. In der Landschaft gleichen sich der Gedanke und das poetische Wort an, da die Landschaft ein offenes Bild ist, eine Kontur von jenem Ursprung, aus dem sie ihre Existenz bekommt.
Im vierten Kapitel wird Heideggers Denken über Raum und Ort untersucht. Podoroga analysiert Heideggers Werk "Einführung in die Metaphysik" und zeigt, wie Heidegger die Bedeutung von Raum in Bezug auf die Sprache versteht. Heidegger spricht über das "seherische Wort" und die Beziehung zwischen Schein und Sein in der Dichtung. Er argumentiert, dass das Wort nicht nur seherisch, sondern auch klingend ist und im Wort Raum spricht.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Geviert als Struktur des Daseins. Podoroga zeigt, wie Heideggers Denken eine topologische Struktur hat, die aus dem göttlichen Wesen, dem sterblichen Wesen, dem irdischen Wesen und dem himmlischen Wesen besteht. Diese vier Elemente befinden sich in der "Räumlichkeit des Daseins" und werden durch die "Nähe" bestimmt.
Das sechste Kapitel untersucht die Erde und die Welt im Geviert. Podoroga argumentiert, dass die Erde die Haupt-Welt-Seite des Gevierts ist und alle anderen Kräfte mehr verformt, als diese sie. Die Erde steht der Welt gegenüber, weil die Welt alle anderen Kräfte sammelt. Die Strategie dieser Kräfte wird durch die Strategie des Risses bestimmt.
Das siebte Kapitel befasst sich mit dem Riss als Ursprung des Werkes. Podoroga zeigt, wie der Riss die endgültige kompositorische Abbildung ist, die im Streit der Erde und der Welt gebildet wurde. Der Riss ist der Ursprung des Werkes und hat den Charakter der verbindenden Kraft, da der Sitz seines Schaffens die Erde ist.
Das achte Kapitel analysiert die Kräfte der Erde und der Welt. Podoroga unterscheidet drei Klassen von Kräften und konstruiert das Schema der Aktionen der gemeinsamen Kräfte der Erde und der Welt. Die erste Klasse der Kräfte entfernt die Erde und die Welt so weit wie möglich voneinander, die zweite Klasse der Kräfte sind die Kräfte der gemeinsamen Aktionen, und die dritte Klasse der Kräfte sind die Kräfte der Transformation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Heideggers topologisches Denken, die Deterritorialisierung des Denkens, die Landschaft als Ort des Undenkbaren, Raum und Ort in Heideggers Denken, das Geviert als Struktur des Daseins, die Erde und die Welt im Geviert, der Riss als Ursprung des Werkes, die Kräfte der Erde und der Welt sowie die Interpretation von Valeriy Podoroga.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Heideggers topologischem Denken?
Es beschreibt ein Denken, das sich mit der „Ortschaft des Seyns“ befasst. Heidegger betrachtet Orte und Landschaften nicht biographisch, sondern als Räume des Denkens und der Sprache.
Was bedeutet „Deterritorialisierung“ bei Heidegger?
Nach Podoroga will Heidegger das Denken von festgefahrenen Begriffen befreien (deterritorialisieren), um eine neue Beziehung zwischen dem Denken und der „Landschaft des Undenkbaren“ zu schaffen.
Was ist das „Geviert“ in Heideggers Philosophie?
Das Geviert ist eine Struktur des Daseins, bestehend aus dem Göttlichen, den Sterblichen, der Erde und dem Himmel. Diese Elemente bestimmen die „Räumlichkeit“ unseres Wesens.
Welche Rolle spielt der „Riss“?
Der Riss ist der Ursprung eines Werkes und entsteht im Streit zwischen „Erde“ und „Welt“. Er fungiert als verbindende Kraft und kompositorische Abbildung dieser Kräfte.
Wer ist Valeriy Podoroga?
Podoroga ist ein russischer Philosoph, der Heideggers Werk aus einer postmodernen Perspektive (beeinflusst von Deleuze und Derrida) interpretiert und das topologische Element hervorhebt.
- Quote paper
- Alena Apaeva (Author), 2012, Heideggers topologisches Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289010