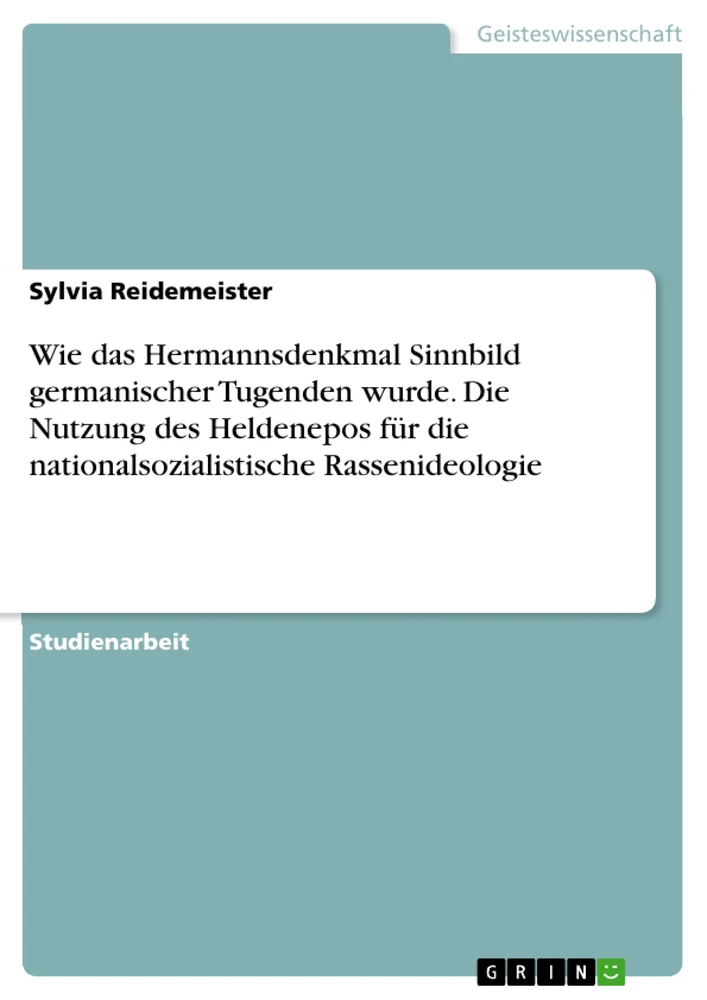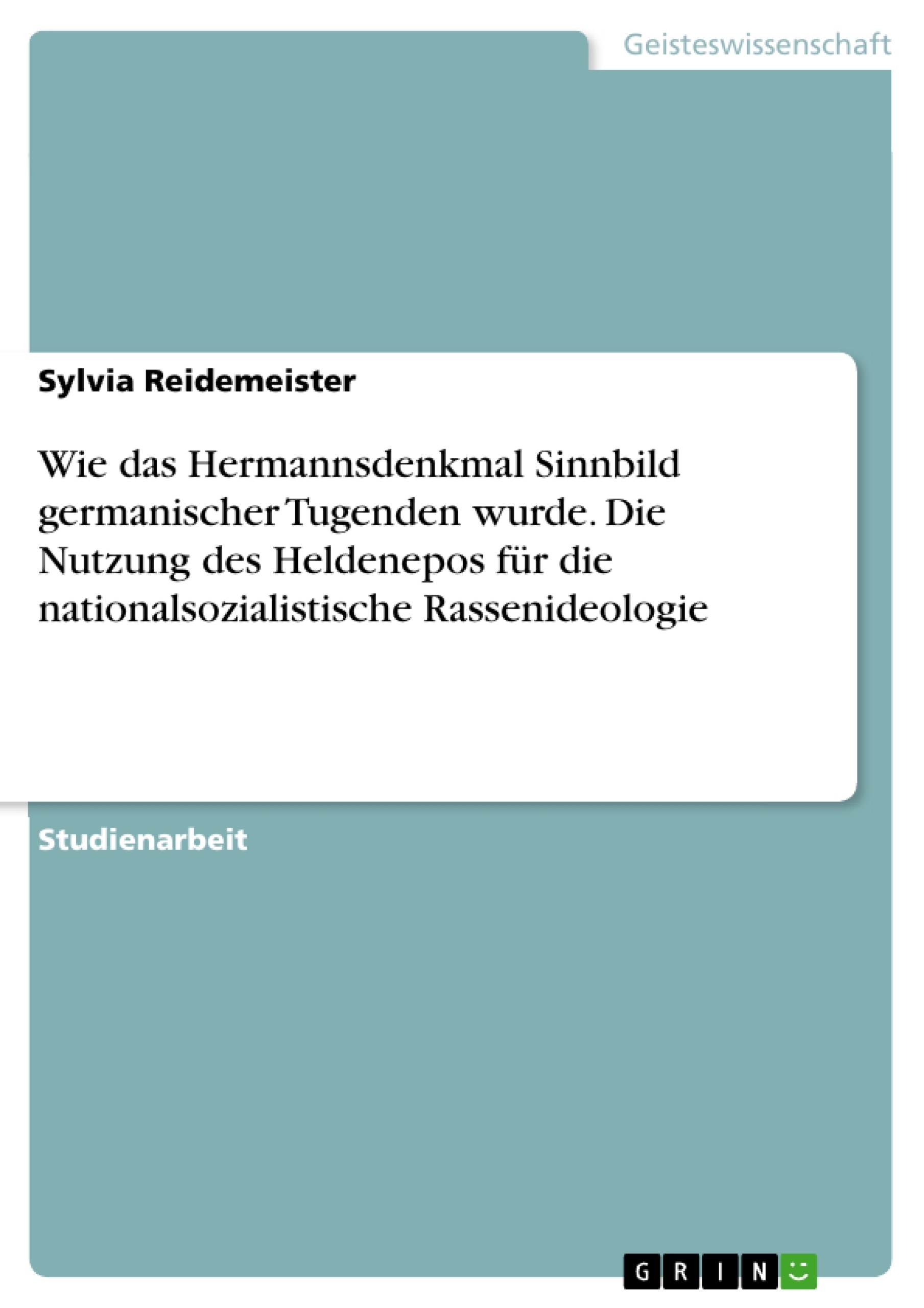Das die Nationalsozialisten die Kultur des deutschen Volkes für ihre Zwecke missbrauchten, ist allgemein bekannt. Sie nahmen Einfluss auf die Musik, Literatur, Kunst und Architektur. Sie beeinflussten sogar das private Leben.
Wie gingen die Nationalsozialisten aber mit Heldenepen um?
Ein wichtiges Beispiel hierfür ist das Hermannsdenkmal in Detmold. Es zeigt den Cheruskerfürsten Arminius, oder auch Hermann genannt. Er ist die Gestalt in der Mythologie, die am ehesten mit Kampf für Freiheit in Verbindung gebracht wird. Zum Einen, weil er die römische Armee, welche von Varus angeführt wurde, auf eigenem Gebiet geschlagen hat und somit die Germanen vor den Feinden „gerettet“ hat. Zum Anderen, war er der Erste, der es geschafft hat, die untereinander verfeindeten germanischen Stämme zu vereinen und gemeinsam gegen einen Feind zu kämpfen.
Das war ein Grundgedanke dem sich die deutsche Bevölkerung immer wieder ausgesetzt sah. In der Zeit des Humanismus fanden interessierte Sucher immer wieder Heldenepen, welche sie auf die derzeitige politische Lage beziehen konnten.
Unter anderem wurde der Bericht über Arminius wiederentdeckt, den die Humanisten in den „Annalen des Tacitus“ fanden. Dadurch bekamen sie eine beglaubigte Ursprungsgeschichte und das ausgerechnet von einem Römer.
Weiterhin berichtet Tacitus über zahlreiche Tugenden, wie ihre
Kriegstüchtigkeit. Die Humanisten bemühten sich Arminius zum ersten deutschen Helden zu machen. Er wurde zum strahlenden Führer eines deutsch - germanischen Freiheitskampfes. Dieses Bild setzte sich bis in die Gegenwart fort. Martin Luther machte „Arminius“ in seinen Tischreden „Hermann“. Daraus wurde der Held „Hermann der Cherusker“
Dieser Hermann wurde im 17. Jahrhundert fester Bestandteil der deutschen Helden. Viele Schriften wurden verfasst, welche ihn als kämpferisches Vorbild und Garant für die deutschen Freiheit und Unabhängigkeit lobpreisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Hermannsdenkmal
- Die Baugeschichte
- Der Erbauer
- Der Historische Hintergrund
- Die Rassenideologie der Nationalsozialisten
- Die Germanen
- Die Forschungsgemeinschaft deutsches Ahnenerbe
- Der Ariernachweis
- Der Bedeutungswandel des Denkmals während der NS – Zeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Instrumentalisierung des Hermannsdenkmals durch die Nationalsozialisten. Sie beleuchtet den historischen Kontext des Denkmals, seine Entwicklung vom Symbol nationaler Einheit zur Stütze der rassistischen Ideologie des NS-Regimes. Der Fokus liegt auf dem Bedeutungswandel des Denkmals und der gezielten Nutzung des Arminius-Mythos zur Legitimierung nationalsozialistischer Ziele.
- Der historische Kontext des Hermannsdenkmals und seine Entstehung im 19. Jahrhundert.
- Die Entwicklung des Arminius-Mythos und seine Bedeutung für die deutsche Identität.
- Die Instrumentalisierung des Denkmals und des Arminius-Mythos durch die Nationalsozialisten.
- Die Nutzung des Heldenepos zur Unterstützung der nationalsozialistischen Rassenideologie.
- Der Bedeutungswandel des Hermannsdenkmals während der NS-Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Frage nach dem Umgang der Nationalsozialisten mit Heldenepen am Beispiel des Hermannsdenkmals. Sie hebt die Bedeutung Arminius' als Symbol für den Kampf um Freiheit hervor und skizziert die Rezeption des Mythos von der Humanismuszeit bis in die NS-Zeit. Die bereits bestehende Verehrung Arminius’ wird als Nährboden für die spätere nationalsozialistische Instrumentalisierung dargestellt.
Das Hermannsdenkmal: Dieses Kapitel beschreibt das Hermannsdenkmal im Kontext der nationalen Einigung Deutschlands. Es erläutert die Baugeschichte, von den ersten Initiativen und der Geldspende über die Unterbrechungen durch Revolution und Finanzmangel bis zur Fertigstellung und Einweihung im Jahre 1875. Die Architektur des Denkmals, insbesondere die Symbolik der Figur des Arminius und seines Schwertes, werden detailliert beschrieben. Der Bau wird als Ausdruck des nationalen Selbstverständnisses und des Strebens nach Einheit interpretiert.
Die Baugeschichte: Dieses Kapitel detailliert die Baugeschichte des Hermannsdenkmals. Es beschreibt die Gründung von Vereinen zur Unterstützung des Projektes, die Unterbrechung der Arbeiten durch die Revolution von 1848 und die finanzielle Lage. Es wird hervorgehoben, wie die Fertigstellung des Denkmals mit der Reichsgründung 1871 wieder an Fahrt gewann und durch Spenden prominenter Persönlichkeiten ermöglicht wurde. Der Bau wird im Kontext nationaler Ereignisse und des politischen Willens zur Einheit gesehen.
Der Historische Hintergrund: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Hintergrund der Rezeption des Arminius-Mythos, von seiner Entdeckung durch Humanisten bis zu seiner Verwendung im 19. Jahrhundert als Symbol deutscher Einheit und Widerstand gegen fremde Mächte. Es beleuchtet, wie verschiedene Interpretationen des Mythos im Laufe der Zeit entstanden und wie Arminius zu einer zentralen Figur der deutschen nationalen Identität wurde. Die Kapitel betont den Zusammenhang zwischen den politischen Ereignissen und der symbolischen Bedeutung des Arminius.
Die Rassenideologie der Nationalsozialisten: Dieses Kapitel behandelt die nationalsozialistische Rassenideologie und deren Bezug zum Arminius-Mythos. Es analysiert die Instrumentalisierung der Germanen und ihrer Geschichte, die Rolle der „Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe“ und die Bedeutung des „Ariernachweises“ im Kontext des Denkmals. Der Fokus liegt auf der strategischen Aneignung des Arminius-Mythos zur Legitimation rassistischer Behauptungen und nationalsozialistischer Politik.
Der Bedeutungswandel des Denkmals während der NS – Zeit: Dieses Kapitel untersucht, wie sich die Bedeutung des Hermannsdenkmals während der NS-Zeit veränderte und wie es in die nationalsozialistische Propaganda integriert wurde. Es beschreibt die Umdeutung des Denkmals als Symbol für die „arische Rasse“ und den Kampf gegen „fremde“ Feinde. Der Bedeutungswandel wird als gezielte Instrumentalisierung eines bestehenden nationalen Symbols zur Unterstützung der NS-Ideologie dargestellt.
Schlüsselwörter
Hermannsdenkmal, Arminius, Nationalsozialismus, Rassenideologie, Germanenmythos, Nationale Identität, Symbolpolitik, Propaganda, Geschichtsrevisionismus, Deutsch-Französischer Krieg, Reichsgründung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Hermannsdenkmal und dem Nationalsozialismus
Was ist der Inhalt der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Instrumentalisierung des Hermannsdenkmals durch die Nationalsozialisten. Sie untersucht den historischen Kontext des Denkmals, seinen Bedeutungswandel vom Symbol nationaler Einheit zur Stütze der rassistischen Ideologie des NS-Regimes und die gezielte Nutzung des Arminius-Mythos zur Legitimierung nationalsozialistischer Ziele.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Kontext des Hermannsdenkmals und seine Entstehung im 19. Jahrhundert, die Entwicklung des Arminius-Mythos und seine Bedeutung für die deutsche Identität, die Instrumentalisierung des Denkmals und des Arminius-Mythos durch die Nationalsozialisten, die Nutzung des Heldenepos zur Unterstützung der nationalsozialistischen Rassenideologie und den Bedeutungswandel des Hermannsdenkmals während der NS-Zeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, dem Hermannsdenkmal (inkl. Baugeschichte und Erbauer), dem historischen Hintergrund, der nationalsozialistischen Rassenideologie (Germanen, Ahnenerbe, Ariernachweis), dem Bedeutungswandel des Denkmals während der NS-Zeit und einer Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Aspekt.
Wie wird die Baugeschichte des Hermannsdenkmals dargestellt?
Die Baugeschichte wird detailliert beschrieben, von den ersten Initiativen und der Geldspende über Unterbrechungen durch Revolution und Finanzmangel bis zur Fertigstellung und Einweihung 1875. Der Bau wird als Ausdruck des nationalen Selbstverständnisses und des Strebens nach Einheit interpretiert, wobei auch die Rolle von Spenden prominenter Persönlichkeiten hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielte der Arminius-Mythos im Nationalsozialismus?
Der Arminius-Mythos wurde von den Nationalsozialisten gezielt instrumentalisiert. Die Arbeit analysiert die strategische Aneignung des Mythos zur Legitimation rassistischer Behauptungen und nationalsozialistischer Politik, mit besonderem Fokus auf die „Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe“ und den „Ariernachweis“.
Wie veränderte sich die Bedeutung des Hermannsdenkmals während der NS-Zeit?
Während der NS-Zeit wurde das Hermannsdenkmal umgedeutet und in die nationalsozialistische Propaganda integriert. Es wurde zum Symbol für die „arische Rasse“ und den Kampf gegen „fremde“ Feinde. Der Bedeutungswandel wird als gezielte Instrumentalisierung eines bestehenden nationalen Symbols zur Unterstützung der NS-Ideologie dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hermannsdenkmal, Arminius, Nationalsozialismus, Rassenideologie, Germanenmythos, Nationale Identität, Symbolpolitik, Propaganda, Geschichtsrevisionismus, Deutsch-Französischer Krieg, Reichsgründung.
Wofür ist diese Zusammenfassung gedacht?
Diese Zusammenfassung dient als umfassender Überblick über den Inhalt der Arbeit und erleichtert das Verständnis der Thematik. Sie ist für akademische Zwecke gedacht und soll die Analyse der Themen in strukturierter und professioneller Weise unterstützen.
- Quote paper
- Sylvia Reidemeister (Author), 2013, Wie das Hermannsdenkmal Sinnbild germanischer Tugenden wurde. Die Nutzung des Heldenepos für die nationalsozialistische Rassenideologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289023