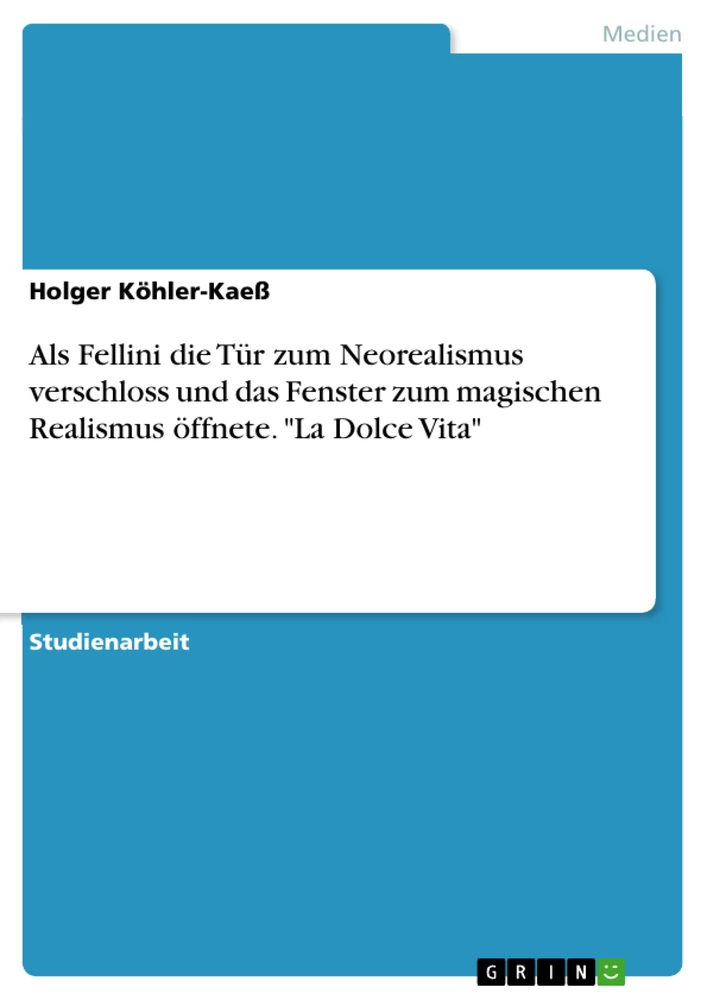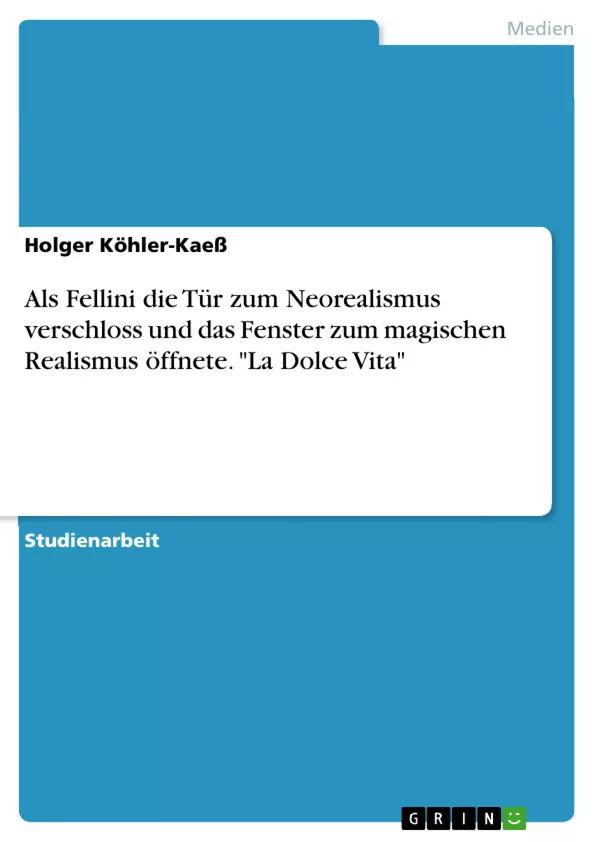"La Dolce Vita" (1960) ist Federico Fellinis siebter Kinofilm, der im Februar 1960 Weltpremiere hatte und sogleich eine Welle der Empörung auslöste. Die Presse und die katholische Kirche meldeten sich als erstes entrüstet zu Wort, denn Fellinis Schilderung der dekadenten Schönen und Reichen Roms wurde von vielen als skandalös angesehen.
Der Vatikan hätte Fellini beinahe exkommuniziert, selbst die eigene Mutter konnte nicht nachvollziehen, weshalb ihr Federico einen solchen Film gedreht hatte. Diese mediale Resonanz sorgte für eine maximale Aufmerksamkeit, die den Film sehr schnell zu einem Erfolg werden lies.
Über Jahrzehnte hielt "La Dolce Vita" die europäischen Einspielrekorde und hatte auf die italienische und europäische Gesellschaft einen ähnlichen Einfluss, wie es in den USA "Gone with the Wind" (1939) oder "The Godfather" (1972) hatten.
So schuf der Film gleich zwei neue Wortschöpfungen, die heute in den normalen Sprachgebrauch übergegangen sind. Zum Einen das Wort Paparazzi, zum Anderen den Ausdruck "La dolce Vita", der fortan in aller Welt einen Zustand beschrieb, welcher eigentlich kein süßes Leben kennzeichnete, sondern ein bittersüßes und dekadentes Lebensgefühl.
Doch wie genau lässt sich "La Dolce Vita" in Fellinis Gesamtwerk einordnen? Für einige Filmhistoriker endete mit dem Film eine Schaffensphase Fellinis, die dann mit "Otto e mezzo" (1963) eine ganz neue Wendung nahm. Für andere ist bereits La Dolce Vita der Beginn einer neuen Ära in Fellinis Werk. Zu erklären sind diese unterschiedlichen Auffassungen vor allen Dingen damit, dass man den Film unterschiedlich lesen kann.
In dieser Arbeit soll zunächst aufgezeigt werden, wie Filmhistoriker und -wissenschaftler "La Dolce Vita" sowohl filmhistorisch als auch in Fellinis Werk einordnen. Am Ende der Arbeit findet dann eine eigene Einordnung innerhalb Fellinis Filmografie statt. Zu diesem Zweck wird zunächst der Begriff des magischen Realismus vorgestellt und dann anhand von Szenenanalysen untersucht, ob sich dieser bereits in "La Dolce Vita" finden lässt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- La Dolce Vita - eine filmhistorische Einordnung
- Magischer Realismus - Versuch einer Definition
- Magischer Realismus in La Dolce Vita - Eine Spurensuche
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Federico Fellinis Film La Dolce Vita (1960) im Kontext der Filmgeschichte und im Hinblick auf den magischen Realismus. Sie untersucht, wie sich der Film in Fellinis Gesamtwerk einordnen lässt und ob er bereits Elemente des magischen Realismus aufweist. Die Arbeit zielt darauf ab, die filmhistorische Bedeutung von La Dolce Vita zu beleuchten und die Entwicklung von Fellinis Stil zu erforschen.
- Filmhistorische Einordnung von La Dolce Vita
- Definition des magischen Realismus
- Analyse von La Dolce Vita im Hinblick auf den magischen Realismus
- Einordnung von La Dolce Vita in Fellinis Gesamtwerk
- Die Bedeutung von La Dolce Vita für die Filmgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Film La Dolce Vita vor und beleuchtet seine mediale Resonanz. Sie führt in die Thematik des magischen Realismus ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich der filmhistorischen Einordnung von La Dolce Vita. Es beleuchtet den Kontext der französischen Nouvelle Vague und die Entwicklung des Films als Kunstform. Es werden verschiedene Interpretationen von Fellinis Werk und die Einordnung von La Dolce Vita in seine Filmografie diskutiert.
Das dritte Kapitel definiert den Begriff des magischen Realismus und untersucht seine Merkmale. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition des magischen Realismus vorgestellt und seine Bedeutung für die Literatur und den Film erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert La Dolce Vita im Hinblick auf den magischen Realismus. Es werden Szenen aus dem Film untersucht, die auf Elemente des magischen Realismus hindeuten. Es werden die filmischen Mittel und Techniken analysiert, die Fellini verwendet, um die magische Realität des Films zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Federico Fellini, La Dolce Vita, magischer Realismus, Filmgeschichte, italienischer Film, Nouvelle Vague, Neorealismus, Surrealismus, Filmsprache, Szenenanalyse, Filmanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum löste "La Dolce Vita" 1960 einen Skandal aus?
Fellinis Darstellung der dekadenten römischen High Society und religiöse Motive führten zu Empörung bei der Presse und der katholischen Kirche.
Welche bekannten Begriffe stammen aus diesem Film?
Der Film prägte das Wort "Paparazzi" für Sensationsreporter und den Ausdruck "La dolce Vita" für ein bittersüßes, dekadentes Lebensgefühl.
Ist "La Dolce Vita" dem magischen Realismus zuzuordnen?
Die Arbeit untersucht anhand von Szenenanalysen, ob der Film bereits den Übergang vom Neorealismus zum magischen Realismus in Fellinis Werk markiert.
Wie reagierte der Vatikan auf den Film?
Der Vatikan verurteilte den Film scharf; Fellini drohte aufgrund der als skandalös empfundenen Szenen sogar die Exkommunikation.
Welche filmhistorische Bedeutung hat das Werk?
Er hielt jahrzehntelang Einspielrekorde und gilt als Wendepunkt in Fellinis Filmografie, der den Weg für spätere Meisterwerke wie "8½" ebnete.
- Quote paper
- Holger Köhler-Kaeß (Author), 2014, Als Fellini die Tür zum Neorealismus verschloss und das Fenster zum magischen Realismus öffnete. "La Dolce Vita", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289058