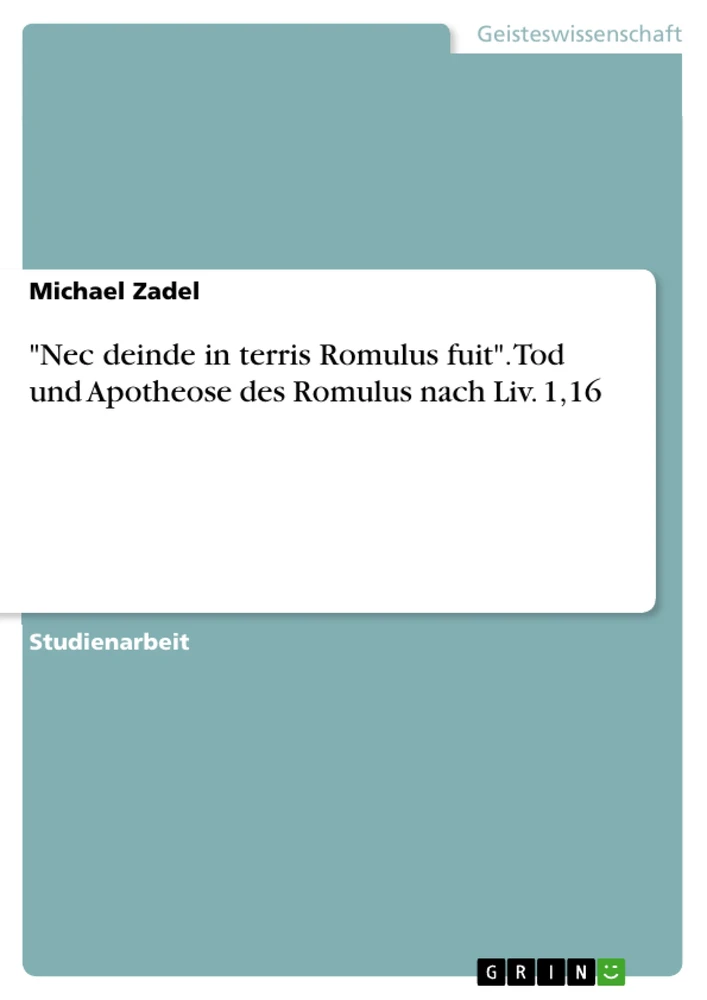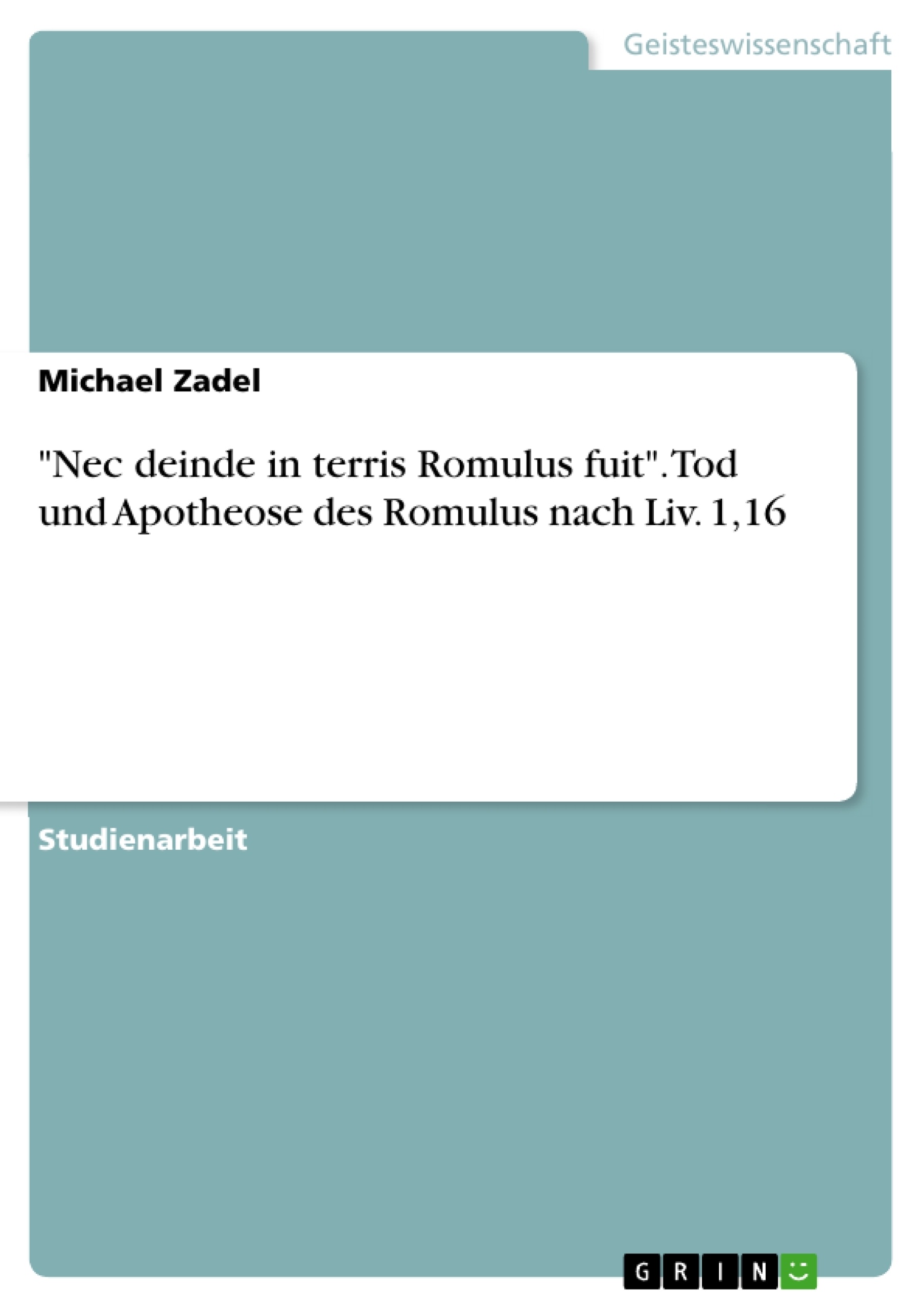Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Auszug aus dem Werk "Ab urbe condita" des römischen Schriftstellers Titus Livius und geht der Frage nach, inwieweit die durch Livius vorgenommene Schilderung des Todes und der Vergöttlichung des sagenumwobenen Stadtgründers Roms, Romulus, als authentisch angesehen werden kann und welche Rolle dabei ein gewisser Proculus Iulius spielt. Dazu wird zunächst der Textausschnitt Liv. 1,15,5-1,16,8 im Gesamtwerk des Autors positioniert und in einem weiteren Schritt paraphrasiert dargestellt.
Der Hauptteil dieser Arbeit wird sich mit der ausführlichen Interpretation des Textstückes befassen, indem die Passagen jeweils sprachlich, stilistisch und inhaltlich analysiert werden. Dabei wird auch der textkritische Apparat an einigen Stellen, soweit es sinnvoll erscheint, besprochen und eine Recherche im Thesaurus Linguae Latinae zum Wort perobscurus durchgeführt. Des Öfteren kann dabei auch eine Verbindung zwischen Livius und anderen Autoren hinsichtlich Wortwahl oder Stilistik gezogen werden.
Daran schließt sich eine knappe Darstellung der Apotheose des Romulus bei anderen prosaischen wie poetischen Autoren an. Im Mittelpunkt bei der Beschäftigung mit Paralleltexten sollen dabei die Fragen stehen, wie der jeweilige Autor das Geschehen beurteilt und welche Rolle jeweils die unterschiedlichen beteiligten Personen spielen. Dabei soll auch die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Verkünders der Worte des Romulus nicht unbeachtet bleiben. Abschließend werden die Ergebnisse noch einmal in einem Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung des Textes in das Gesamtwerk
- Begründung der Auswahl
- Darstellung des Forschungsstands
- Interpretation
- Paraphrase des Textauszuges
- Die Gestalt des Romulus (Liv. 1,15,6-1,15,8)
- Die Entrückung (Liv. 1,16,1-1,16,4)
- Epiphanie und Zukunftsvision (Liv. 1,16,5-1,16,8)
- Tod und Apotheose bei anderen Autoren
- Ennius
- Cicero
- Ovid
- Plutarch
- Zusammenfassung
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung des Todes und der Vergöttlichung des Romulus im Werk Ab urbe condita von Titus Livius. Dabei wird die Authentizität der Schilderung sowie die Rolle des Proculus lulius analysiert.
- Positionierung des Textauszuges im Gesamtwerk von Livius
- Interpretation der sprachlichen und stilistischen Besonderheiten des Textes
- Analyse der Darstellung von Romulus' Gestalt und Taten
- Vergleich der Darstellung von Tod und Apotheose des Romulus bei anderen Autoren
- Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Proculus lulius und seiner Rolle bei der Verkündigung der Göttlichkeit des Romulus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Textauszug aus Livius' Ab urbe condita im Gesamtwerk des Autors vor, erläutert die Auswahl der Textstelle und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Im zweiten Kapitel wird der Textauszug paraphrasiert und interpretiert. Die Kapitel 2.2 bis 2.4 analysieren die Darstellung der Gestalt des Romulus, seine Entrückung sowie die Epiphanie und Zukunftsvision. Kapitel 2.5 untersucht die Darstellung von Tod und Apotheose bei anderen Autoren wie Ennius, Cicero, Ovid und Plutarch.
Schlüsselwörter
Livius, Ab urbe condita, Romulus, Tod, Apotheose, Entrückung, Göttlichkeit, Proculus lulius, Geschichte, Mythos, Forschung, Interpretation, Textanalyse, Vergleich, antike Autoren.
- Citation du texte
- Michael Zadel (Auteur), 2014, "Nec deinde in terris Romulus fuit". Tod und Apotheose des Romulus nach Liv. 1,16, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289063