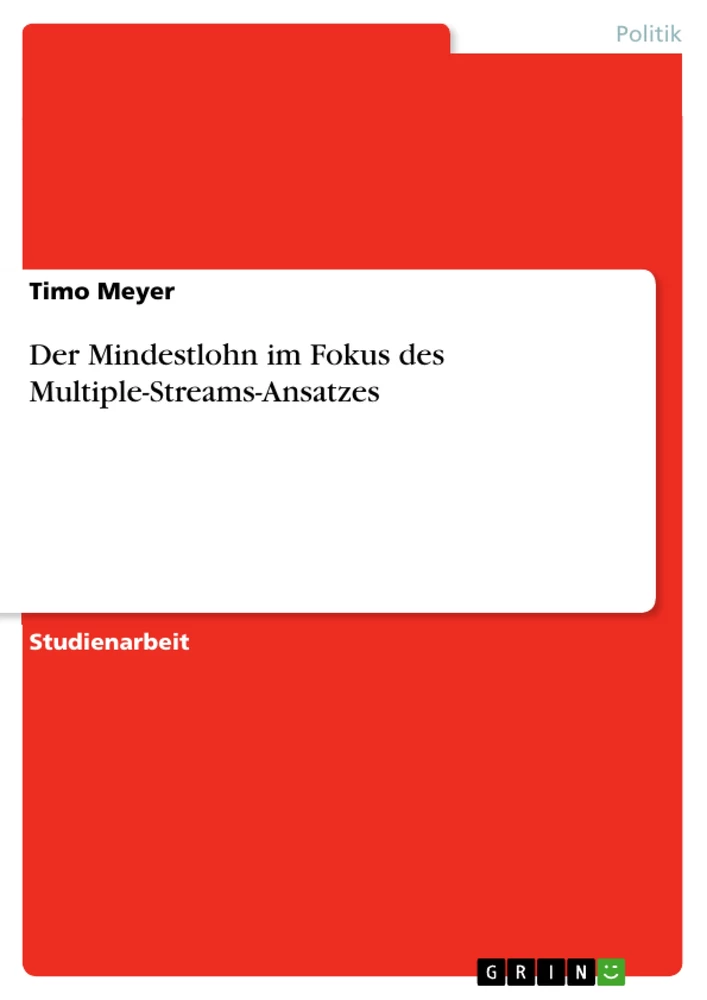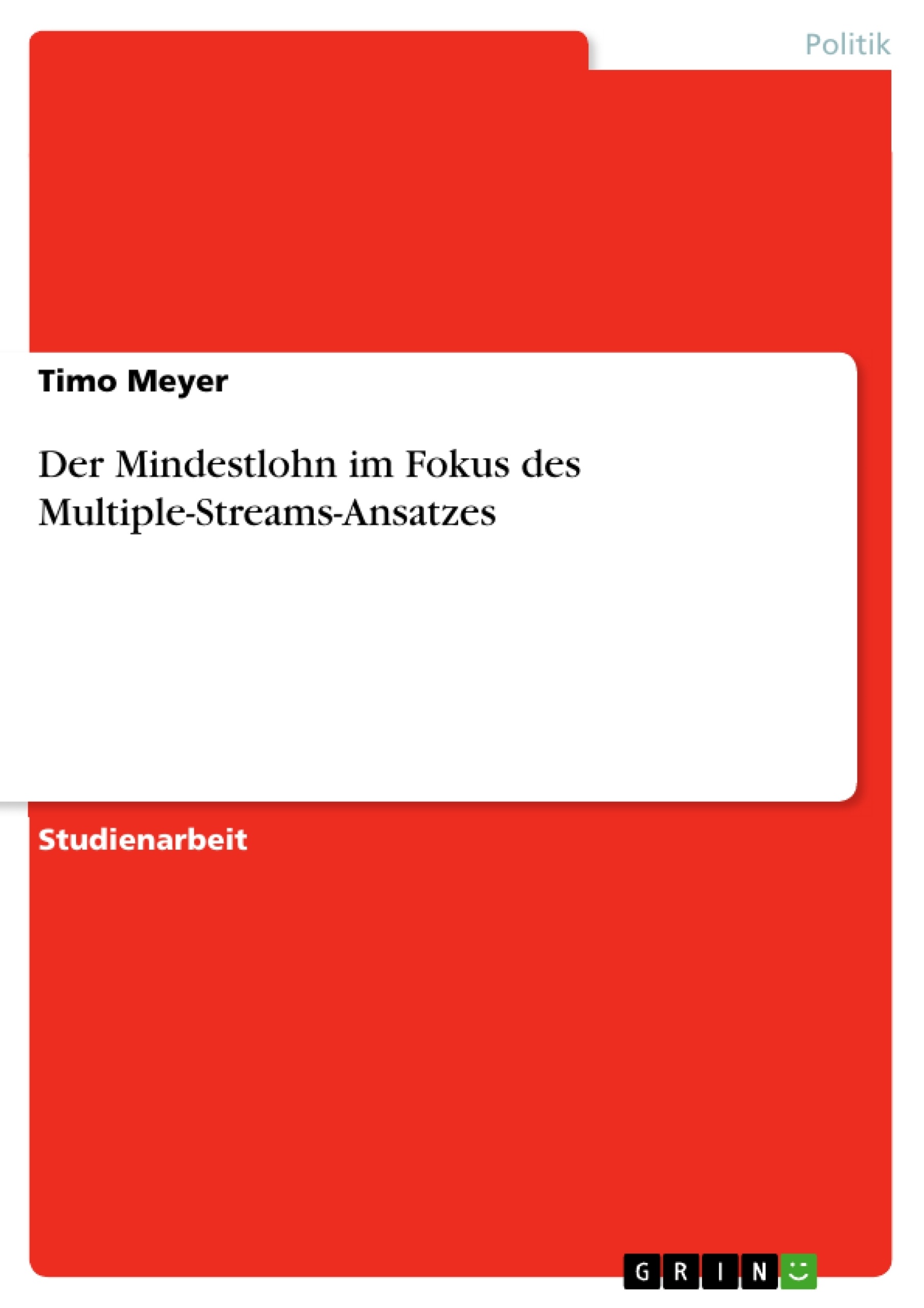John W. Kingdon begreift das Regierungssystem im Allgemeinen als eine in sich geschlossene und konfliktbeladene Struktur, die man jedoch mit den Methoden der Organisationswissenschaft analysieren und beschreiben kann. Ähnlich wie eine Organisation hat auch eine solche staatliche Struktur Regeln, Abläufe und Verfahren, die das Zustandekommen von Entscheidungen regeln. In solchen politischen Prozessen werden in einem ständigen Kreislauf Entscheidungen getroffen, formale Fristen eingehalten, Reaktionen gefordert und der Blick auf bestimmte Sachverhalte gelenkt. [...]
Der Multiple-Streams-Ansatz kann zunächst als heuristisches Rahmenwerk verstanden werden, in dessen Zentrum die Frage steht, wie nationale Regierungen Entscheidungen treffen.
Bei der vorliegenden Hausarbeit handelt es sich um den Versuch mit Hilfe des Multiple-Streams-Ansatzes in seiner umstrittenen Formulierung wie sie von Kingdon festgelegt wurde, den Zeitpunkt der Einführung des Mindestlohns in Deutschland im Sommer 2014 zu erklären. Grund für die Relevanz dieser Frage ist die Tatsache, dass der Mindestlohn nicht erst im Rahmen des Bundestagswahlkampfes 2013 ein Thema wurde, sondern er als politische Idee schon viel länger existiert. Theoretisch hätte er schon im Rahmen der letzten Großen Koalition in der Legislaturperiode 2005 bis 2009 unter Bundeskanzlerin Angela Merkel oder unter der rot-grünen Schröder-Regierung 1998 bis 2005 eingeführt werden können.
In einem ersten Schritt soll die Theorie des Multiple-Streams-Ansatzes nach Kingdon tiefer gehend erörtert werden. Dies geschieht primär anhand von Kingdons Werk Agendas, Alternatives, and Public Policies, sowie durch einen Aufsatz von Friedbert W. Rüb mit dem Titel Multiple-Streams-Ansatz: Grundlagen, Probleme und Kritik.
Anschließend wird der Mindestlohn in aller Kürze präsentiert, bevor dann in einem dritten Schritt die Theorie mit der Praxis verbunden werden soll. Anhand der Auswertung von Drucksachen des Deutschen Bundestages, von Presseartikeln, Print- und Onlinemedien sowie weiterer Quellen soll versucht werden die verschiedenen Ströme inhaltlich zu besetzen und die Frage zu klären, warum im Sommer 2014 der günstigste Zeitpunkt gekommen war, um den Mindestlohn in der Bundesrepublik Deutschland einzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Multiple-Streams-Ansatz
- Der „Problemstrom“
- Der „Policy-Strom“
- Der „Political Stream“
- Der Mindestlohn
- Der „Problemstrom“
- Der „Policy-Strom“
- Der „Political Stream“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung des Mindestlohns in Deutschland 2014 anhand des Multiple-Streams-Ansatzes von Kingdon. Ziel ist es, den Zeitpunkt der Einführung im Kontext der verschiedenen Ströme (Problem-, Policy-, Political Stream) zu erklären und die Anwendbarkeit des Modells zu analysieren.
- Der Multiple-Streams-Ansatz als Erklärungsmodell für politische Entscheidungen
- Analyse der drei Ströme im Kontext der Mindestlohndebatte
- Die Rolle von Policy Entrepreneurs
- Zeitliche Faktoren und das „Window of Opportunity“
- Bewertung der Anwendbarkeit des Modells auf den Fall des deutschen Mindestlohns
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Multiple-Streams-Ansatz von Kingdon als analytisches Werkzeug vor. Sie beschreibt das Regierungssystem als konfliktbeladene, aber analysierbare Struktur und bezieht sich auf das „Garbage Can Model“, welches den Ansatz von Kingdon beeinflusst hat. Die Arbeit zielt darauf ab, die Einführung des Mindestlohns in Deutschland 2014 mithilfe dieses Ansatzes zu erklären, indem sie die verschiedenen Ströme des Modells analysiert.
Der Multiple-Streams-Ansatz: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Multiple-Streams-Ansatz. Es wird erläutert, wie Kingdon das Regierungssystem als „organisierte Anarchie“ versteht, gekennzeichnet durch Unbeständigkeit und Zeitknappheit bei Entscheidungsfindungen. Der Ansatz reduziert die vier Ströme des Garbage Can Modells auf drei: Problem-, Policy- und Political Stream. Das Kapitel hebt die Bedeutung des „Window of Opportunity“ hervor, den Moment, in dem sich die Ströme kreuzen und eine politische Entscheidung möglich wird. Die Rolle von Policy Entrepreneurs, die aktiv die Kopplung der Ströme versuchen herbeizuführen, wird ebenfalls diskutiert.
Der Mindestlohn: (Anmerkung: Da der Text keine eigenständige Kapitelüberschrift "Der Mindestlohn" auf oberster Ebene beinhaltet, wird hier angenommen, dass der Abschnitt über den Mindestlohn und seine Anwendung die Funktion eines eigenständigen Kapitels hat. Eine detaillierte Zusammenfassung dieses Kapitels kann aufgrund des fehlenden Textes nicht erstellt werden). Dieser Abschnitt würde in einer vollständigen Zusammenfassung die kontextuelle Einbettung des Mindestlohns in das politische System und die gesellschaftlichen Debatten beleuchten. Ausführlich müsste er die verschiedenen Perspektiven, Argumente und Interessen darstellen, die in der Diskussion um die Einführung des Mindestlohns eine Rolle gespielt haben.
Schlüsselwörter
Multiple-Streams-Ansatz, Kingdon, Policy-Entrepreneurs, Mindestlohn, Deutschland, Political Stream, Policy Stream, Problemstrom, Window of Opportunity, organisierte Anarchie, Entscheidungsfindung, Agenda-Setting.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Einführung des Mindestlohns in Deutschland mit dem Multiple-Streams-Ansatz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Einführung des Mindestlohns in Deutschland im Jahr 2014 anhand des Multiple-Streams-Ansatzes von Kingdon. Ziel ist es, den Zeitpunkt der Einführung im Kontext der verschiedenen Ströme (Problem-, Policy-, Political Stream) zu erklären und die Anwendbarkeit des Modells zu beurteilen.
Welches Modell wird verwendet?
Das zentrale analytische Werkzeug ist der Multiple-Streams-Ansatz von John Kingdon. Dieser Ansatz betrachtet politische Entscheidungen als Ergebnis des Zusammentreffens von drei unabhängigen Strömen: dem Problemstrom (Problem Stream), dem Policy-Strom (Policy Stream) und dem Political Stream. Die Arbeit untersucht, wie diese Ströme im Fall des Mindestlohns zusammenwirkten.
Welche Ströme werden im Detail betrachtet?
Die Analyse umfasst eine detaillierte Betrachtung des Problemstroms (die Wahrnehmung des Problems der niedrigen Löhne), des Policy-Stroms (die Entwicklung und Verfügbarkeit verschiedener Politikoptionen zur Lösung des Problems) und des Political Streams (die politische Landschaft, die Akteure und die politische Gelegenheit). Die Interaktion dieser drei Ströme steht im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Rolle spielen Policy Entrepreneurs?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Policy Entrepreneurs, die aktiv versuchen, die verschiedenen Ströme zu verbinden und ein „Window of Opportunity“ (eine günstige Gelegenheit) für die Einführung des Mindestlohns zu schaffen. Diese Akteure spielen eine entscheidende Rolle im Prozess des Agenda-Settings.
Was ist das "Window of Opportunity"?
Das „Window of Opportunity“ bezeichnet den Zeitpunkt, an dem die drei Ströme (Problem-, Policy- und Political Stream) günstig zusammenlaufen, so dass eine politische Entscheidung, in diesem Fall die Einführung des Mindestlohns, wahrscheinlicher wird. Die Arbeit analysiert, wann und warum sich dieses „Fenster der Gelegenheit“ im Kontext der Mindestlohndebatte öffnete.
Wie wird die Anwendbarkeit des Modells bewertet?
Die Arbeit bewertet die Anwendbarkeit des Multiple-Streams-Ansatzes auf den Fall des deutschen Mindestlohns. Sie untersucht, inwieweit das Modell die komplexen politischen Prozesse, die zur Einführung des Mindestlohns führten, erfolgreich erklären kann und welche Stärken und Schwächen das Modell in diesem Kontext aufweist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Multiple-Streams-Ansatz, ein Kapitel zur Anwendung des Ansatzes auf den Mindestlohn und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema und den Multiple-Streams-Ansatz ein. Das Kapitel zum Mindestlohn analysiert die drei Ströme im Kontext der Mindestlohndebatte. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Anwendbarkeit des Modells.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Multiple-Streams-Ansatz, Kingdon, Policy-Entrepreneurs, Mindestlohn, Deutschland, Political Stream, Policy Stream, Problemstrom, Window of Opportunity, organisierte Anarchie, Entscheidungsfindung, Agenda-Setting.
- Quote paper
- Timo Meyer (Author), 2014, Der Mindestlohn im Fokus des Multiple-Streams-Ansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289122