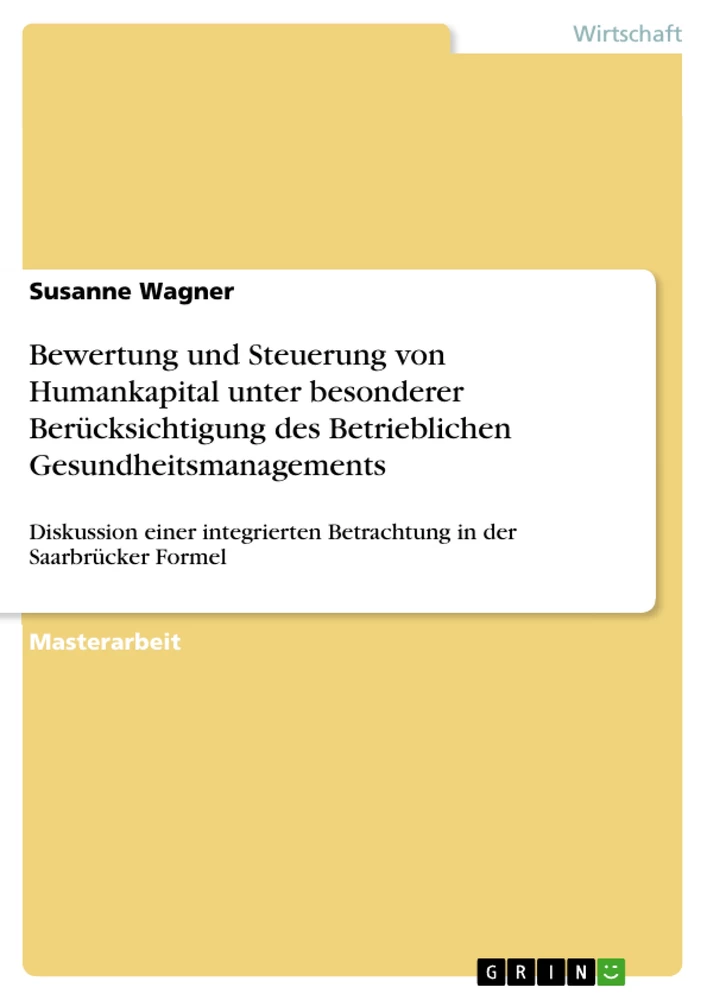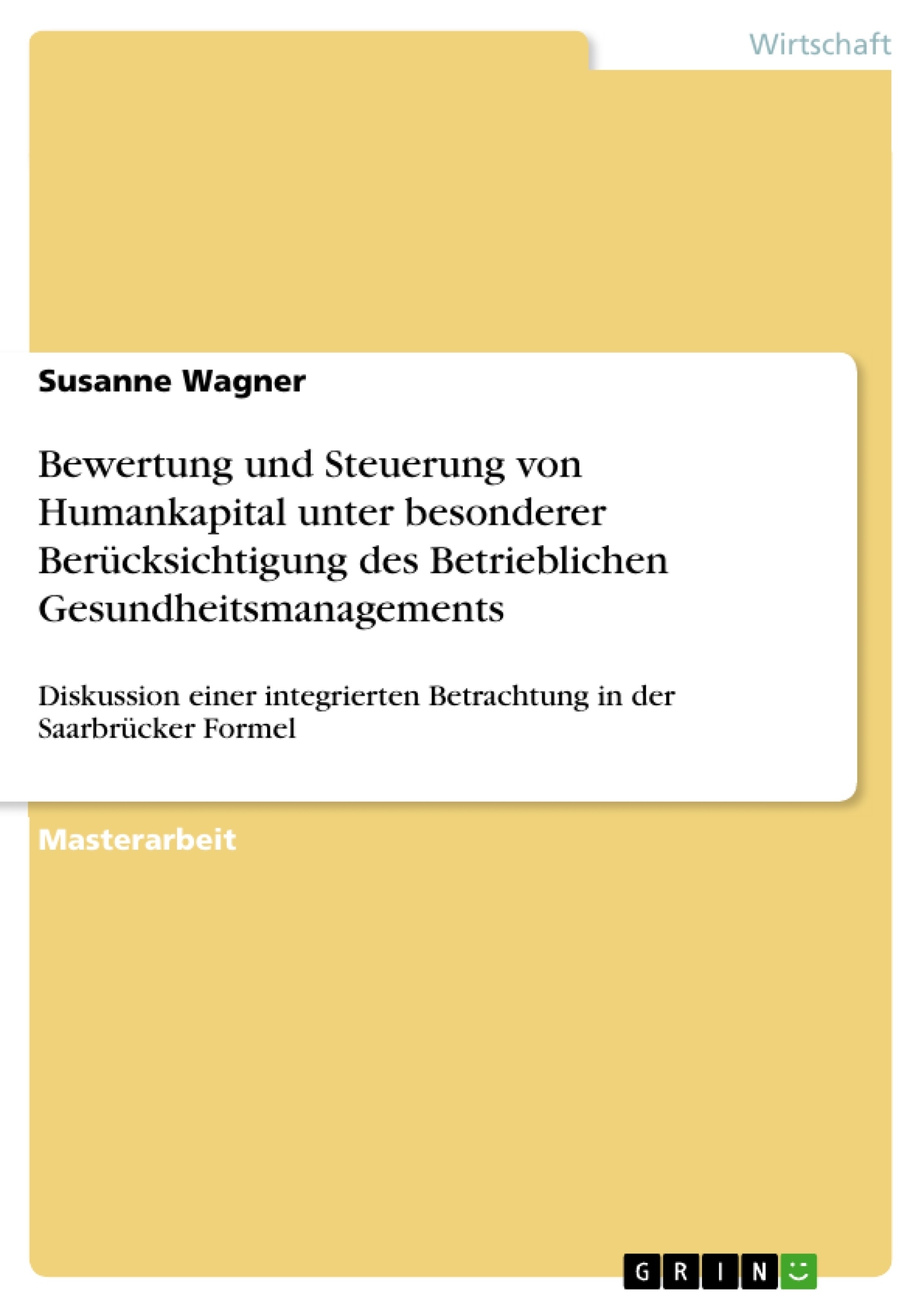Die Suche nach einer Möglichkeit, das Betriebliche Gesundheitsmanagement in einem integrierten Reporting mit dem HR-Management anhand von einer oder weniger Kennzahlen auf der Unternehmensebene zu bewerten und zu steuern, ist die Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Die Bewertung von Humankapital soll dabei den Rahmen für die Übertragung auf das Gesundheitsmanagement bilden.
Gang der Untersuchung:
Nach der umfassenden Darstellung des Begriffes Humankapital und seiner historischen Entwicklung und Bedeutung, wird das moderne Verständnis von Gesundheit erarbeitet, wie er von der WHO, dem Public Health, der Gesundheitsökonomik und von Antonovsky verstanden wird. In einer Gegenüberstellung der Einzelaspekte von Humankapital und Gesundheit werden Überschneidungen sichtbar, die ein gemeinsames Reporting rechtfertigen können. Zudem wird die Gesundheit als Bestandteil des Humankapitals identifiziert. Im nächsten Schritt werden bekannte Modelle der Humankapitalbewertung analysiert und im Hinblick auf die Eignung für eine Integration des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bewertet. Dabei wird als Lösungsweg die Saarbrücker Formel favorisiert, die eine monetäre Bewertung von Humankapital möglich macht. Im letzten Schritt werden Gesundheitsindikatoren als Kennzahlen auf der Unternehmensebene in die Formel integriert. Dabei handelt es sich um die Gesundheitsquote und den Work Ability-Index.
Wesentliche Erkenntnisse (Management Summary):
Gesundheit ist ein Bestandteil des Humankapitals. Für die Bewertung und Steuerung auf Unternehmensebene ist ein Instrument notwendig, das die mehrdimensionalen Inhalte des modernen Gesundheitsbegriffs abbilden kann. Die Saarbrücker Formel integriert verschiedene Bewertungsansätze in einer Formel und kann diesem Anspruch gerecht werden. Gleichwohl wird deutlich, dass die Bewertung von Humankapital eine Herausforderung für Unternehmen bleibt, die auch Chancen für neue Erkenntnisse zum Umgang mit dem Thema Humankapital bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungs- und Stichwortverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einführung in das Thema
- 1.1 Klassifizierung von immateriellen Vermögenswerten
- 1.2 Humankapital
- 2. Die Problemstellung
- 2.1 Die methodische Vorgehensweise
- 3. Moderne Gesundheitsansätze und ihre Anwendung im betrieblichen Kontext
- 3.1 Das Gesundheitsbild der WHO und im Public Health
- 3.2 Die Salutogenese
- 3.3 Der Gesundheitsbegriff aus der Gesundheitsökonomik
- 4. Grundlagen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 5. Die Bedeutung von Gesundheit im Unternehmen
- 5.1 Gesundheit ist Humankapital
- 5.2 Die wesentlichen Treiber von Gesundheit
- 5.3 Die Treiber von Humankapital und ihre Übertragung auf die Gesundheit
- 6. Ansätze zur Bewertung von Humankapital im Hinblick auf die Integration des Gesundheitsmanagements
- 6.1 Die Saarbrücker Formel - Ein multidimensionaler Ansatz zur Messung von Humankapital
- 6.2 Zur Messung von Gesundheit – Für ein Reporting geeignete Indikatoren auf Unternehmensebene
- 6.2.1 Das Indikatoren-Konzept im Gesundheitsmanagement
- 6.2.2 Die Gesundheitsquote
- 6.2.3 Der Work Ability Index
- 6.3 Die Erweiterung der Saarbrücker Formel auf die Bewertung von Gesundheit
- 7. Diskussion
- 7.1 „Humankapital messen und bewerten: Sisyphusarbeit oder Gebot der Stunde?"
- 7.2 Humankapital und Gesundheit
- 7.3 Die Auswahl der Indikatoren für das Gesundheits-Reporting
- 7.3.1 Die Gesundheitsquote
- 7.3.2 Der Work Ability Index: Von der Anwesenheit zur Arbeitsfähigkeit
- 7.4 Die Anwendbarkeit der Saarbrücker Formel
- 7.5 Wie kann die praktische Umsetzung im Unternehmen aussehen?
- 8. Erkenntnisse aus der Arbeit
- 8.1 Zusammenfassung
- 8.2 Handlungsempfehlungen für Unternehmen und weitere Forschungsansätze
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Bewertung und Steuerung von Humankapital unter besonderer Berücksichtigung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ziel ist es, die Integration von Gesundheitsaspekten in die Saarbrücker Formel, ein multidimensionales Modell zur Messung von Humankapital, zu diskutieren. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Gesundheit als Humankapital und untersucht die wesentlichen Treiber von Gesundheit im Unternehmenskontext.
- Bewertung und Steuerung von Humankapital
- Integration von Gesundheitsaspekten in die Saarbrücker Formel
- Bedeutung von Gesundheit als Humankapital
- Treiber von Gesundheit im Unternehmenskontext
- Anwendbarkeit von Indikatoren zur Messung von Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und klassifiziert immaterielle Vermögenswerte, wobei Humankapital als ein wichtiger Bestandteil hervorgehoben wird. Die Problemstellung wird dargelegt und die methodische Vorgehensweise erläutert. Anschließend werden moderne Gesundheitsansätze, wie das Gesundheitsbild der WHO, die Salutogenese und der Gesundheitsbegriff aus der Gesundheitsökonomik, vorgestellt. Die Grundlagen der Betrieblichen Gesundheitsförderung werden beleuchtet und die Bedeutung von Gesundheit im Unternehmen, insbesondere als Humankapital, wird betont. Die wesentlichen Treiber von Gesundheit werden analysiert und die Übertragung dieser Treiber auf Humankapital wird untersucht.
Im sechsten Kapitel werden Ansätze zur Bewertung von Humankapital im Hinblick auf die Integration des Gesundheitsmanagements vorgestellt. Die Saarbrücker Formel wird als multidimensionaler Ansatz zur Messung von Humankapital erläutert und die Messung von Gesundheit mit geeigneten Indikatoren auf Unternehmensebene wird diskutiert. Die Erweiterung der Saarbrücker Formel auf die Bewertung von Gesundheit wird detailliert dargestellt.
Das siebte Kapitel widmet sich der Diskussion der Ergebnisse. Es werden die Herausforderungen bei der Messung und Bewertung von Humankapital sowie die Bedeutung von Humankapital und Gesundheit beleuchtet. Die Auswahl der Indikatoren für das Gesundheits-Reporting, insbesondere die Gesundheitsquote und der Work Ability Index, wird kritisch betrachtet. Die Anwendbarkeit der Saarbrücker Formel wird diskutiert und es werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Unternehmen vorgestellt.
Im achten Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Arbeit zusammengefasst und Handlungsempfehlungen für Unternehmen sowie weitere Forschungsansätze gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Humankapital, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Saarbrücker Formel, Gesundheitsquote, Work Ability Index, Indikatoren, Bewertung, Steuerung, Gesundheit, Unternehmen, Mitarbeiter, Arbeitsfähigkeit, Prävention, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Humankapital und Gesundheit zusammen?
Gesundheit wird als wesentlicher Bestandteil des Humankapitals identifiziert, da die Leistungsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter den Wert des Unternehmens direkt beeinflussen.
Was ist die „Saarbrücker Formel“?
Die Saarbrücker Formel ist ein multidimensionales Modell zur monetären Bewertung von Humankapital, das verschiedene Werttreiber in einer Kennzahl zusammenfasst.
Welche Rolle spielt das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)?
BGM dient der Steuerung und Erhaltung der Gesundheit. Durch die Integration von BGM-Kennzahlen in das HR-Reporting kann der ökonomische Nutzen von Gesundheit messbar gemacht werden.
Was ist der „Work Ability Index“ (WAI)?
Der WAI ist ein Indikator zur Messung der Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters unter Berücksichtigung von Gesundheit, Kompetenz und Arbeitsbedingungen.
Wie kann Gesundheit auf Unternehmensebene gesteuert werden?
Durch ein integriertes Reporting mit Kennzahlen wie der Gesundheitsquote und dem WAI können Unternehmen gezielt Präventionsmaßnahmen planen und deren Erfolg bewerten.
- Quote paper
- Dr. Susanne Wagner (Author), 2014, Bewertung und Steuerung von Humankapital unter besonderer Berücksichtigung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289213