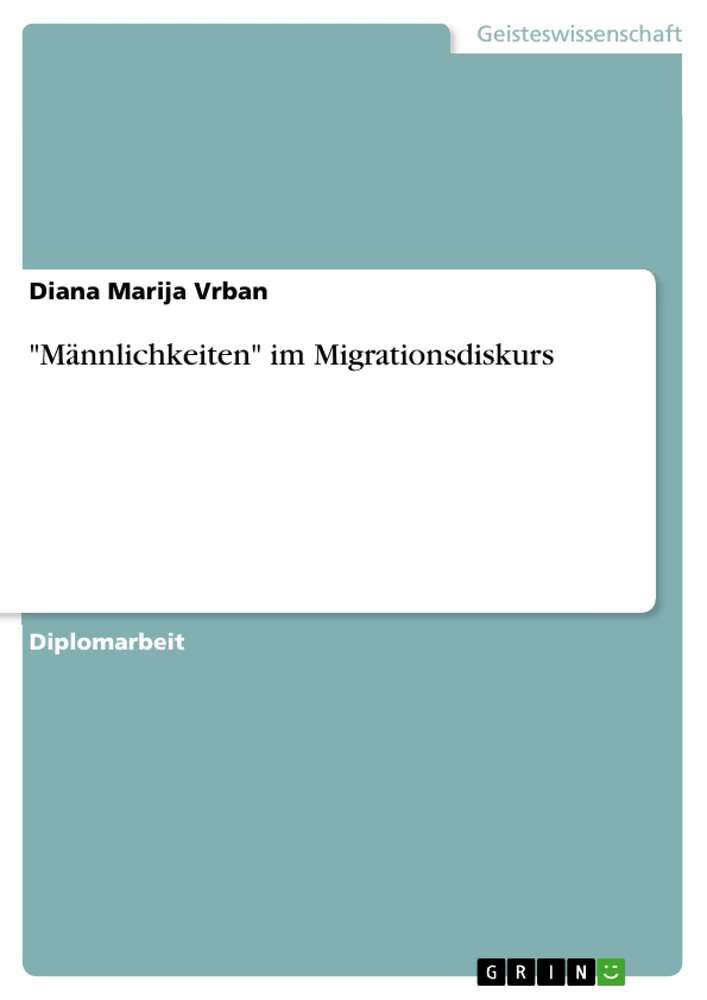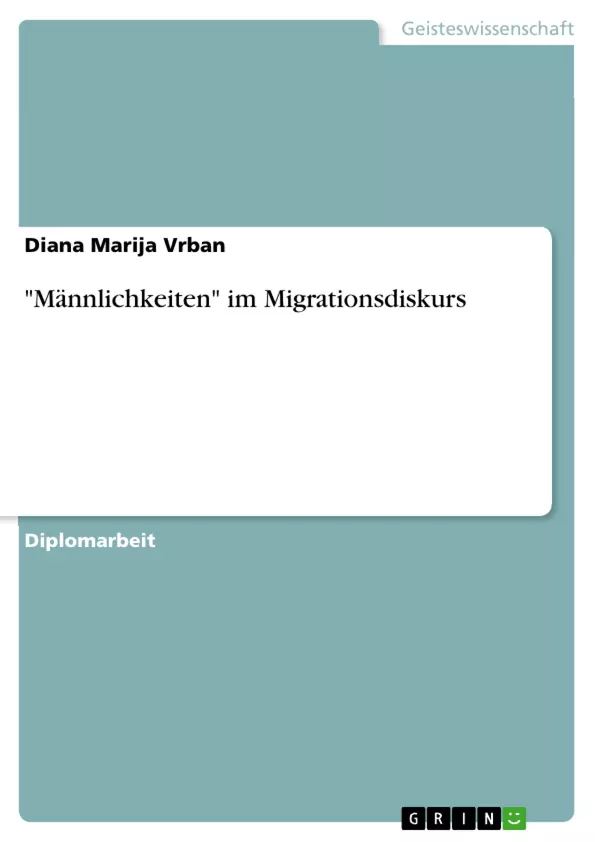Dass es ausgerechnet die „Männlichkeit“ sein soll, die Schuld daran trägt, dass allochthone Jugendliche sich kriminell und gewalttätig verhalten, ist gegenwärtig der sich wiederholende Diskurs, welchen die Medien hervorbringen. Ganz gleich, in welcher Zeitung wir gerade lesen oder welches Fernsehprogramm wir wählen, die Bilder sind immer einheitlich präsent: „Männlichkeit“ und Kriminalität scheinen wie ein unsichtbares Band miteinander verbunden zu sein. Polizeiliche Kriminalstatistiken weisen in ihren jährlichen Veröffentlichungen darauf hin, dass es hauptsächlich Männer bzw. männliche Jugendliche sind, die an Gewaltdelikten als Täter oder Opfer beteiligt sind. (vgl. Möller, 2010) In diesem Zusammenhang wird männlich „mit Junge gleichgesetzt und Gewalt gleich männlich als gegeben vorausgesetzt“. (vgl. Messerschmidt 1993, 1) Eine scharfe Kehrtwende erfährt diese Debatte jedoch, wenn die Kriminalität von jungen männlichen Migranten in den öffentlichen Medien thematisiert wird. Unter dem Schlagwort „Ausländer-Kriminalität“ setzt nun dort eine Debatte ein, wo es eben noch um Kriminalität im Zusammenhang mit „Männlichkeit“ ging. Diese Debatte sieht die „andere“ Ethnizität bzw. Kultur als Begründung für das kriminelle Treiben der jeweiligen Gruppe. Ein Ethnisierungs- bzw. Kulturalisierungsprozess des Problems der Kriminalität von männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden hält somit Einzug in die Thematik. Er schafft eine Kluft zwischen den autochthonen männlichen kriminellen Jugendlichen versus jenen der allochthonen Gruppe. Die Legitimation, den Diskurs hinsichtlich der Kriminalität allochthoner Jugendlichen auch so führen zu dürfen, findet sich u. a. in der Kulturdifferenzhypothese. Diese beschreibt hegemoniale Kulturen im Herkunfts- und Einwanderungsland als grundsätzlich unterschiedlich und von daher grundlegend fremdartig in ihren Bedeutungs- und Deutungssystemen. Folgt man dieser Hypothese in ihrem Ansatz, so ist es die Aufgabe des Migranten bzw. der Migrantin, eine kulturelle Diskrepanz persönlich zu bewältigen. (vgl. Munsch / Gmende / Weber-Unger 2007) Eine Studie nach Pfeiffer und Wetzels aus dem Jahre 2000, welche sich der Frage der allgemeinen Gewaltbereitschaft muslimischer Jugendlicher widmete und den Titel „Junge Türken als Täter und Opfer von Gewalt“ trägt, bediente sich in ihrer Klärung dieses Phänomens der o.g. Kulturdifferenzhypothese und sah diese aufgrund ihrer Forschungsergebnisse wie folgt bestätigt: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das „Geschlecht" im Wandel der Postmoderne
- ,,doing gender" - von der sozialen Konstruktion des Geschlechts
- Entwicklung und aktueller Stand der Männerforschung
- Zu den Theorien deutscher Männerforschung im Detail
- Die „hegemoniale Männlichkeit“ nach R. Connell
- Die „,männliche Herrschaft“ und das „Spielen der Spiele" nach Bourdieu
- Zusammenfassung der Theorien nach Connell und Bourdieu
- „Männlichkeit“ aus intersektionaler Perspektive
- ,,doing ethnicity" - von der soziale Konstruktion der „Ethnizität“
- Der Prozess des „doing ethnicity" aus historischer Sicht
- Die „rassisierten Regime der Repräsentationen“ nach Hall
- Die Symbolik „des bösen schwarzen Mannes“ - Der Fall Oury Jalloh
- Methodische Vorbemerkungen zur Dokumentenanalyse
- Die öffentlich mediale Repräsentation männlichen/weiblichen Geschlechts im Migrationsdiskurs
- ,,Männlichkeit“ im Migrationsdiskurs – eine kritische Gegendarstellung
- Lebensbiografie Abdul und Analyse anhand aufgezeigter Theorien
- Lebensbiografie Iwan und Analyse anhand aufgezeigter Theorien
- Abdul und Iwan - zwei Fallbeispiele fernab vom „rassisierten Regime der Repräsentationen“
- Ausblick
- Literatur- und Quellverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Konstruktion von „Männlichkeit“ im Migrationsdiskurs und analysiert, wie diese im Kontext von „doing gender“ und „doing ethnicity“ konstruiert wird. Die Arbeit untersucht, wie die mediale Repräsentation von männlichen Migranten zu stereotypen Bildern führt und welche Folgen diese für die Integration und das Selbstverständnis der Betroffenen haben.
- Die Konstruktion von „Männlichkeit“ im Kontext von „doing gender“ und „doing ethnicity“
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Stereotypen über männliche Migranten
- Die Folgen von Stereotypen für die Integration und das Selbstverständnis von männlichen Migranten
- Die Bedeutung von Lebensbiografien für die Analyse von „Männlichkeit“ im Migrationsdiskurs
- Die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Migrationsdiskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der „Männlichkeit“ im Migrationsdiskurs ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Sie beleuchtet die gängigen Stereotype über männliche Migranten und die damit verbundenen Probleme.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Konstruktion von „Geschlecht“ im Wandel der Postmoderne. Es werden die Theorien von „doing gender“ und die Entwicklung der Männerforschung vorgestellt. Die Arbeit analysiert die Theorien von R. Connell und P. Bourdieu, die die „hegemoniale Männlichkeit“ und die „männliche Herrschaft“ beleuchten.
Das zweite Kapitel widmet sich der Konstruktion von „Ethnizität“ und dem Prozess des „doing ethnicity“. Es werden die „rassisierten Regime der Repräsentationen“ nach Hall und die Symbolik „des bösen schwarzen Mannes“ im Fall Oury Jalloh analysiert. Das Kapitel beleuchtet die methodischen Vorbemerkungen zur Dokumentenanalyse und die öffentlich mediale Repräsentation von männlichen und weiblichen Geschlechts im Migrationsdiskurs.
Das dritte Kapitel präsentiert zwei Fallbeispiele von männlichen Migranten, Abdul und Iwan, und analysiert ihre Lebensbiografien anhand der im ersten und zweiten Kapitel vorgestellten Theorien. Die Arbeit zeigt, wie die Lebensrealitäten von männlichen Migranten von den gängigen Stereotypen abweichen und wie sie ihre „Männlichkeit“ in einem multikulturellen Kontext konstruieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Konstruktion von „Männlichkeit“ im Migrationsdiskurs, „doing gender“, „doing ethnicity“, Stereotype, mediale Repräsentation, Lebensbiografien, Integration, Selbstverständnis, Kulturdifferenzhypothese, Rassismus, Kriminalität, Gewalt, patriarchale Strukturen, intersektionalität, und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Migrationsdiskurs.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Männlichkeit im Migrationsdiskurs dargestellt?
Medien verknüpfen Männlichkeit bei Migranten oft einseitig mit Gewalt und Kriminalität, was zu einem Prozess der Ethnisierung sozialer Probleme führt.
Was versteht man unter „Doing Gender“ und „Doing Ethnicity“?
Diese Konzepte beschreiben, dass Geschlecht und Ethnizität keine festen biologischen Tatsachen sind, sondern durch alltägliches Handeln und gesellschaftliche Zuschreibungen ständig neu konstruiert werden.
Was besagt die Kulturdifferenzhypothese?
Sie geht davon aus, dass Kulturen grundlegend verschieden und fremdartig sind. Kritiker werfen ihr vor, Probleme zu „kulturalisieren“, anstatt soziale oder ökonomische Ursachen zu sehen.
Was ist „hegemoniale Männlichkeit“ nach Raewyn Connell?
Es beschreibt ein dominantes Muster von Männlichkeit, das die Überordnung von Männern über Frauen sowie über andere Formen von Männlichkeit kulturell absichert.
Warum sind Lebensbiografien in dieser Forschung wichtig?
Anhand individueller Lebensläufe (z.B. von Abdul und Iwan) zeigt die Arbeit, dass die Realität von Migranten weit von den medialen Stereotypen des „bösen schwarzen Mannes“ abweicht.
- Quote paper
- Diana Marija Vrban (Author), 2011, "Männlichkeiten" im Migrationsdiskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289242