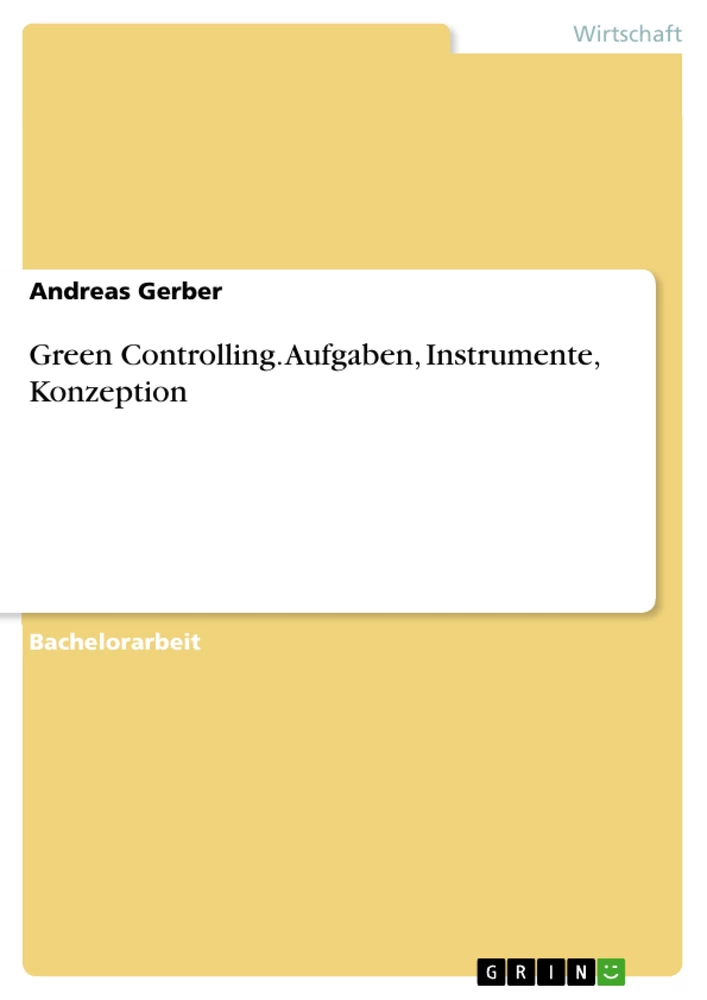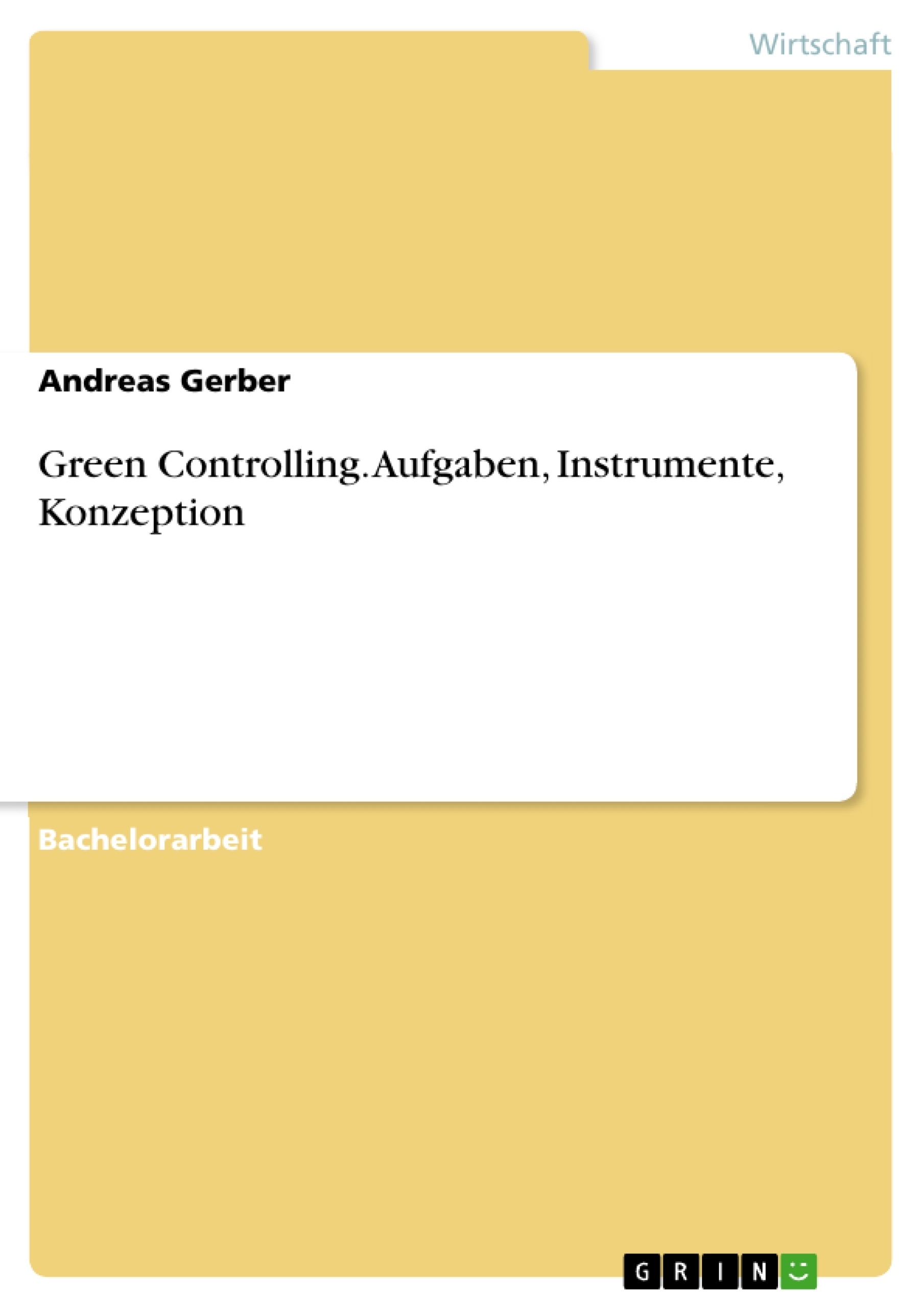Unsere Umwelt ist in vielerlei Hinsicht gefährdet: Treibhauseffekt, Ozonlöcher, saurer Regen, Pestizide sowie eine Verknappung von nicht-regenerativen Rohstoffen und die begrenzte Emissionsaufnahmekapazität von Luft, Wasser und Boden. Diese Beispiele deuten nur einen kleinen Teil der Umweltverschmutzung durch unsere Gesellschaft an. Vor allem Unternehmen tragen wesentlich zur Belastung unserer Umwelt bei indem sie sorglos mit Ressourcen und Energien umgehen und dabei oftmals nicht umweltschonend agieren.
Das veränderte Umweltbewusstsein der Kunden und Konsumenten, Lieferanten als auch Konkurrenten zwingt Unternehmen jedoch in gewissermaßen zu einer Ökologieorientierung und damit zu einer Veränderung der bisherigen Unternehmenssituation und -ausrichtung. Außerdem werden die von den Ländern und Staaten verabschiedeten Umweltgesetzgebungen von Jahr zu Jahr verschärft, was die Unternehmen zusätzlich in einem rechtlichen Aspekt unter Druck setzt.
Somit müssen sich Unternehmen neben der reinen ökonomischen Sichtweise nun auch ökologischer Fragestellungen annehmen um einen langfristigen Unternehmenserfolg zu gewährleisten. Die Berücksichtigung solcher ökologischer Aspekte in der Zielsetzung von Unternehmen hat zur Folge, dass sich ebenso das Controlling einer Wandlung unterziehen muss. So gewinnen im Rahmen des traditionellen Controlling auch umweltrelevante Informationen an Bedeutung. Da das traditionelle Controlling mit dem Umgang solcher Informationen nicht vertraut ist, ergibt sich somit die Notwendigkeit einer Erweiterung des Controlling um ökologische Komponenten. Eine solche Erweiterung des Controlling wird in dieser Bachelorarbeit behandelt. Folgend wird das Konzept des "Green Controlling" detailliert dargestellt. Dabei werden ausgehend von der Entstehung, die zu erfüllenden Aufgaben erläutert und nachfolgend eine Auswahl an Instrumenten zur ökologischen Beurteilung des Unternehmens aufgeführt. Zudem wird eine mögliche Integration des Green Controlling in die Unternehmensstruktur beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen
- Green / Greening
- Nachhaltigkeit
- Die Dimensionen der Nachhaltigkeit
- Nachhaltigkeit in Unternehmen
- Green Controlling
- Aufgaben und Funktionen des Green Controlling
- Instrumente des Green Controlling
- Die Stoff- und Energiebilanz als Informationsgrundlage
- Bewertung und Maßnahmenplanung
- Die Methode der ökologischen Knappheit
- Die Methode der Qualitätsziel-Relationen
- Die Eco-rational Path-Method (EPM)
- ABC-Methode
- Umweltkostenrechnung
- Umweltschutzkostenberechnung
- Flusskostenrechnung
- Erfolgskontrolle durch Kennzahlen
- Nutzen des Green Controlling
- Integration des Green Controlling in das Unternehmen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Konzept des Green Controlling. Ziel ist es, die Aufgaben, Instrumente und die Integration des Green Controlling in die Unternehmensstruktur zu beleuchten. Die Arbeit soll einen umfassenden Überblick über das Green Controlling als Instrument der nachhaltigen Unternehmensführung bieten.
- Die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Green Controlling für Unternehmen
- Die Aufgaben und Funktionen des Green Controlling
- Die wichtigsten Instrumente des Green Controlling, wie z.B. Stoff- und Energiebilanz, Umweltkostenrechnung und Kennzahlen
- Die Integration des Green Controlling in die Unternehmensstruktur
- Der Nutzen des Green Controlling für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Green Controlling ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der Umweltbelastung durch Unternehmen. Es werden die Herausforderungen für Unternehmen im Hinblick auf die Einhaltung von Umweltstandards und die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext beleuchtet.
Das Kapitel "Grundlagen" behandelt die Begriffe Green / Greening und Nachhaltigkeit. Es werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit in Unternehmen erläutert.
Das Kapitel "Green Controlling" befasst sich mit den Aufgaben und Funktionen des Green Controlling. Es werden die wichtigsten Instrumente des Green Controlling, wie z.B. die Stoff- und Energiebilanz, die Umweltkostenrechnung und Kennzahlen, vorgestellt.
Das Kapitel "Nutzen des Green Controlling" beleuchtet die Vorteile des Green Controlling für Unternehmen. Es werden die positiven Auswirkungen auf die Umweltbilanz, die Wettbewerbsfähigkeit und die Reputation des Unternehmens dargestellt.
Das Kapitel "Integration des Green Controlling in das Unternehmen" behandelt die Einbindung des Green Controlling in die Unternehmensstruktur. Es werden verschiedene Ansätze zur Integration des Green Controlling in die bestehenden Prozesse und Strukturen des Unternehmens vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Green Controlling, Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, Stoff- und Energiebilanz, Umweltkostenrechnung, Kennzahlen, Unternehmensführung, Integration, Ökologie, Ökonomie, Umweltschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Green Controlling?
Green Controlling ist eine Erweiterung des traditionellen Controllings um ökologische Komponenten, um den langfristigen Unternehmenserfolg durch nachhaltige Führung zu sichern.
Welche Aufgaben hat das Green Controlling?
Zu den Hauptaufgaben gehören die Bereitstellung umweltrelevanter Informationen, die ökologische Beurteilung von Unternehmensprozessen und die Unterstützung bei der Einhaltung von Umweltgesetzgebungen.
Welche Instrumente werden im Green Controlling eingesetzt?
Wichtige Instrumente sind Stoff- und Energiebilanzen, Umweltkostenrechnungen (z.B. Flusskostenrechnung), die ABC-Analyse unter ökologischen Aspekten und spezielle Kennzahlensysteme.
Was ist die „Methode der ökologischen Knappheit“?
Es ist eine Bewertungsmethode im Green Controlling, die Umweltbelastungen basierend auf der Differenz zwischen aktuellen Emissionswerten und politisch gesetzten Umweltzielen gewichtet.
Welchen Nutzen bietet Green Controlling für Unternehmen?
Neben der Verbesserung der Umweltbilanz steigert es die Wettbewerbsfähigkeit, verbessert die Reputation und hilft, rechtliche Risiken durch verschärfte Umweltgesetze zu minimieren.
Wie wird Green Controlling in die Unternehmensstruktur integriert?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ansätze zur Einbindung ökologischer Ziele in bestehende Controlling-Prozesse und die Anpassung der Berichterstattung.
- Quote paper
- Andreas Gerber (Author), 2014, Green Controlling. Aufgaben, Instrumente, Konzeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289294