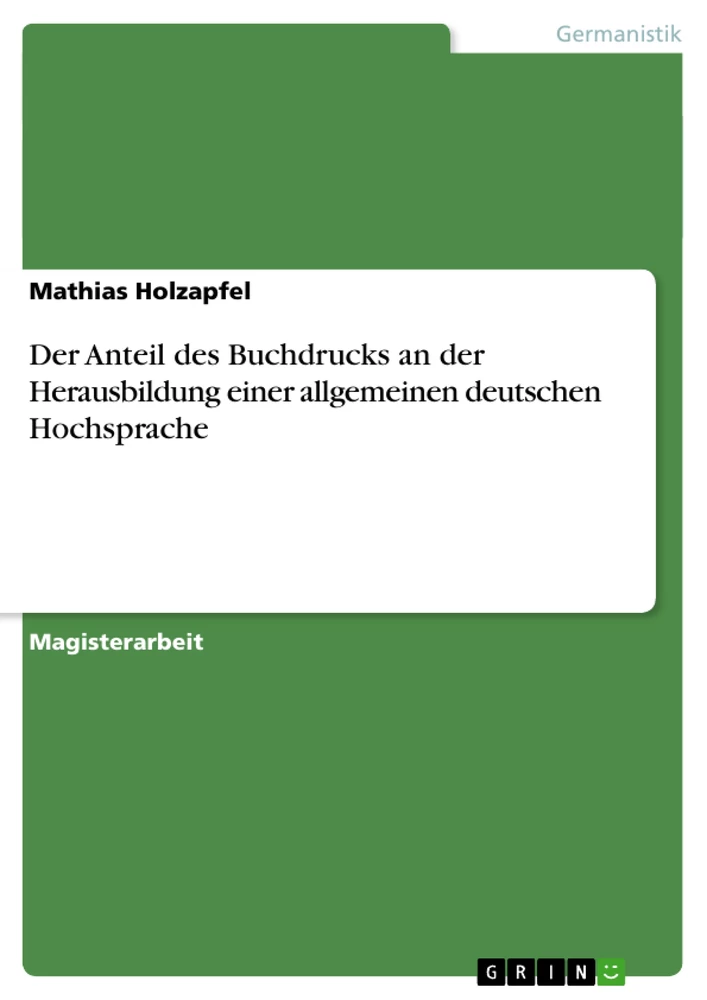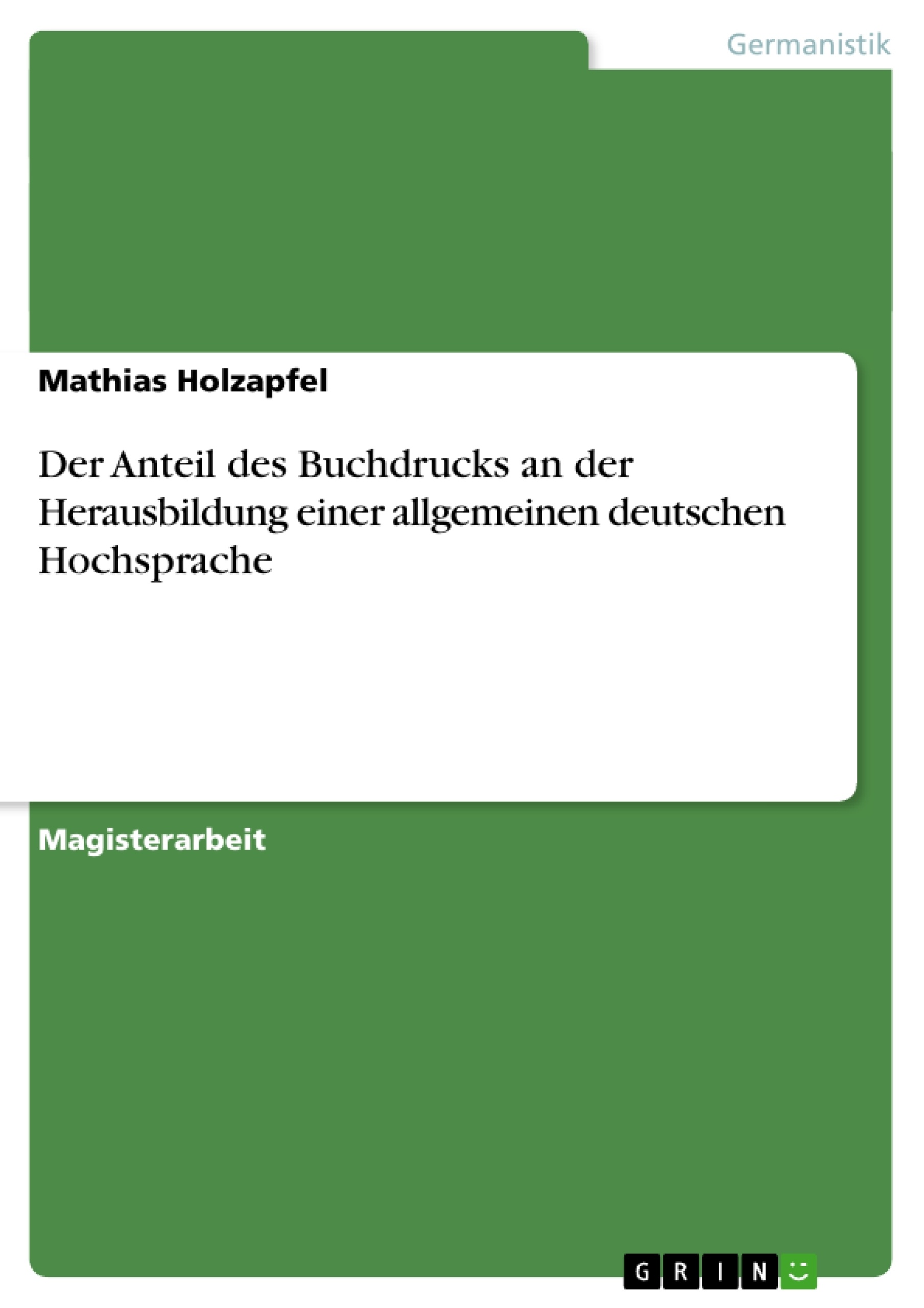[...] Im folgenden soll nun versucht werden, einer allzu großen Marginalisierung des Buchdrucks im Hinblick auf seinen Einfluß bei der Herausbildung einer allgemeinen deutschen Hochsprache entgegenzuwirken. Diese Arbeit soll sich dabei an der These orientieren, daß technische Erfindungen und ökonomisches Kalkül durchaus kulturellen Fortschritt hervorbringen können und nicht notwendigerweise im Gegensatz zu diesem stehen. Dabei wird der Blick sowohl auf die Vertriebskanäle – diesem Punkt schenken viele Forschungsbeiträge eine besondere Aufmerksamkeit –, als auch auf den Prozeß der Buchherstellung und im besonderen auf die Arbeit des Setzers zu richten sein. Ab dem nächsten Kapitel ist also zunächst zu untersuchen, welchen ökonomischen Druck die Buchdrucker und Verleger schon in der Inkunabelzeit zu spüren bekamen; denn auf diesen Zeitraum soll sich die vorliegende Untersuchung beschränken. Dabei wird zuallererst versucht, die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und das damit verbundene Schicksal Gutenbergs zu rekapitulieren, wodurch zugleich ein Einblick in die Arbeitsabläufe einer Druckerei jener Zeit ermöglicht werden soll. Daran anschließend müssen zentrale Fragen zur weiteren Entwicklung dieser vor allem technischen Innovation beantwortet werden. In diesem Zusammenhang gilt es beispielsweise zu klären, was für eine Auflagenhöhe erreicht und welche Bücher die Offizinen in dem hier anvisierten Zeitabschnitt überhaupt gedruckt haben. Mit den dann vorliegenden Ergebnissen soll schließlich auf die oben bereits angedeutete Diskussion näher eingegangen und gezeigt werden, daß der Buchdruck durchaus als Förderer schriftsprachlicher Vereinheitlichungstendenzen betrachtet werden muß. Um »durch den Buchdruck eingeleitete Veränderungen richtig einschätzen zu können, müssen wir uns [auch] über die Umstände klar werden, die herrschten, bevor er in Erscheinung trat«. An einigen Stellen wird es deshalb notwendig sein, auch Bezüge zur Zeit vor der Produktion des ersten gedruckten Buches herzustellen. Michael Gieseckes Untersuchung Der Buchdruck in der frühen Neuzeit ist nicht zuletzt auch deswegen kritisiert worden, weil sie zu wenig die Umstände vor der Erscheinung des Buchdrucks berücksichtigt: »This representation is an unbalanced one, considering it too much in the light of what is happening five centuries later and not enough in connection with what it replaced.«
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Johannes Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks
- 2.1 Mythos Gutenberg
- 2.2 Das Werk der Bücher
- 2.3 Gutenbergs Motiv
- 2.4 Gutenbergs Schicksal
- 3. Die Buchproduktion im Inkunabelzeitalter
- 3.1 Die Ausbreitung der Buchdruckerkunst
- 3.2 Was wurde gedruckt?
- 3.3 Das Problem der exemplaria
- 4. Buchdruck und Sprache
- 4.1 Absatzsteigerung und Sprachausgleich
- 4.2 Orthotypographia
- 5. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Buchdrucks auf die Herausbildung einer einheitlichen deutschen Hochsprache. Sie beleuchtet die Entwicklung des Buchdrucks, seine Verbreitung und die damit verbundenen sprachlichen Auswirkungen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Wechselwirkungen zwischen technologischem Fortschritt und sprachlicher Standardisierung.
- Die Rolle Johannes Gutenbergs und die Erfindung des Buchdrucks
- Die Ausbreitung des Buchdrucks und die Buchproduktion im Inkunabelzeitalter
- Der Einfluss des Buchdrucks auf die Vereinheitlichung der deutschen Sprache
- Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Faktoren und sprachlicher Standardisierung
- Die Bedeutung von Orthotypographie für die Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach dem Einfluss des Buchdrucks auf die Herausbildung einer einheitlichen deutschen Hochsprache in den Mittelpunkt. Sie verweist auf die gegensätzlichen Einschätzungen der Bedeutung des Buchdrucks in diesem Zusammenhang und kündigt die Forschungsfrage der Arbeit an. Die Einleitung betont die weitreichenden Auswirkungen der Erfindung Gutenbergs und führt verschiedene Perspektiven auf die Bedeutung des Buchdrucks ein, um den Forschungsstand darzulegen und den Kontext der Arbeit zu definieren.
2. Johannes Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks: Dieses Kapitel behandelt die Person Johannes Gutenbergs und seine Erfindung des Buchdrucks. Es beleuchtet den Mythos um Gutenberg, seine Arbeit und Motivation sowie sein Schicksal. Der Fokus liegt auf der technischen Innovation des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und seinen unmittelbaren Auswirkungen auf die Verbreitung von Wissen und Texten. Der Abschnitt analysiert die technischen und wirtschaftlichen Aspekte von Gutenbergs Erfindung und deren Bedeutung für die spätere Entwicklung.
3. Die Buchproduktion im Inkunabelzeitalter: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung der Buchdruckerkunst im Inkunabelzeitalter, den gedruckten Inhalten und den Herausforderungen bei der Produktion. Es analysiert die räumliche und zeitliche Ausbreitung des Buchdrucks sowie die Art der produzierten Texte. Besonderes Augenmerk wird auf das Problem der "exemplaria" gelegt, und die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Textreproduktionen werden erörtert. Die Kapitel untersuchen die technologischen und ökonomischen Aspekte der frühen Buchproduktion und deren Einfluss auf die Verbreitung von Wissen und Ideen.
4. Buchdruck und Sprache: Dieses Kapitel untersucht den direkten Einfluss des Buchdrucks auf die Entwicklung der deutschen Sprache. Es analysiert die Absatzsteigerung und den damit verbundenen Sprachausgleich als Folge der Verbreitung von gedruckten Texten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle der Orthotypographie für die Standardisierung der Schriftsprache. Der Abschnitt untersucht den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Interessen der Drucker und der Entwicklung einer einheitlichen Schriftsprache. Die Untersuchung der Orthotypographie beleuchtet den Prozess der Normierung und Standardisierung im Kontext der neuen Drucktechnologie.
Schlüsselwörter
Buchdruck, Johannes Gutenberg, Hochsprache, Sprachgeschichte, Inkunabeln, Orthotypographie, Sprachausgleich, Mobilletterndruck, ökonomische Faktoren, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Der Einfluss des Buchdrucks auf die Herausbildung der deutschen Hochsprache
Was ist der zentrale Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Einfluss der Erfindung des Buchdrucks auf die Entwicklung einer einheitlichen deutschen Hochsprache. Er beleuchtet die Zusammenhänge zwischen technologischem Fortschritt (Buchdruck) und sprachlicher Standardisierung.
Welche Aspekte des Buchdrucks werden behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Aspekte des Buchdrucks, darunter die Erfindung durch Johannes Gutenberg (inklusive des Mythos um seine Person und seine Motivationen), die Ausbreitung der Buchdruckerkunst im Inkunabelzeitalter (die Produktionsbedingungen und die Art der gedruckten Texte), sowie die technischen und wirtschaftlichen Aspekte der Buchproduktion.
Welche Rolle spielt Johannes Gutenberg im Text?
Johannes Gutenberg wird als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern dargestellt. Der Text beleuchtet den Mythos um Gutenberg, seine Arbeit, seine Motivationen und sein letztliches Schicksal. Seine Erfindung wird als technologische Innovation mit weitreichenden Folgen für die Verbreitung von Wissen und Texten betrachtet.
Was ist das Inkunabelzeitalter und welche Bedeutung hat es im Text?
Das Inkunabelzeitalter bezeichnet die frühe Phase des Buchdrucks (etwa 1450-1500). Im Text wird dieses Zeitalter untersucht, um die Ausbreitung des Buchdrucks, die Art der produzierten Texte und die Herausforderungen der frühen Buchproduktion zu analysieren. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Problem der "exemplaria" (der Textreproduktionen) gewidmet.
Wie beeinflusste der Buchdruck die deutsche Sprache?
Der Text argumentiert, dass der Buchdruck einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Hochsprache hatte. Die Absatzsteigerung durch den Buchdruck führte zu einem Sprachausgleich, und die Orthotypographie spielte eine wichtige Rolle bei der Standardisierung der Schriftsprache. Der Text untersucht auch den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Interessen der Drucker und der Entwicklung einer einheitlichen Schriftsprache.
Welche Rolle spielt die Orthotypographie?
Die Orthotypographie, die Gestaltung des gedruckten Textes, wird im Text als wichtiger Faktor für die Sprachstandardisierung gesehen. Sie trug zur Normierung und Vereinheitlichung der Schriftsprache bei.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (Einführung in die Forschungsfrage), 2. Johannes Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks (Gutenbergs Rolle und die technischen Aspekte), 3. Die Buchproduktion im Inkunabelzeitalter (Ausbreitung und Herausforderungen des Buchdrucks), 4. Buchdruck und Sprache (Einfluss auf die Sprachentwicklung und Standardisierung), und 5. Schlussbetrachtung (Zusammenfassung und Schlussfolgerungen).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Buchdruck, Johannes Gutenberg, Hochsprache, Sprachgeschichte, Inkunabeln, Orthotypographie, Sprachausgleich, Mobilletterndruck, ökonomische Faktoren, Kulturgeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Zielsetzung des Textes ist die Untersuchung des Einflusses des Buchdrucks auf die Herausbildung einer einheitlichen deutschen Hochsprache. Der Fokus liegt auf den Wechselwirkungen zwischen technologischem Fortschritt und sprachlicher Standardisierung.
- Arbeit zitieren
- Mathias Holzapfel (Autor:in), 2004, Der Anteil des Buchdrucks an der Herausbildung einer allgemeinen deutschen Hochsprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29003