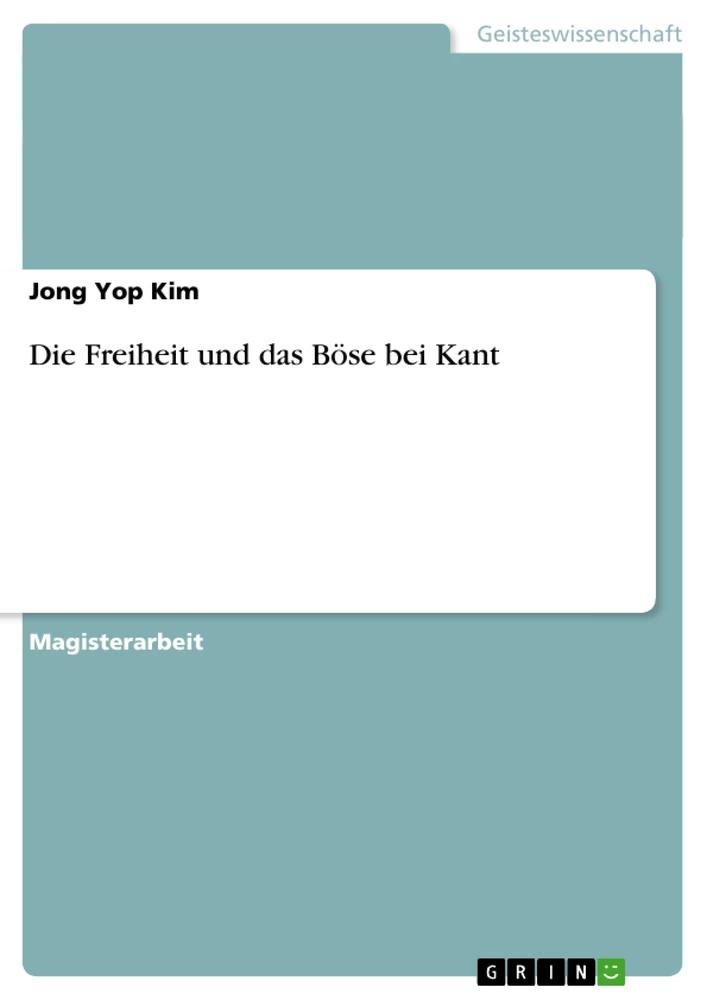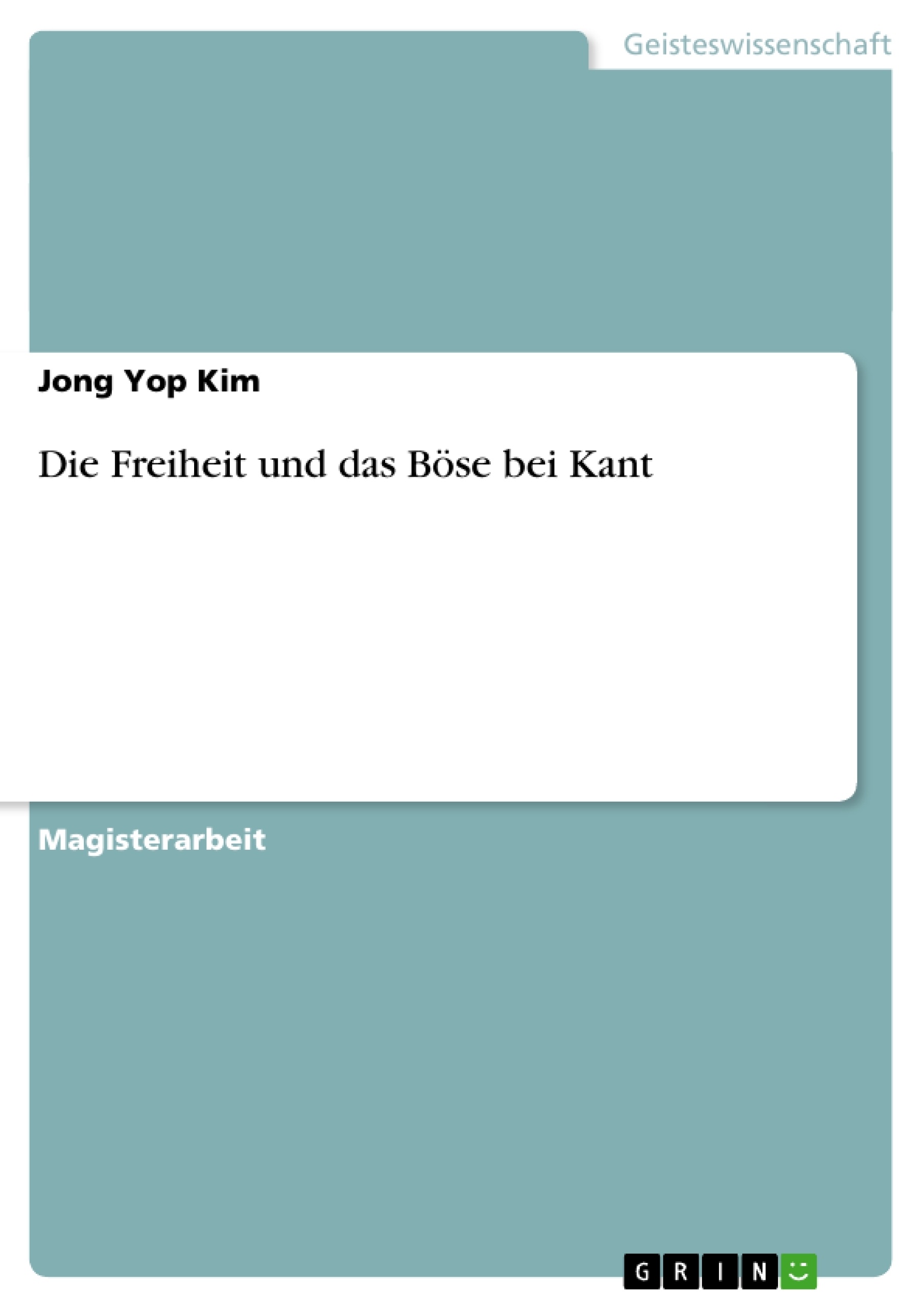Das Problem, mit dem ich mich hier beschäftigen will, ist in Kants Wesensbestimmung des Menschen als freies Wesens die Dissoziation aufzugreifen, denn das Freiheitsgeschehen impliziert für ihn nicht nur die Möglichkeit des Guten, sondern auch die des Bösen. Kant führt den Versuch der Auflösung dieser Aporie nicht in theoretischer Geschlossenheit seiner Freiheitslehre durch, sondern es bleibt ihm vielmehr unerforschlich, wie das Böse seine transzendentale Bedeutung in der Wesensbestimmung des Menschen gewinnen kann. Diese lockere Verbindung des Begriffs des Bösen mit dem System der Wissenschaft steht aber mit Kants religiös-anthropologischem Verständnis des Menschen selbst in Verbindung, wonach er die Grundbedingungen, in denen die menschliche Person sich jeweils befindet, nicht aus dem Blick verlieren und die menschliche Existenz im polaren Spannungsgefüge der seelischen Elemente erblicken möchte. Das Verhältnis der Freiheit zum Bösen ist darum eines jener Probleme, die in der Interpretation Kants heftige philosophische Kontroversen ausgelöst haben.
Der schon von Goethe im Brief an Herder vom 7.6.1793 erhobene Vorwur wird von A. Schweizer dadurch auf äußerste verschärft, indem er die Differenz betont, die für ihn zwischen der kritischen Ethik und der Religionsschrift Kants besteht. Der Vorwurf bezieht sich hauptsächlich auf den Gesichtspunkt, Kants wahren Verdienst darin zu erblicken, dass die Freiheit, als die natürliche Ausstattung des von Gott geschaffenen Menschen, für Kant ursprünglich nur die Freiheit zum Guten sei: Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die Auffassung, dass sich das radikal Böse in der menschlichen Natur mit der Freiheit nur schwer vereinbaren lasse. Wenn dem freien Willen das moralische Böse zugeschrieben werden kann, dann könne er nicht mit Autonomie gleichbedeutend sein, weil Autonomie Selbstbestimmung zur Moralität ist. Und Kants These über das moralische Böse widerspricht scheinbar seinem früheren Argument über das Verhältnis des freien Willens zur Sittlichkeit, zu dessen Klärung er in der GMS die "Identitätsthese" heranzieht: "Also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei." (GMS, IV 447) Diese scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen der Freiheit und dem Bösen veranlasst Kantinterpreten wie z.B. G. Prauss und C. Schulte dazu, sich intensiv mit den logischen Schwierigkeiten der Freiheitslehre Kants auseinanderzusetzen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. PROBLEMSTELLUNG
- II. DIE FREIHEIT UND DAS GUTE.
- 1. TRANSZENDENTALE FREIHEIT
- 1.1 Das Freiheitsproblem in der Antinomie und ihre Auflösung.
- 1.2 Die Monade
- 2. TRANSZENDENTALE FREIHEIT UND MORALPHILOSOPHIE.
- 2.1 Antithesis..
- 2.2 Thesis..
- 3. FREIHEIT UND SITTENGESETZ.
- 3.1 Das Verhältnis von Freiheit und Sittengesetz
- 3.2 Faktum der Vernunft.
- 4. ZUSAMMENFASSENDE THESE
- III. DIE FREIHEIT UND DAS BÖSE ...........
- 1. MAXIMEN
- 2. DIE NATUR DES MENSCHEN
- 1.1 Die Maxime als die Gesetzgebung der Vernunft .
- 1.2 Die Maxime als das Tätigsein der Willkür..
- 2.1. Die Anlage zum Guten ..
- 2.1.1 Das Interesse der Vernunft.
- 2.1.2 Das heteronome Handeln.
- 2.2 Der Hang zum Bösen.
- 3. PECCATUM ORIGINARIUM
- 3.1 Die Schwäche des menschlichen Herzens...
- 3.2 Die Unlauterkeit.
- 3.3 Das radikal Böse.
- 3.3.1 Die Grenze der praktischen Vernunft..
- 3.3.2 Die Verkehrtheit des Willens.
- 3.4 Die Würde des Menschen und das Böse
- 4. DER URSPRUNG DES BÖSEN.
- 4.1 Die Freiheit und das Böse
- 4.2 Das Selbstsein und das Böse
- 5. ZUSAMMENFASSENDE THESE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kants Philosophie der Freiheit und ihre Verbindung zum Problem des Bösen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das Böse, obwohl es nicht als ein transzendentes Prinzip in Kants System erscheint, eine zentrale Rolle im Verständnis der menschlichen Existenz und des moralischen Handelns spielt.
- Das Verhältnis von Freiheit und Sittengesetz bei Kant
- Die Natur des Menschen als frei handelndes Wesen
- Die Rolle des radikal Bösen in Kants Philosophie
- Der Ursprung des Bösen in der menschlichen Freiheit
- Die Unterscheidung zwischen Willen und Willkür
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit untersucht Kants Theorie der Freiheit und stellt die Dissoziation zwischen Freiheit und Böse heraus. Der Text beleuchtet Kants Versuche, diese Aporie aufzulösen und das Verhältnis von Freiheit zum Guten und Bösen zu verstehen.
Kapitel zwei analysiert die transzendentale Freiheit und ihre Beziehung zur Moralphilosophie. Es diskutiert Kants "Identitätsthese" und die scheinbare Diskrepanz zwischen der Freiheit und dem moralischen Bösen.
Kapitel drei befasst sich mit der Verbindung von Freiheit und Sittengesetz. Es beleuchtet die Rolle des Faktums der Vernunft und die Schwierigkeit, das moralische Böse mit der Autonomie des Willens zu vereinbaren.
Kapitel vier betrachtet die Maxime als Gesetzgebung der Vernunft und das Tätigsein der Willkür. Es analysiert die Anlage zum Guten und den Hang zum Bösen sowie das Konzept des Peccatum Originarium.
Kapitel fünf untersucht den Ursprung des Bösen in der menschlichen Freiheit und beleuchtet die Frage, ob das Selbstsein mit dem Bösen verbunden ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter, die in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen, umfassen: Transzendentale Freiheit, Sittengesetz, Autonomie, radikal Böse, Willkür, Peccatum Originarium, Vernunft, Anlage zum Guten, Hang zum Bösen, Selbstsein.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Freiheit und das Böse bei Kant zusammen?
Für Kant impliziert die Freiheit des Menschen nicht nur die Möglichkeit zum Guten, sondern notwendigerweise auch die Freiheit, sich für das Böse zu entscheiden.
Was versteht Kant unter dem „radikal Bösen“?
Es bezeichnet einen Hang in der menschlichen Natur, die moralischen Maximen der Selbstliebe über das Sittengesetz zu stellen, was die Wurzel allen bösen Handelns ist.
Was ist der Unterschied zwischen Wille und Willkür?
Der Wille ist die Quelle des moralischen Gesetzes, während die Willkür das Vermögen ist, nach Maximen zu handeln und sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden.
Was besagt Kants „Identitätsthese“?
Sie besagt ursprünglich, dass ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei sind. Das Problem des Bösen stellt diese These vor logische Schwierigkeiten.
Was ist das „Peccatum Originarium“?
Es bezieht sich auf den Ursprung des Bösen im Menschen, den Kant nicht zeitlich, sondern vernunftmäßig als eine Verkehrtheit des Herzens erklärt.
- Arbeit zitieren
- Jong Yop Kim (Autor:in), 2004, Die Freiheit und das Böse bei Kant, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29143