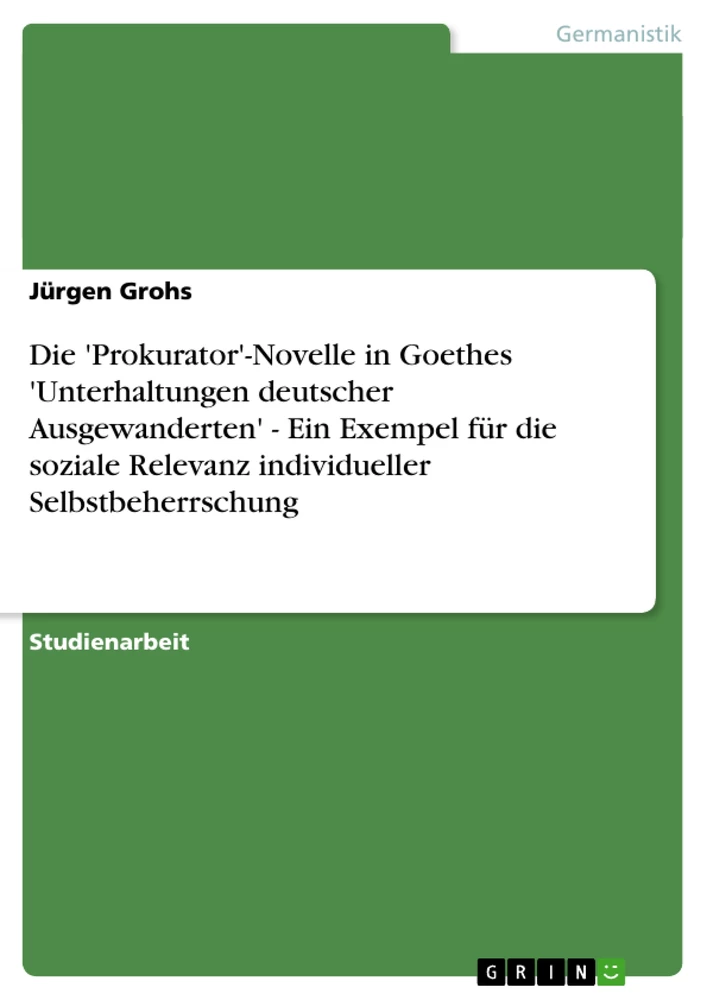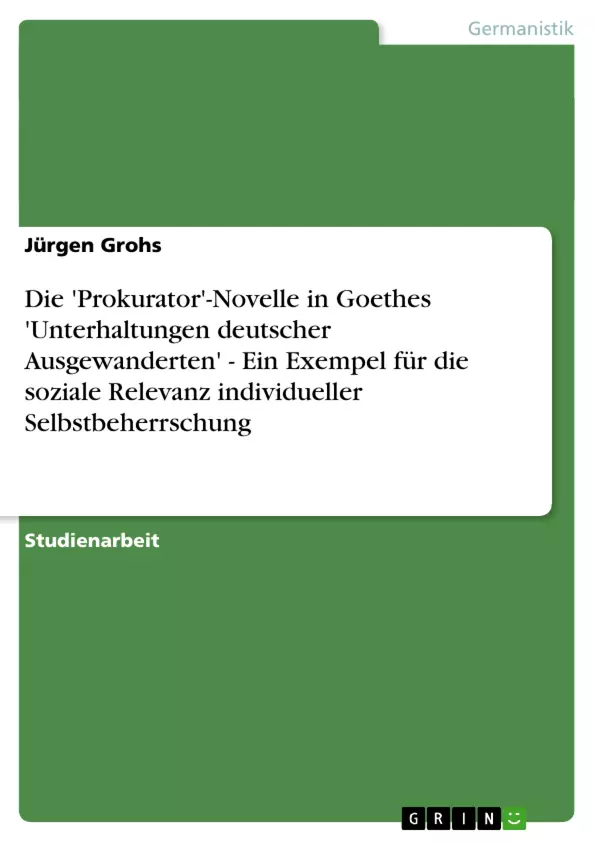1. 'DIE HOREN' - HISTORISCHE HINTERGRÜNDE & ZIELSETZUNG
Im Sommer 1794 begann Friedrich Schiller mit den Vorbereitungen zu einer Monatsschrift, die er zu Beginn des folgenden Jahres in Zusammenarbeit mit Johann Gottfried Fichte, Wilhelm von Humboldt und Karl Ludwig Woltmann herausgeben wollte. 'Die Horen' sollte der Titel lauten - nach den Töchtern des Zeus Eunomia, Dike und Irene; die Verkörperungen von gesetzlicher Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden. Dieser Name allein eröffnet schon den Blick auf die Hintergründe, die zur Entstehung dieses Unternehmens geführt hatten, und auf die programmatischen Forderungen, die den Mitarbeitern gestellt wurden:
im Mittelpunkt geisteswissenschaftlichen Interesses stand zu jener Zeit natürlich die Französische Revolution, die seit einigen Jahren die Welt in Atem hielt. Die kriegerische Außenpolitik des revolutionären Frankreich und seine innenpolitischen Exzesse der Gewalt und des Terrors, die 1793/94 einen traurigen Höhepunkt erreicht hatten, waren es, die das französische Volk und "mit ihm auch einen beträchtlichen Theil Europas, und ein ganzes Jahrhundert, in Barbarey und Knechtschaft zurückgeschleudert" hatten. Die Ambivalenz zwischen den großen revolutionären Grundideen und den verheerenden Auswirkungen des Versuchs ihrer Umsetzung in die Realität erregte die Gemüter und spaltete die Gesellschaft in zwei Lager.
Diese Situation der Zerrissenheit, die auch das deutsche Bildungsbürgertum erfaßt hatte, und der Wunsch nach Wiederherstellung der Einheit und des Friedens zwischen den zerstrittenen Parteien veranlaßte Schiller zur Gründung der 'Horen'. In ihnen sollte nichts zur Sprache kommen, "was sich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht" . Stattdessen sollte "die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit vereinigt werden; die Autoren sollten der schönen Welt zum Unterricht und zur Bildung und der gelehrten zu einer freien Forschung der Wahrheit und zu einem fruchtbaren Austausch der Idee beitragen" .
Doch eine solche bewußte Auslassung des Themas Nr.1 zu dieser Zeit war letztlich ja schon wieder eine Thematisierung. Zudem lief vieles, was vom politischen Interesse des Tages ablenken sollte, darauf zu - nur auf einer anderen Ebene. Schiller selbst konnte sich nicht an seine eigenen Auflagen halten: in seinen 'Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen' zielt er ab auf die Entwicklung zur meschlichen Freiheit des Einzelnen, sprich: auf die sittliche Selbsterziehung und
Inhaltsverzeichnis
- 1. 'Die Horen'- Historische Hintergründe & Zielsetzung
- 2. Goethes Mitarbeit und sein Verhältnis zur Französischen Revolution
- 3. Zur 'erzieherischen' Effektivität der Literatur
- 4. Darstellung der Revolutionsthematik in den 'Unterhaltungen'
- 4.1. Zunehmende Abstraktion der Thematik auf die psychologische Ebene
- 4.2. Die 'sittliche Entwicklung' des Menschen in den Novellen
- 5. Bedeutung der 'Prokurator'-Novelle für die 'Unterhaltungen'
- 5.1. Die Quelle und Goethes Leistung als Bearbeiter
- 5.2. Der 'Prokurator' als Ausgangspunkt der 'Unterhaltungen'
- 5.3. Die Zentrale Rolle des 'Prokurator' im Novellenzyklus
- 6. Darstellung der 'sittlichen Entwicklung' in der 'Prokurator'-Novelle
- 6.1. Konflikt und Konfliktlösungsprozeß
- 6.2. Unabhängigkeit 'sittlicher Entwicklung' von sozialem Status
- 6.3. Die individuelle Entwicklung als Modell für die gesellschaftliche
- 6.4. 'Sittliche Entwicklung' als repetitiver Prozeß
- 7. Betrachtung des 'Prokurator' nach psychoanalytischen Aspekten
- 7.1. Das 'Strukturmodell des psychischen Apparats' nach Freud
- 7.2. 'Es' & 'Über-Ich'; zur Charakterstruktur des Kaufmanns
- 7.3. Die Kaufmannsfrau: Personifikation der Triebseite
- 8. Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht Goethes Novelle "Der Prokurator" im Kontext der "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" und analysiert die Bedeutung individueller Selbstbeherrschung für die soziale Relevanz im Angesicht der Französischen Revolution. Die Arbeit beleuchtet Goethes Beteiligung an Schillers "Horen" und dessen Verhältnis zur Revolution.
- Goethes literarische Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution
- Die Rolle individueller Selbstbeherrschung in Goethes Novellen
- Die "erzieherische" Wirkung von Literatur im Kontext der Revolution
- Analyse der "Prokurator"-Novelle als Beispiel für die behandelten Themen
- Psychoanalytische Betrachtung der Charaktere in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. 'DIE HOREN' - HISTORISCHE HINTERGRÜNDE & ZIELSETZUNG: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Monatsschrift "Die Horen" von Schiller im Kontext der Französischen Revolution. Es beleuchtet die Ambivalenz zwischen den revolutionären Idealen und ihren katastrophalen Folgen. Schiller strebte mit "Die Horen" die Wiederherstellung von Einheit und Frieden durch Fokussierung auf Wahrheit und Schönheit an, obwohl diese vermeintliche politische Neutralität implizit die Revolution thematisierte, wie Schillers spätere Schriften zeigen.
2. GOETHES MITARBEIT & SEIN VERHÄLTNIS ZUR FRANZÖSISCHEN REVOLUTION: Goethe, ein wichtiger Mitarbeiter der "Horen", konnte die Thematik der Revolution in seinem Beitrag, den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", nicht umgehen. Das Kapitel beschreibt Goethes ambivalente Haltung zur Revolution: Er erkannte das Scheitern des ancien régime an, verurteilte aber die Gewalt und den Terror der Revolution. Sein Ansatz war eine indirekte Auseinandersetzung mit dem Thema durch die individualpsychologische Ebene.
3. ZUR 'ERZIEHERISCHEN' EFFEKTIVITÄT DER LITERATUR: Dieses Kapitel analysiert Goethes und Schillers unterschiedliche Ansichten über den Einfluss von Literatur auf die Gesellschaft. Goethe glaubte weniger an eine direkte Umerziehung durch Literatur, während Schiller eine ästhetische Erziehung des Einzelnen zur Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben sah. Goethe bevorzugte einen indirekteren Ansatz, die individuelle Selbstbeherrschung fördernd.
Schlüsselwörter
Französische Revolution, Goethe, Schiller, "Die Horen", "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", "Der Prokurator", individuelle Selbstbeherrschung, sittliche Entwicklung, psychoanalytische Aspekte, ästhetische Erziehung, literarische Verarbeitung der Revolution.
Häufig gestellte Fragen zu Goethe's "Der Prokurator" und den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Goethe's Novelle "Der Prokurator" im Kontext der "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten". Im Mittelpunkt steht die Analyse der Bedeutung individueller Selbstbeherrschung für die soziale Relevanz im Angesicht der Französischen Revolution. Die Arbeit beleuchtet zudem Goethes Beteiligung an Schillers "Horen" und dessen Verhältnis zur Revolution.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Goethes literarische Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, die Rolle individueller Selbstbeherrschung in Goethes Novellen, die "erzieherische" Wirkung von Literatur im Kontext der Revolution, eine Analyse der "Prokurator"-Novelle als Beispiel für die behandelten Themen und eine psychoanalytische Betrachtung der Charaktere in der Novelle. Die Entstehung und Ziele von Schillers "Die Horen" im Kontext der Französischen Revolution werden ebenfalls untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beleuchtet die historischen Hintergründe und die Zielsetzung von Schillers "Die Horen". Kapitel 2 behandelt Goethes Mitarbeit an "Die Horen" und sein Verhältnis zur Französischen Revolution. Kapitel 3 analysiert die "erzieherische" Effektivität von Literatur. Die Kapitel 4, 5 und 6 untersuchen die Revolutionsthematik, die Bedeutung und die "sittliche Entwicklung" in der "Prokurator"-Novelle. Kapitel 7 betrachtet den "Prokurator" unter psychoanalytischen Aspekten. Kapitel 8 bietet eine abschließende Betrachtung (Konklusion).
Welche Rolle spielt die Novelle "Der Prokurator"?
"Der Prokurator" dient als zentrales Beispiel für die behandelten Themen. Die Arbeit analysiert die Novelle hinsichtlich ihrer Quellen, Goethes Bearbeitung, ihrer zentralen Rolle im Novellenzyklus der "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", der Darstellung der "sittlichen Entwicklung" und unter psychoanalytischen Gesichtspunkten.
Wie wird die Französische Revolution behandelt?
Die Arbeit untersucht Goethes ambivalente Haltung zur Französischen Revolution. Sie analysiert seine indirekte Auseinandersetzung mit dem Thema auf der individualpsychologischen Ebene in den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" und setzt dies in Beziehung zu Schillers Zielen mit "Die Horen".
Welche Bedeutung hat die "sittliche Entwicklung" in der Arbeit?
Die "sittliche Entwicklung" ist ein zentrales Thema, insbesondere in der Analyse der "Prokurator"-Novelle. Die Arbeit untersucht, wie diese Entwicklung dargestellt wird, ihren Zusammenhang mit sozialem Status und ihre Bedeutung als Modell für die gesellschaftliche Entwicklung.
Welche psychoanalytischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit wendet psychoanalytische Aspekte auf die Charaktere der "Prokurator"-Novelle an, insbesondere unter Bezugnahme auf Freuds Strukturmodell des psychischen Apparats ("Es" und "Über-Ich").
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Französische Revolution, Goethe, Schiller, "Die Horen", "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", "Der Prokurator", individuelle Selbstbeherrschung, sittliche Entwicklung, psychoanalytische Aspekte, ästhetische Erziehung, literarische Verarbeitung der Revolution.
- Arbeit zitieren
- M.A. Jürgen Grohs (Autor:in), 1994, Die 'Prokurator'-Novelle in Goethes 'Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten' - Ein Exempel für die soziale Relevanz individueller Selbstbeherrschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29222