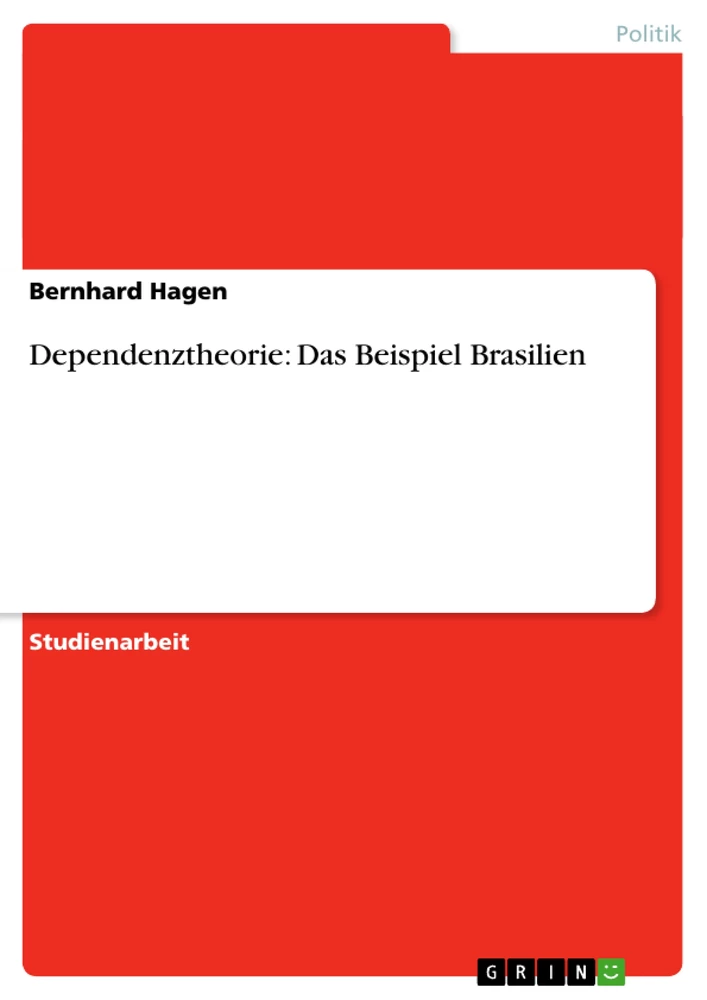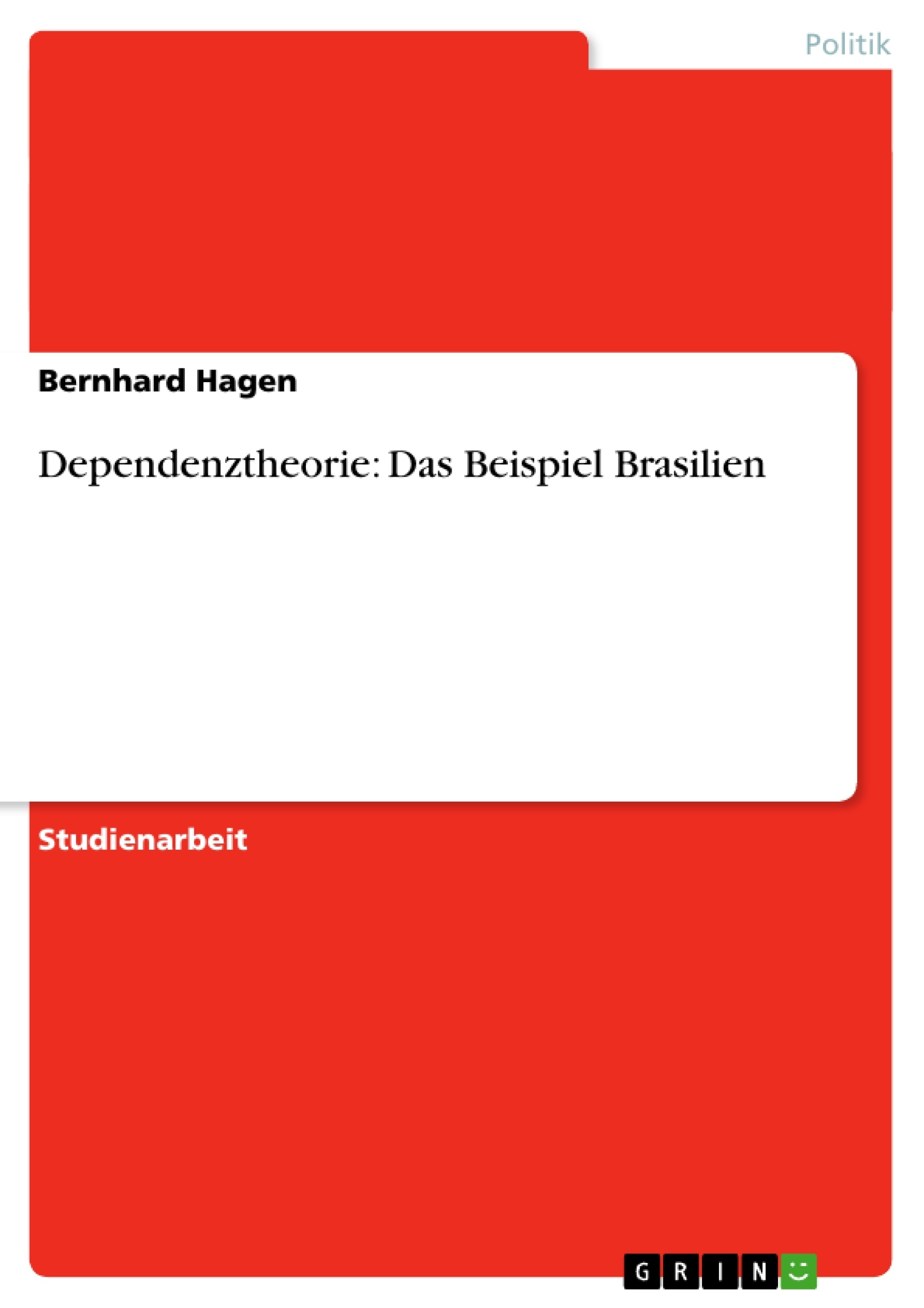Brasilien ist mit 172 Mio. Einwohnern das wirtschaftlich bedeutendste Land Lateinamerikas. Es verfügt über reiche Ressourcen wie Bodenschätze, Wasserkraft, Arbeitskräfte und gute Bedingungen für die Landwirtschaft. Es gehört zugleich zu den am stärksten industrialisierten Ländern der Region. Allerdings ist Brasilien aber auch von großen regionalen und sozialen Gegensätzen geprägt und gehört zu den höchstverschuldeten Entwicklungsländern.Die gesamte Außenschuld wurde von der brasilianischen Zentralbank für Dezember 2002 mit 227,7 Mrd. USD angegeben.
Die Schere zwischen arm und reich geht extrem weit auseinander, Brasilien gilt weltweit als Land mit der ungleichsten Verteilung des Wohlstandes.3 Die reichsten 10% des Landes besitzen 65% des Wohlstandes, die ärmsten 40% nur 7%. Und die ärmsten 10% dürfen nur unglaubliche 0,6% des Wohlstandes ihr Eigen nennen. Mitte der 90er Jahre lebte mindestens ein Fünftel der Bevölkerung, also ungefähr 32 Millionen Menschen, in extremer Armut. Bis zum heutigen Tag hat sich die Situation nicht gebessert. „Die städtische Arbeitslosigkeit ist höher denn je, die Armut ist kaum geringer geworden, das Einkommensgefälle hat sich sogar noch verschärft. Laut UN leben 22 Prozent der Brasilianer von weniger als zwei Dollar am Tag.“5 „Die Hälfte der Bevölkerung kann nicht schlafen, weil sie Hunger leidet. Die andere Hälfte kann nicht schlafen, weil sie Angst vor denen hat, die Hunger leiden“, sagt der Ökonom Aloizio Mercadante, seines Zeichens ein Berater des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva .6 Natürlich stellt sich die Frage, wie solche gravierenden Unterschiede in der Brasilianischen Gesellschaft zustande gekommen sind und wieso man dieses Problem bisher nicht lösen konnte. Diese Arbeit setzt sich im Folgenden mit der Hypothese auseinander, dass ebendiese gesellschaftlichen Unterschiede die Folge der Eingliederung Brasiliens in den Weltmarkt sind - wie die Dependenztheorie anführt. Dabei habe ich versucht, den Konflikt zwischen dependenz- und modernisierungstheoretischen Ansätzen darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theorie und Begriffsbestimmung
- II.1. Modernisierungstheorie
- II.2. Dependenztheorie
- II.3. Newly Industrialized Countries
- III. Brasilien
- III.1. Wirtschaftsgeschichte
- III.1.1. Militärherrschaft 1964-1985
- III.1.2. Demokratie seit 1985
- III.1.3. MERCOSUR
- III.2. Ein Musterbeispiel der Dependenztheorie?
- III.2.1. Ja
- III.2.2. ...und Nein
- III.1. Wirtschaftsgeschichte
- IV. Fazit
- V. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der Dependenztheorie im Kontext der brasilianischen Wirtschaftsentwicklung. Sie analysiert die Ursachen und Folgen der Eingliederung Brasiliens in den Weltmarkt und untersucht, inwieweit die Dependenztheorie zur Erklärung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten in Brasilien beitragen kann. Darüber hinaus wird die Arbeit den Konflikt zwischen dependenz- und modernisierungstheoretischen Ansätzen beleuchten und kritisch hinterfragen.
- Die Rolle der Dependenztheorie für die Analyse der brasilianischen Wirtschaftsentwicklung
- Die Ursachen und Folgen der Eingliederung Brasiliens in den Weltmarkt
- Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten in Brasilien
- Der Konflikt zwischen dependenz- und modernisierungstheoretischen Ansätzen
- Die Bedeutung von internationalen Beziehungen und globalen Machtstrukturen für die Entwicklung Brasiliens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Brasilien als ein Land mit großem wirtschaftlichem Potenzial dar, das jedoch von sozialen und regionalen Gegensätzen geprägt ist. Die Kapitel II und III befassen sich mit der theoretischen Grundlage der Arbeit und der Analyse Brasiliens im Kontext der Dependenztheorie. Kapitel II beleuchtet die Entwicklungstheorien und insbesondere die Dependenztheorie, die die Unterentwicklung von Ländern wie Brasilien auf die Abhängigkeit von den Industrieländern zurückführt. Kapitel III konzentriert sich auf die Wirtschaftsgeschichte Brasiliens, analysiert die Auswirkungen der Militärherrschaft und die Rolle des MERCOSUR. Es stellt die Frage, ob Brasilien ein Musterbeispiel für die Dependenztheorie ist. Das Fazit (Kapitel IV) fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Dependenztheorie, Modernisierungstheorie, Wirtschaftsentwicklung, Unterentwicklung, Brasilien, Lateinamerika, Militärherrschaft, MERCOSUR, soziale Ungleichheit, Wirtschaftsgeschichte, Weltmarkt, globale Machtstrukturen.
- Quote paper
- Bernhard Hagen (Author), 2004, Dependenztheorie: Das Beispiel Brasilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29253