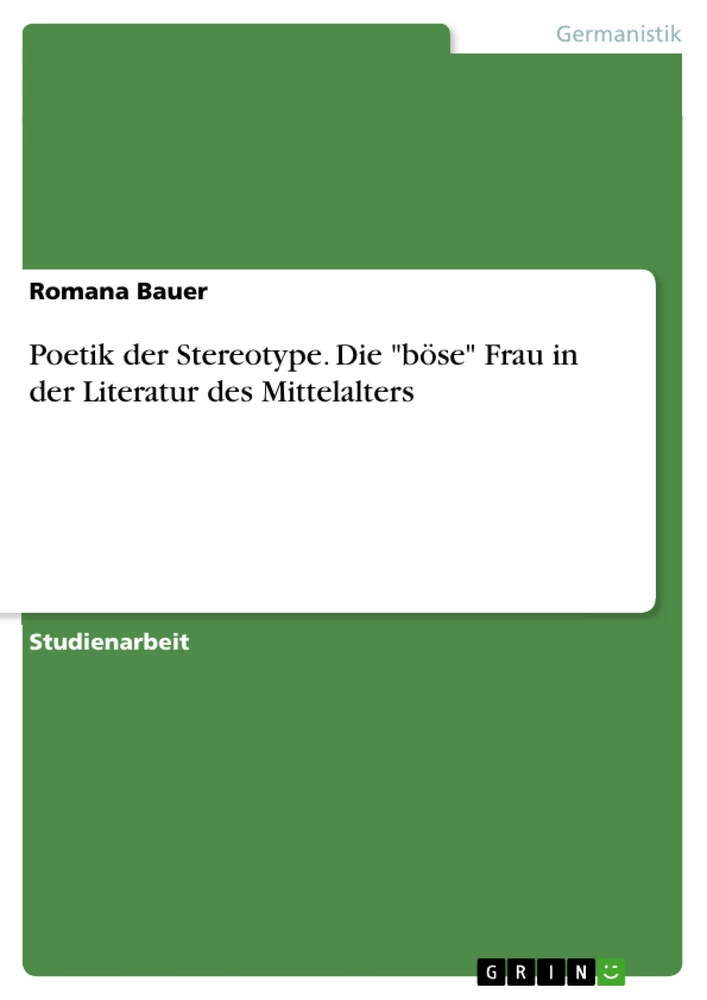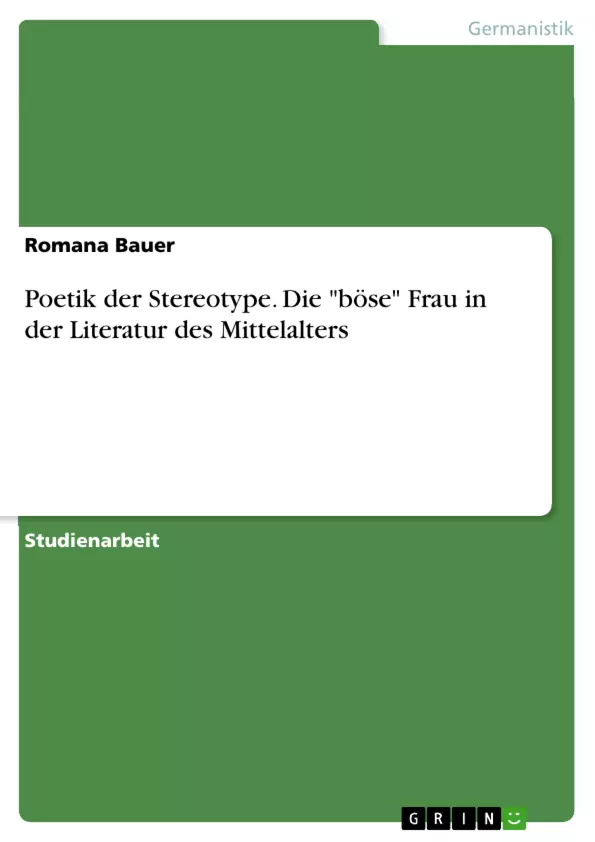Es ist ein prägnantes Motiv, auf welches man bei der Rezeption mittelalterlicher Mären immer wieder stößt: Die böse, betrügerische, hinterlistige Frau. In zahlreichen Werken verschiedenster Autoren betrügen Ehefrauen ihre Männer, belügen sie - um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder schlicht aus reiner Bosheit - oder stellen sie in der Öffentlichkeit bloß. Meist einhergehend mit dem Bild der bösen Frau ist das des dummen Mannes, der sich von ihr täuschen oder überreden lässt. Beides sind Stereotypen, sie sich in Mären wiederholt finden lassen.
Das sehr negative Frauenbild hat seinen Ursprung schon in der Bibel: „der erste energielose Eheherr war bereits Adam, nicht allein, daß er Frau Eva so schlecht gezogen hatte, daß sie den lockenden Verführungsworten der Schlange sofort nachkam, sondern er biss auch selbst ohne jede Einwendung in den Apfel, als Eva es so wollte.“ Bereits hier wurde die Frau, die ihren Mann zum Begehen einer Sünde überredet, als Ursprung alles Schlechten und Bösen gesehen, „die Neigung zum Ungehorsam ist seit Evas Zeiten tief im weiblichen Wesen eingewurzelt. Anstatt zu gehorchen, trachten die Frauen zu befehlen.“
Ihre Bosheit leben Frauen - bedingt durch ihre physische Unterlegenheit gegenüber den Männern - meist durch List und Tücke aus, „Frauenlist ist immer Sprachlist, List der Überredung.“ Hier lassen sich zwei verschiedene Typen erkennen: Zum Einen die körperlich schwachen Frauen, die sich mithilfe ihres Intellekts gegenüber stärkeren Männern, Geliebten oder Machtinhabern behaupten müssen, und zum Anderen jene, die einfach böswillig handeln, um ihre Bedürfnisse nach Geld, Macht oder sexueller Befriedigung zu stillen.
Der Stereotyp der bösen Frau wurde in der bisherigen Forschung schon mehrfach untersucht, erscheint aber in Zeiten, in denen sich Gender-Studies und feministische Betrachtungen großer Beliebtheit erfreuen, nicht weniger interessant. In der folgenden Arbeit sollen die verschiedenen Typen der bösen Frau, die Rahmenbedingungen, unter welchen sie handeln und die Motive ihres Handelns anhand zweier Mären, und zwar „Aristoteles und Phyllis“ sowie Heinrich Kaufringers „Drei listigen Frauen“ näher betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik
- 2. Böse Frauen in „Aristoteles und Phyllis“ und „Drei böse Frauen“
- 2.1 „Aristoteles und Phyllis“ - Bosheit auf den zweiten Blick
- 2.2 „Drei listige Frauen“ - Die offensichtlich Bösen
- 3. Erklärungsansätze für das böse Verhalten
- 3.1 Hoher Stellenwert des christlichen Glaubens
- 3.2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 4. Fazit und Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stereotyp der „bösen Frau“ in mittelalterlichen Mären. Ziel ist es, verschiedene Ausprägungen dieses Stereotyps zu analysieren und die gesellschaftlichen und religiösen Kontexte zu beleuchten, die zu seiner Entstehung und Verbreitung beigetragen haben.
- Darstellung des Stereotyps der „bösen Frau“ in mittelalterlichen Texten
- Analyse der Handlungsmotive der weiblichen Figuren
- Der Einfluss des christlichen Glaubens auf das Frauenbild
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf das weibliche Verhalten
- Vergleichende Analyse zweier Mären: „Aristoteles und Phyllis“ und „Drei listige Frauen“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Thematik: Die Einleitung führt in die Thematik des Stereotyps der „bösen Frau“ in mittelalterlichen Mären ein. Sie verweist auf die häufige Darstellung betrügerischer und hinterlistiger Frauen in diesen Texten und beleuchtet den oft damit verbundenen Stereotyp des naiven oder dummen Mannes. Die Arbeit verortet den Ursprung dieses negativen Frauenbildes in der Bibel und diskutiert die gängige Darstellung weiblicher Bosheit als List und Tücke, die aus physischer Unterlegenheit resultiert. Es werden zwei Frauentypen unterschieden: körperlich schwache Frauen, die ihren Intellekt einsetzen, und böswillig handelnde Frauen, die ihre Bedürfnisse befriedigen wollen. Die Arbeit kündigt an, verschiedene Frauentypen, Handlungsbedingungen und Motive anhand von „Aristoteles und Phyllis“ und „Drei listige Frauen“ zu untersuchen.
2. Böse Frauen in „Aristoteles und Phyllis“ und „Drei böse Frauen“: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung böser Frauen in den beiden genannten Mären. Es wird untersucht, wie sich die Bosheit der weiblichen Figuren konkret äußert und welche Motive dahinterstehen. Der Fokus liegt auf der differenzierten Betrachtung der Charaktere und ihrer Handlungen.
3. Erklärungsansätze für das böse Verhalten: In diesem Kapitel werden mögliche Erklärungen für das in den Mären dargestellte böse Verhalten der Frauen beleuchtet. Es werden sowohl der hohe Stellenwert des christlichen Glaubens als auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als Einflussfaktoren auf das Frauenbild und deren Handeln untersucht und analysiert. Die Kapitel befassen sich mit der Frage, inwiefern religiöse und gesellschaftliche Normen das Verständnis von weiblicher Bosheit prägten und die Handlungen der weiblichen Figuren beeinflussten. Es werden Zusammenhänge zwischen den dargestellten Stereotypen und den gesellschaftlichen Realitäten des Mittelalters hergestellt.
Schlüsselwörter
Böse Frau, Märe, Mittelalter, Stereotyp, Frauenbild, List, Tücke, Christentum, Gesellschaft, Aristoteles und Phyllis, Drei listige Frauen, Gender Studies, Feministische Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Stereotyps der „bösen Frau“ in mittelalterlichen Mären
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert den Stereotyp der „bösen Frau“ in mittelalterlichen Mären. Sie untersucht verschiedene Ausprägungen dieses Stereotyps und beleuchtet die gesellschaftlichen und religiösen Kontexte, die zu seiner Entstehung und Verbreitung beigetragen haben.
Welche Mären werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse zweier Mären: „Aristoteles und Phyllis“ und „Drei listige Frauen“. Diese dienen als Fallstudien zur Untersuchung des Stereotyps der „bösen Frau“.
Welche Aspekte der „bösen Frau“ werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Darstellung des Stereotyps in den ausgewählten Texten, die Motive der weiblichen Figuren, den Einfluss des christlichen Glaubens auf das Frauenbild, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und einen vergleichenden Ansatz beider Mären.
Wie wird der Stereotyp der „bösen Frau“ dargestellt?
Die Arbeit differenziert zwischen körperlich schwachen Frauen, die ihren Intellekt einsetzen, und böswillig handelnden Frauen, die ihre Bedürfnisse befriedigen wollen. Die Darstellung der Bosheit wird als List und Tücke beschrieben, oft im Kontext der vermeintlichen physischen Unterlegenheit der Frau.
Welche Rolle spielt der christliche Glaube?
Der hohe Stellenwert des christlichen Glaubens im Mittelalter wird als wichtiger Einflussfaktor auf das Frauenbild und die Interpretation weiblichen Verhaltens untersucht. Die Arbeit analysiert, wie religiöse Normen das Verständnis von weiblicher Bosheit prägten.
Welche gesellschaftlichen Faktoren werden berücksichtigt?
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Mittelalters werden als weiterer Einflussfaktor auf das Frauenbild und das Handeln der weiblichen Figuren analysiert. Es werden Zusammenhänge zwischen den dargestellten Stereotypen und den gesellschaftlichen Realitäten hergestellt.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Analyse der „bösen Frauen“ in den beiden Mären, ein Kapitel zu den Erklärungsansätzen für das böse Verhalten (religiöse und gesellschaftliche Faktoren) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Böse Frau, Märe, Mittelalter, Stereotyp, Frauenbild, List, Tücke, Christentum, Gesellschaft, Aristoteles und Phyllis, Drei listige Frauen, Gender Studies, Feministische Literaturwissenschaft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Ausprägungen des Stereotyps der „bösen Frau“ zu analysieren und die gesellschaftlichen und religiösen Kontexte zu beleuchten, die zu seiner Entstehung und Verbreitung beigetragen haben.
- Arbeit zitieren
- Romana Bauer (Autor:in), 2014, Poetik der Stereotype. Die "böse" Frau in der Literatur des Mittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292656