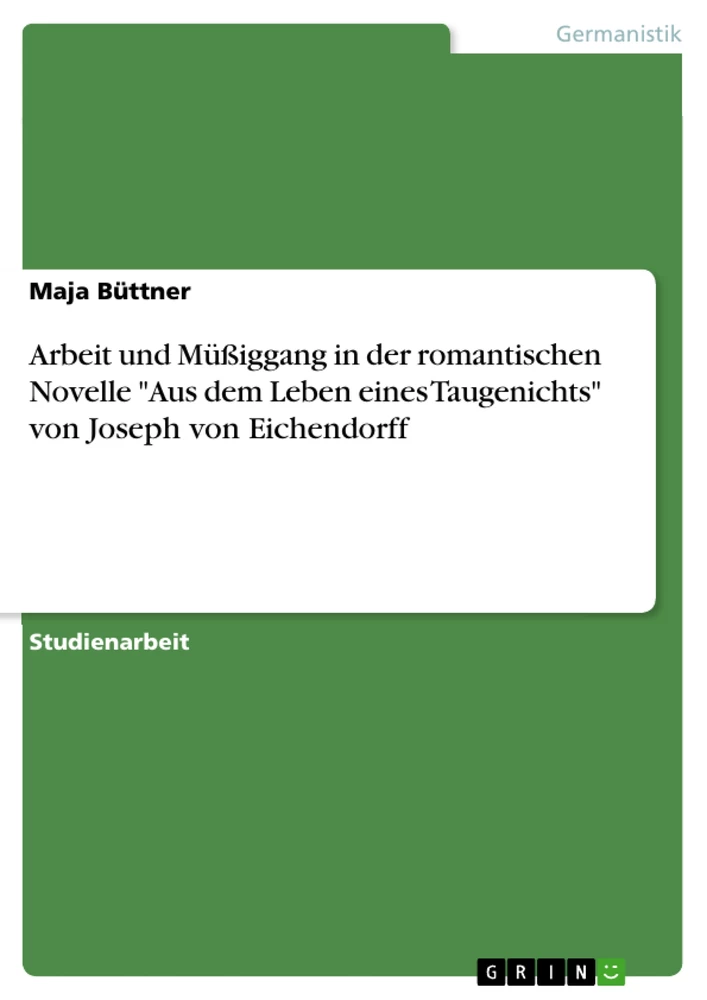Die Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Joseph von Eichendorff entstand in den Jahren 1822/23 in Danzig, wurde jedoch erst 1826 veröffentlicht.
Sie thematisiert so auch Eichendorffs eigenen Kampf mit der bürgerlichen Welt und seine eigenen Erlebnisse spiegeln sich darin wider. Er war in seinem Leben immer Widersprüchen ausgesetzt: Seine Zeit im preußischen Staatdienst kontrastierte mit „seinen dichterischen Intentionen.“
Ihm war diese Welt, in der alles auf Profit und Nutzen bedacht ist, ein Dorn im Auge und er stellte ihr seine „Sehnsucht [...] in die Weite, in ein sorgloses Leben des zwecklosen Betrachtens und des heiteren Anschauens“ gegenüber. So schickt er seinen Taugenichts, die Hauptfigur in der romantischen Novelle, auf die Reise, in welcher dieser mit den bürgerlichen Normen zu kämpfen hat, jedoch am Ende nicht als Sieger, aber als seine Wünsche erfüllender und seiner Lebensauffassung treu bleibender Held hervorgeht.
„Nicht um Kunst geht es bei Eichendorff in erster Linie, sondern um Leben überhaupt, um den einzelnen, seine Freiheit, seinen Platz im größeren Ganzen der Gesellschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Darstellung der Romantiker
- Darstellung der Philister
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der romantischen Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts" von Joseph von Eichendorff. Die Arbeit untersucht, wie Eichendorff in seiner Novelle den Müßiggang durch die Figur des Taugenichts charakterisiert und im Gegensatz dazu die Spießbürgerlichkeit oder Philisterhaftigkeit durch die arbeitende Gesellschaft darstellt. Dabei wird die Frage erörtert, inwiefern Eichendorff die beiden Aspekte "Arbeit" und "Müßiggang" in seiner Novelle verarbeitet.
- Charakterisierung des Taugenichts als Vertreter des Müßiggangs
- Darstellung der Philister als Vertreter der arbeitenden Gesellschaft
- Kontrast zwischen Müßiggang und Arbeit in der Novelle
- Eichendorffs Kritik an der bürgerlichen Welt und seine Sehnsucht nach Freiheit
- Die Bedeutung des Wander- und Reisemotivs in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Handlung der Novelle beginnt in der Mühle des Vaters des Taugenichts. Der Taugenichts verweigert sich der Arbeit und wird von seinem Vater hinausgeworfen. Er begibt sich auf eine Reise und genießt die Freiheit und die Schönheit der Natur. Der Taugenichts begegnet verschiedenen Menschen, darunter Philistern, die ihn für seinen Müßiggang verurteilen. Er bleibt jedoch seiner Lebensauffassung treu und findet am Ende seine eigene Erfüllung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Müßiggang, die Philister, die Arbeit, die romantische Lebensauffassung, die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die Sehnsucht nach Freiheit, das Wander- und Reisemotiv, die Natur und die Bedeutung des Individuums.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“?
Die Novelle von Joseph von Eichendorff thematisiert den Konflikt zwischen dem romantischen Ideal des Müßiggangs und der bürgerlichen Welt der Arbeit und des Nutzens.
Wer ist der „Taugenichts“?
Er ist die Hauptfigur, ein junger Mann, der sich der herkömmlichen Arbeit verweigert und stattdessen mit seiner Geige in die Welt hinauszieht, um Freiheit und Natur zu genießen.
Was versteht Eichendorff unter „Philistern“?
Als Philister bezeichnete man abfällig Spießbürger, die nur auf Profit, Nutzen und bürgerliche Normen bedacht sind und keinen Sinn für Romantik oder Kunst haben.
Welche Rolle spielt das Wandermotiv in der Novelle?
Das Wandern symbolisiert die Sehnsucht nach Freiheit, die zwecklose Betrachtung der Welt und die Flucht aus den Zwängen der Gesellschaft.
Spiegeln sich Eichendorffs eigene Erfahrungen im Werk wider?
Ja, die Novelle spiegelt Eichendorffs eigenen Kampf zwischen seinem Dienst im preußischen Staat und seinen dichterischen Intentionen wider.
- Citar trabajo
- Maja Büttner (Autor), 2014, Arbeit und Müßiggang in der romantischen Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts" von Joseph von Eichendorff, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292882