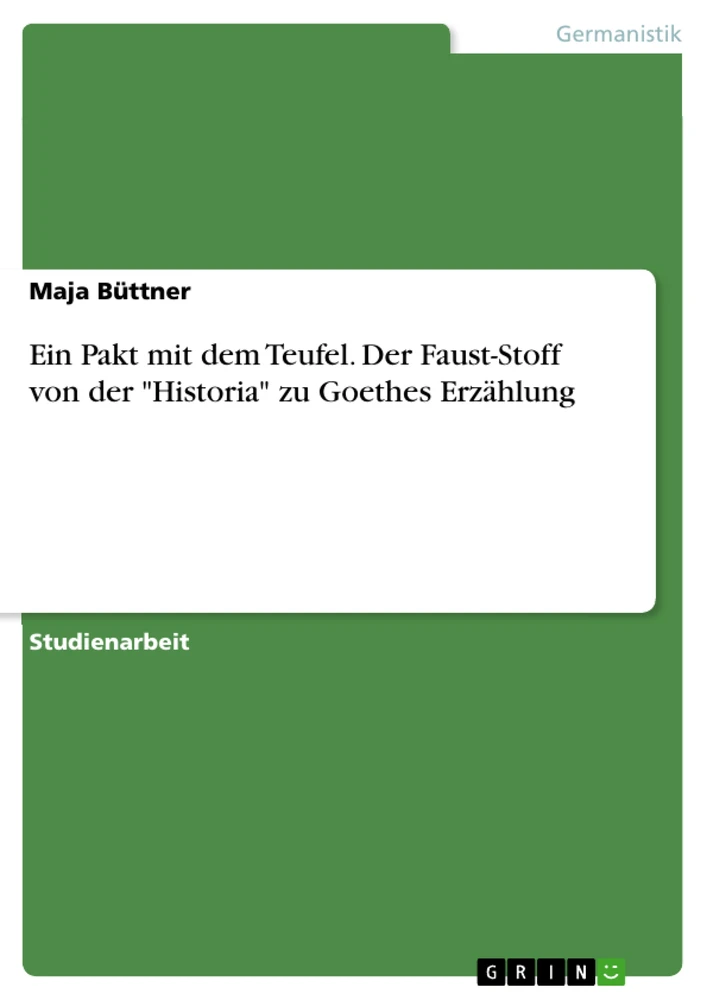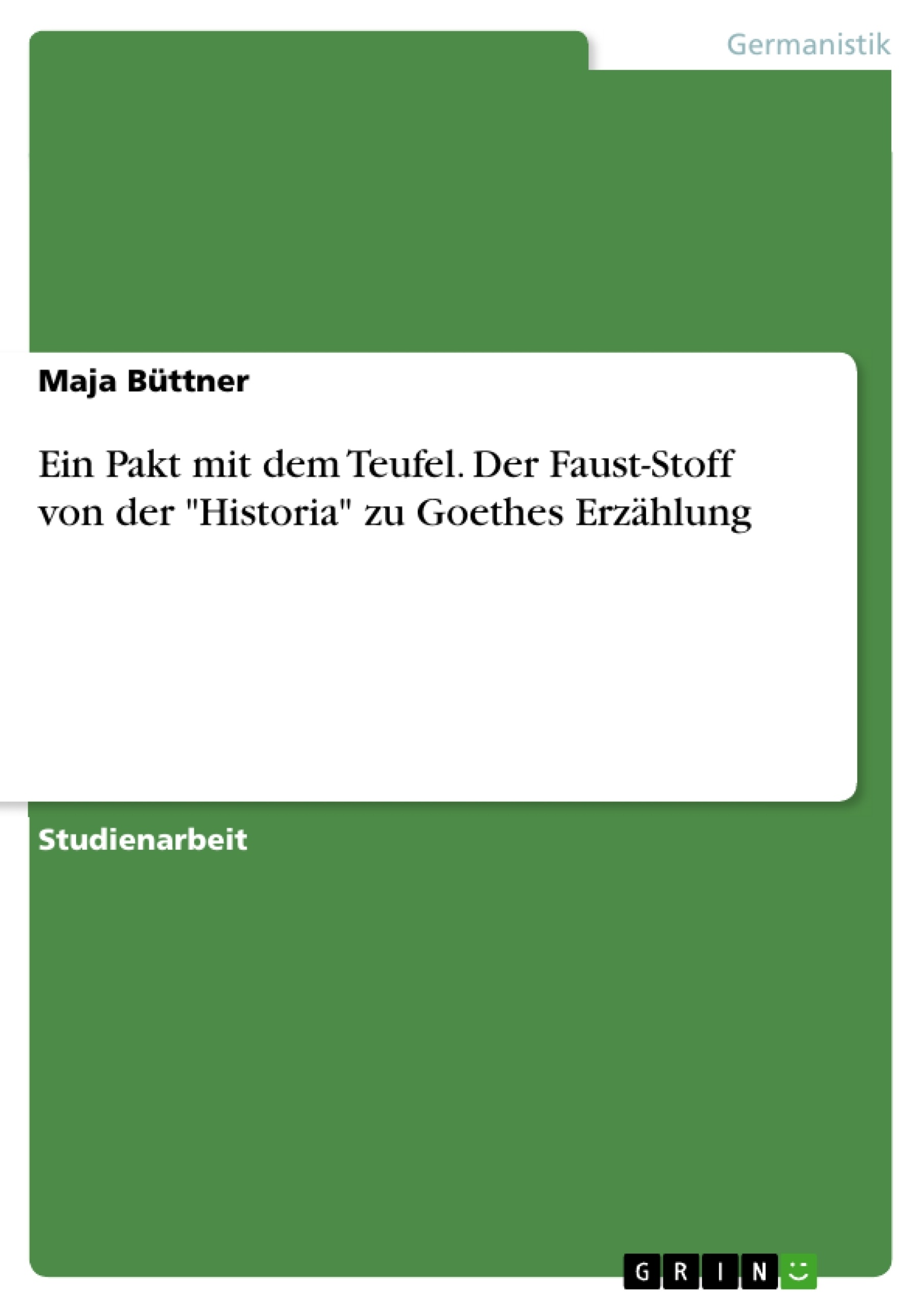Dem Faust-Stoff gilt seit Jahrhunderten ein besonderes Interesse. Er zeigt auf, wie sich ein Mensch im Hier und Jetzt mit den Gegebenheiten so unwohl fühlen und ein unerschöpfliches Streben nach neuem Wissen und Höherem entwickeln kann, dass er sich sogar auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt.
In meiner Hausarbeit möchte ich vor diesem Hintergrund zunächst erarbeiten, was ein Pakt beziehungsweise ein Bündnis überhaupt ist und wie er zustande kommt. Dabei möchte ich auf die unterschiedlichen Arten eingehen, die entweder das Einverständnis des Menschen und den eigenen Willen zum Paktschluss beinhalten oder im Umkehrschluss auch Verführungs-strategien des Teufels implizieren, durch die dem Menschen sozusagen ein Vertrag „aufgezwungen“ wurde. Dabei ist es dem Menschen, ganz gleich ob der Vertrag schriftlich oder in mündlicher Form geschlossen wurde, nicht möglich, aus der Vereinbarung wieder heraustreten zu können. Genau wie heute galten auch mündliche Verträge damals als rechtskräftig.
Mit dieser Kenntnis über die äußere Form eines Paktes möchte ich im zweiten Schritt auf die Historia von D. Johann Fausten genauer eingehen. Diese behandelt den „historischen Faust“ , der wahrscheinlich um 1480 geboren wurde und mit richtigem Namen „Georg Faust“ hieß. Vor der Zeit, als ein anonymer Autor die Historia verfasste, entstanden bereits „Berichte, Anekdoten und Sagen“ über diesen faszinierenden Mann. Im Jahr 1587 entstand dann die mir vorliegende Historia von D. Johann Fausten. Bezogen darauf erläutere ich, wie Faust zu seinem Pakt mit dem Teufel kommt und wie dieser aussieht. Weiterhin, dass er am Ende die Gnade Gottes unterschätzt und so einen grausamen Tod findet.
Des Weiteren werde ich mit der „Urfassung“ Historia die Faust-Fassung von Goethe im Hinblick auf den Teufelspakt vergleichen. Diese erschien in fertiger Fassung 1832, also fast dreieinhalb Jahrhunderte später als die Historia. In dieser Version sich der Teufel zu einer anderen Persönlichkeit hin verändert, die allgemein positiver wirkt als die Gestalt in der Historia. Auch hat sich die ganze Rahmenhandlung verändert und erzählt nicht mehr nur das Leben des Dr. Johann Fausten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Ein Bündnis/Pakt mit dem Teufel
- Der Teufelspakt in der Historia von D. Johann Fausten
- Der Teufelspakt in Goethes Faust
- Vergleich
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Thematik des Teufelspaktes im Kontext der literarischen Figur Faust zu untersuchen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie die Vorstellung eines Bündnisses mit dem Teufel in der Historia von D. Johann Fausten und in Goethes Faust dargestellt wird.
- Begriffserklärung: Was ist ein Pakt mit dem Teufel?
- Der Teufelspakt in der Historia von D. Johann Fausten
- Der Teufelspakt in Goethes Faust
- Vergleich der beiden Figuren und deren Pakte
- Gesellschaftliche und literarische Einflüsse auf die Darstellung des Teufelspaktes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den literarischen Stoff Faust und dessen Relevanz in den historischen Kontext dar. Außerdem wird die wissenschaftliche Fragestellung und die Vorgehensweise der Hausarbeit skizziert.
Ein Bündnis/Pakt mit dem Teufel
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Entstehung von Bündnissen bzw. Pakten im Allgemeinen, insbesondere mit dem Fokus auf Bündnissen mit dem Teufel. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie beispielsweise die Freiwilligkeit des Paktschlusses und die Rolle des Teufels bei der Verführung.
Der Teufelspakt in der Historia von D. Johann Fausten
Hier wird die Historia von D. Johann Fausten genauer analysiert. Die Entstehung des Paktes zwischen Faust und dem Teufel wird dargestellt, und es wird aufgezeigt, wie dieser Pakt zu Fausts tragischem Ende führt.
Der Teufelspakt in Goethes Faust
Dieser Abschnitt behandelt den Teufelspakt in Goethes Faust. Es werden die Unterschiede in der Darstellung des Teufels und der Rahmenhandlung im Vergleich zur Historia von D. Johann Fausten erläutert.
Vergleich
In diesem Kapitel werden die beiden Faust-Versionen hinsichtlich des Teufelspaktes gegenübergestellt. Es werden die Veränderungen in der Darstellung und die möglichen Ursachen für diese Veränderungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit lassen sich mit den folgenden Schlüsselwörtern zusammenfassen: Teufelspakt, Historia von D. Johann Fausten, Goethes Faust, Verführung, Verträge, Bündnisse, Literaturgeschichte, Gesellschaftsgeschichte, Religiöse Einflüsse, Literarische Interpretation.
- Quote paper
- Maja Büttner (Author), 2013, Ein Pakt mit dem Teufel. Der Faust-Stoff von der "Historia" zu Goethes Erzählung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292887