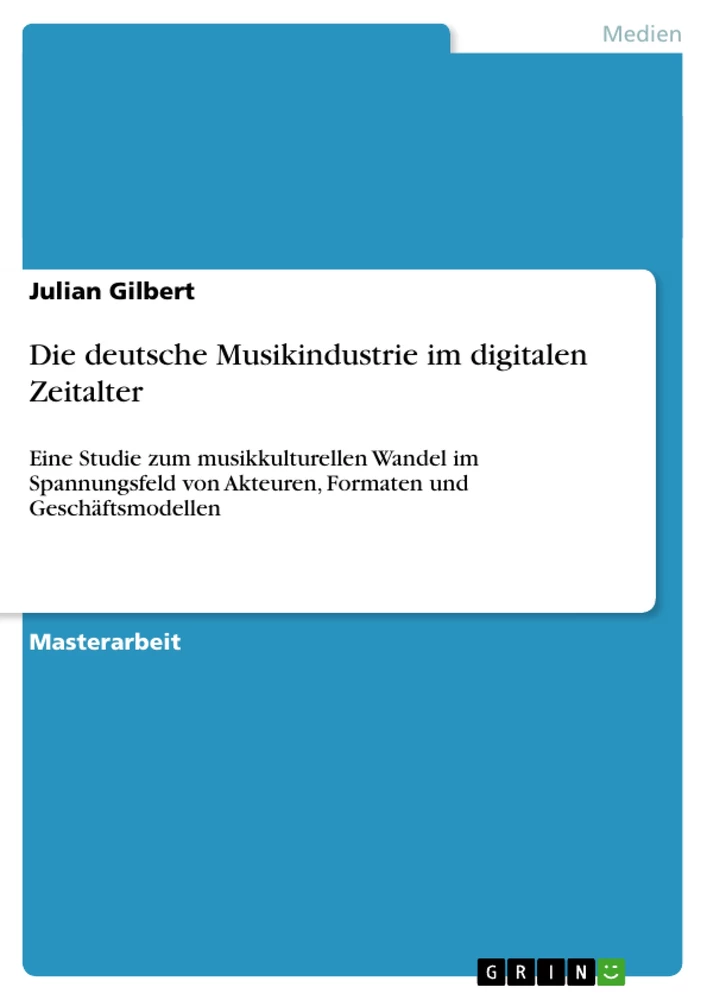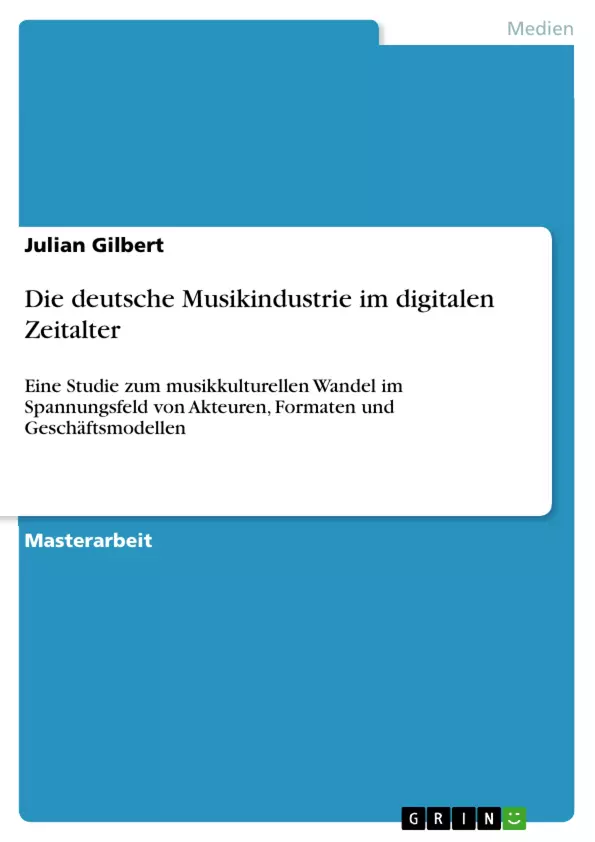Im Verlauf ihrer Geschichte hat sich die Musik als kulturelles und ökonomisches Gut immer wieder Modifikationen unterzogen und technologische Entwicklungen durchlebt.
Mit dem Aufkommen des Internets und dem Beginn des “Digitalen Zeitalters“, das ein Set neuer Technologien hervorbrachte, ist die Musikpraxis und -wirtschaft vor bis dato
unvergleichliche Herausforderungen gestellt worden. Die Loslösung der Musik von ihrem physischen Trägermedium stellt in diesem Kontext eine der innovativsten Entwicklungen
dar und bewirkt seitdem weitreichende Umgestaltungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche. Als Reaktion auf diese Genese konnte lange Zeit, insbesondere bei den Major Labels, ein konservatives Festhalten an der gängigen Praxis der Musikindustrie beobachtet werden. Versuche rechtlicher Restriktionen etwa sollten das Aufkommen neuer Implikationen und Konkurrenten weitestgehend unterbinden.
Die strategische Marschroute, eine Abwehrhaltung gegenüber brancheninnovativen Prozessen aufzubauen, offenbarte sich jedoch als nicht ertragsbringendes Kalkül, was sich in starken Umsatzeinbußen ausdrückte.
Es stellt sich daher die Frage, welcher neuen Strategien es seitens der Musikindustrie bedarf, um der Vielschichtigkeit an Möglichkeiten, die mit der Digitalisierung im Musikmarkt
einhergehen, gerecht zu werden, und trotz des einfachen und meist kostenfreien Zugangs zur Musik im Internet, Erlöse erzielen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Einführung
- Eingrenzung des Feldes und Methodik
- Untersuchungshypothesen
- Vorgehensweise
- THEORETISCHES FUNDAMENT
- Feldtheorie von Bourdieu
- Production-of-Culture Ansatz nach Peterson
- GRUNDLAGEN
- Die Beschaffenheit der Musik als Gut
- Ausdifferenzierung der Musikindustrie
- Die Tonträgerindustrie
- Die Major-Labels
- Independent-Labels
- Klassische Wertschöpfungskette der Tonträgerindustrie
- Das digitale Zeitalter
- DER MUSIKKULTURELLE WANDEL
- Kultureller Paradigmenwechsel
- Jazz-Revolution
- Rock'n'Roll-Revolution
- Digitale Revolution
- Kosten- und Wertschöpfungsstrukturen digitaler Musik
- Online Distributoren
- Download to Own
- Download to Rent
- Music as a Service
- Internetradios und webradioähnliche Streaming-Dienste
- SOZIOKULTURELLER WANDEL
- Verändertes Werte- und Normensystem der Konsumenten
- Mobilität und Flexibilität
- Pluralität und Individualismus
- Datenklau als Kavaliersdelikt
- Wertschätzung für digitale Musik
- Retromanie
- PARADIGMA 4: DAS ZEITALTER DES DIGITALEN
- Strukturwandel des Musikmarktes
- Strategieansätze neuer Akteure im digitalen Paradigma
- Eigenständige Erhaltungsstrategien der Tonträgerkonzerne
- Ausbildung einer neuen Musikästhetik?! - Mashup
- FAZIT
- ANHANG
- LITERATURVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ABB. 1: Physischer Absatz von Tonträgern in Deutschland von 2001 bis 2012
- ABB. 2: Beliebteste Geräte bei der mobilen Musiknutzung 2012
- ABB. 3: Meinung zu einem Leben ohne Handy
- ABB. 4: Meistverkaufte Alben der Musikgeschichte in Millionen Stück
- ABB. 5: GfK-Konsumstudie des Veranstaltungsmarktes 2011 Übersicht über die Entertainment-Märkte
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Entwicklung der deutschen Musikindustrie im digitalen Zeitalter. Sie analysiert den musikkulturellen Wandel im Spannungsfeld von Akteuren, Formaten und Geschäftsmodellen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation für die Musikbranche zu beleuchten und die Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette, die Konsumenten und die Musikästhetik zu untersuchen.
- Die Auswirkungen der digitalen Revolution auf die Musikbranche
- Der Wandel von traditionellen Geschäftsmodellen und die Entstehung neuer Akteure
- Die veränderten Konsumgewohnheiten und die Bedeutung von Streaming-Diensten
- Die Herausforderungen des Urheberrechts und der digitalen Verbreitung von Musik
- Die Entwicklung neuer Musikformate und die Entstehung von Mashup-Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der digitalen Transformation der Musikindustrie ein und erläutert die Forschungsmethodik sowie die Untersuchungshypothesen. Das theoretische Fundament stellt die Feldtheorie von Bourdieu und den Production-of-Culture Ansatz nach Peterson vor, die als analytische Werkzeuge für die Untersuchung des musikkulturellen Wandels dienen. Die Grundlagenkapitel befassen sich mit der Beschaffenheit der Musik als Gut, der Ausdifferenzierung der Musikindustrie und der klassischen Wertschöpfungskette der Tonträgerindustrie. Dabei werden die Major-Labels, Independent-Labels und die Rolle der Tonträgerindustrie im digitalen Zeitalter beleuchtet.
Das Kapitel "Der musikkulturelle Wandel" analysiert die kulturellen Paradigmenwechsel, die die Musikbranche im Laufe der Geschichte geprägt haben, insbesondere die Jazz-Revolution, die Rock'n'Roll-Revolution und die digitale Revolution. Es werden die Kosten- und Wertschöpfungsstrukturen digitaler Musik sowie die verschiedenen Online-Distributoren wie Download to Own, Download to Rent, Music as a Service und Internetradios und webradioähnliche Streaming-Dienste untersucht.
Das Kapitel "Soziokultureller Wandel" befasst sich mit den veränderten Werte- und Normensystemen der Konsumenten im digitalen Zeitalter. Es werden Themen wie Mobilität und Flexibilität, Pluralität und Individualismus, Datenklau als Kavaliersdelikt und die Wertschätzung für digitale Musik behandelt. Außerdem wird das Phänomen der Retromanie im Kontext des digitalen Wandels analysiert.
Das Kapitel "Paradigma 4: Das Zeitalter des Digitalen" untersucht den Strukturwandel des Musikmarktes, die Strategieansätze neuer Akteure im digitalen Paradigma und die Eigenständigen Erhaltungsstrategien der Tonträgerkonzerne. Es wird außerdem die Ausbildung einer neuen Musikästhetik im Kontext des Mashup-Phänomens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die deutsche Musikindustrie, den digitalen Wandel, den musikkulturellen Wandel, die Tonträgerindustrie, Streaming-Dienste, Download-Plattformen, Musikästhetik, Mashup-Kultur, Urheberrecht, Wertschöpfungskette, Konsumverhalten, Retromanie, Paradigmenwechsel, Feldtheorie, Production-of-Culture Ansatz, Major-Labels, Independent-Labels, Online-Distributoren, digitale Revolution, Jazz-Revolution, Rock'n'Roll-Revolution.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Digitalisierung die Musikindustrie verändert?
Die Loslösung der Musik vom physischen Trägermedium hat die gesamte Wertschöpfungskette verändert, von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Konsum via Streaming.
Was sind die Unterschiede zwischen Major- und Independent-Labels?
Major-Labels sind große Konzerne mit massiven Ressourcen, während Independent-Labels oft nischenorientierter und flexibler agieren, aber geringere Budgets haben.
Welche neuen Geschäftsmodelle gibt es im digitalen Zeitalter?
Dazu gehören „Download to Own“, „Download to Rent“ sowie „Music as a Service“ (Streaming-Abonnements) und werbefinanzierte Internetradios.
Was ist mit dem Begriff „Retromanie“ gemeint?
Es beschreibt das Phänomen, dass trotz digitaler Revolution eine starke Sehnsucht nach analogen Formaten (wie Vinyl) und vergangenen Musikstilen besteht.
Wie beeinflusst Mashup-Kultur die Musikästhetik?
Mashups kombinieren bestehende Werke zu etwas Neuem, was rechtliche Herausforderungen beim Urheberrecht aufwirft, aber auch eine völlig neue Form der Kreativität darstellt.
- Citation du texte
- Julian Gilbert (Auteur), 2013, Die deutsche Musikindustrie im digitalen Zeitalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292930