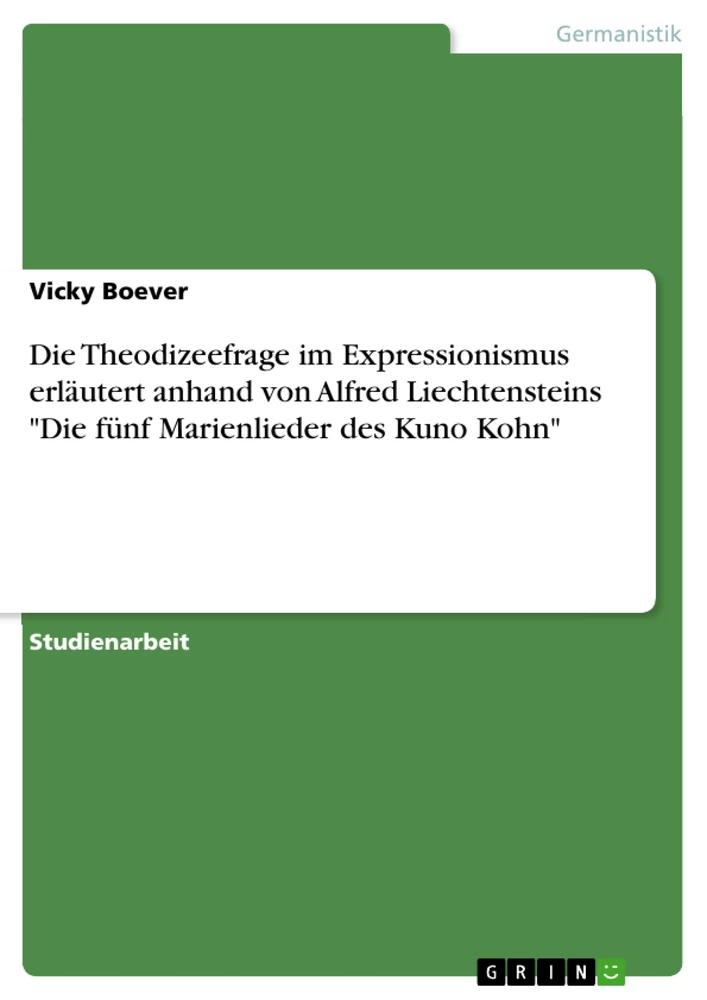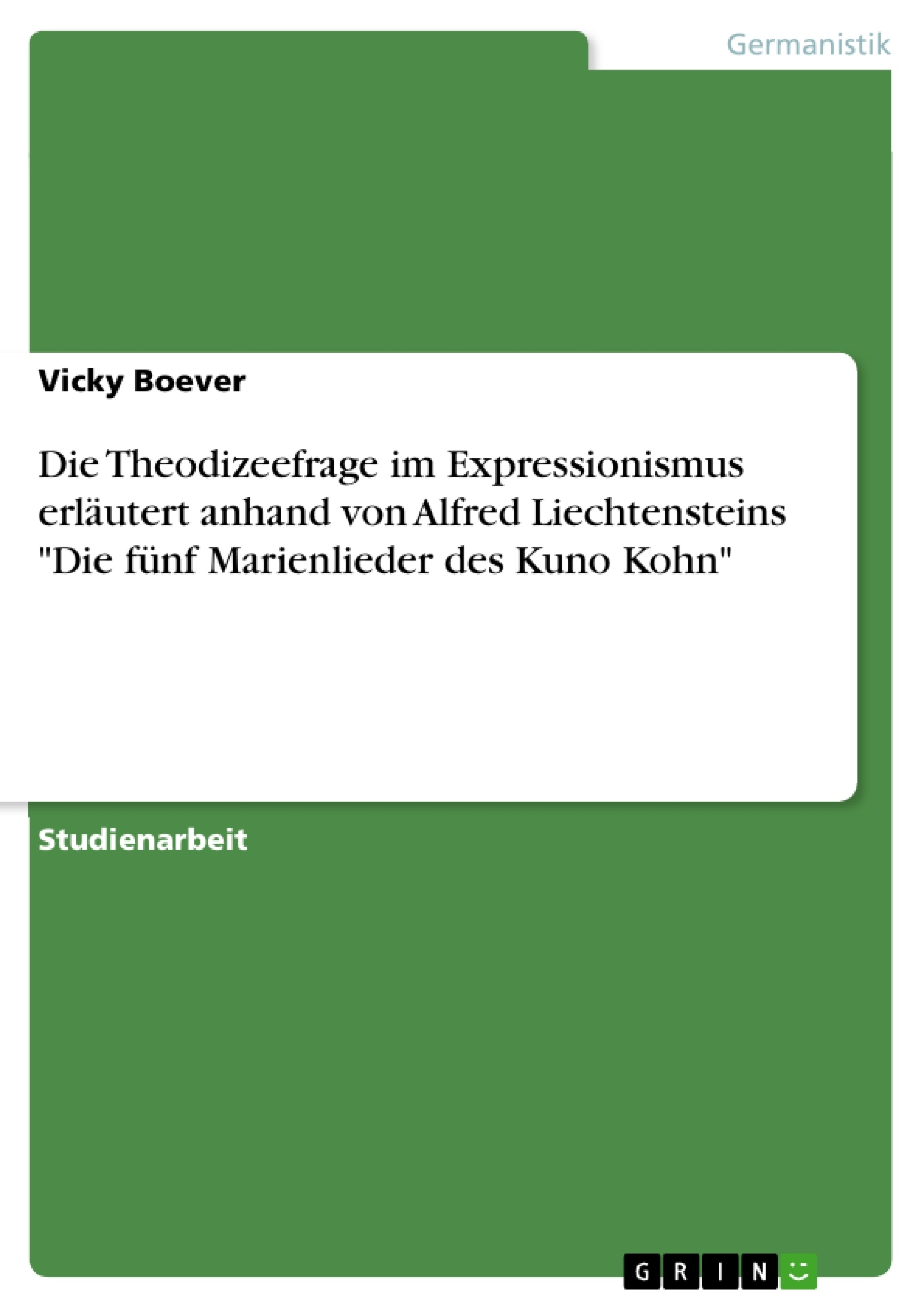Der Expressionismus existiert „,als Sammelbezeichnung für eine spezifische Strömung“, da es keine präzisen Merkmale und keine all-werk-umfassende Definition gibt. 1910 bis 1920 prägen über 300 Autoren diese Bewegung und sorgen für eine Variabilität an Werken und Merkmalen, die eine einheitliches Programm nicht zu lassen. Es lässt sich lediglich durch die Unterscheidung von den Vor- und Nachprägern eine Richtlinie erahnen.
Um die Jahrhundertwende von 1900 kreisen neben dem Expressionismus mehrere Strömungen: Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil, Neuromantik, Neuklassik, Naturalismus, Realismus und décadence. Diese Tendenzen wirken gleichzeitig oder folgen zumindest unmittelbar aufeinander.
Das Deutschland des späten 19. Jahrhunderts vollzieht einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung und erlebt die Wende von einer manuell geprägten Agrargesellschaft zu einer modernen Industrienation. Die aufkommende Wichtigkeit der Großstädte und der Industrie bedeutet die Entindividualisierung und das Gefühl von Nutzlosigkeit für die Menschen. Der radikale Zerfall von gewohnten Lebensrhythmen durch die Mechanisierung bedeutet eine Entwurzelung für den Menschen. Des Weiteren wird die Religion durch die Industrie von ihrer gesellschaftlichen Machtposition entthront, was einen weiteren Bruch in der menschlichen Ordnung bedeutet. Mit der Infragestellung Gottes als Zentrum und Bindeglied für die Menschheit wird auch die Entität allen Seins in Frage gestellt. Diese Stimmung von Ich-Zerfall und Unruhe durch Ordnungsbruch wird durch historische Begebenheiten gestützt und verstärkt. Die Ereignisse des Ersten Weltkriegs erschüttern 1914 - 1918 die europäischen Länder und die anfängliche Kriegseuphorie erstickt in der Erkenntnis der Grausamkeit über die Kriegsführung und die unzähligen Opfer. Diese erlebte Erbarmungslosigkeit weckt bei den Menschen den Glauben an eine Apokalypse, welcher durch die Erinnerung an die Naturkatastrophe des Halley’schen Kometen 1910 gestärkt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Expressionismus
- Alfred Lichtenstein
- Kuno-Kohn-Zyklus
- Die fünf Marienlieder des Kuno Kohn
- Gedichtanalyse
- Formale Analyse
- Inhaltliche Analyse
- Konklusion
- Gottesfrage
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Theodizeefrage im Expressionismus, anhand der Analyse von Alfred Lichtensteins Gedicht "Die fünf Marienlieder des Kuno Kohn". Die Arbeit untersucht die Rolle der Figur des Kuno Kohn als Spiegelbild der gesellschaftlichen und individuellen Krisen des frühen 20. Jahrhunderts.
- Die Theodizeefrage im Kontext des Expressionismus
- Die Figur des Kuno Kohn als Außenseiter und Verkörperung von Leid und Unterdrückung
- Die Rolle der Religion und Gottesbild im Werk Lichtensteins
- Die Analyse der formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts "Die fünf Marienlieder des Kuno Kohn"
- Die Bedeutung des Gedichts für die Interpretation des Kuno-Kohn-Zyklus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Theodizeefrage im Expressionismus ein und stellt den Autor Alfred Lichtenstein sowie die Figur des Kuno Kohn vor. Sie beleuchtet den historischen Kontext des Expressionismus und die gesellschaftlichen und individuellen Krisen, die die Bewegung prägten.
Das zweite Kapitel widmet sich den "Fünf Marienliedern des Kuno Kohn" und stellt das Gedicht im Kontext des Kuno-Kohn-Zyklus vor. Es beleuchtet die Figur des Kuno Kohn als Außenseiter und Verkörperung von Leid und Unterdrückung.
Das dritte Kapitel analysiert das Gedicht "Die fünf Marienlieder des Kuno Kohn" formal und inhaltlich. Es untersucht die sprachlichen Mittel, die Bildsprache und die Themen, die im Gedicht behandelt werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Theodizeefrage, den Expressionismus, Alfred Lichtenstein, die Figur des Kuno Kohn, die "Fünf Marienlieder des Kuno Kohn", Außenseiter, Leid, Unterdrückung, Religion, Gottesbild, Gedichtanalyse, Formale Analyse, Inhaltliche Analyse, Kuno-Kohn-Zyklus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theodizeefrage?
Die Theodizeefrage beschäftigt sich mit der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids und des Bösen in der Welt: Wie kann ein gütiger Gott solches Leid zulassen?
Wie spiegelt sich die Theodizee im Expressionismus wider?
Durch die Erfahrung von Industrialisierung, Ich-Zerfall und den Schrecken des Ersten Weltkriegs wurde die traditionelle Gottesvorstellung radikal infrage gestellt, was oft in apokalyptischen Bildern mündete.
Wer ist die Figur „Kuno Kohn“ bei Alfred Lichtenstein?
Kuno Kohn ist ein Außenseiter und das Alter Ego des Autors. Er verkörpert das Leid, die Hässlichkeit und die Unterdrückung des Individuums in einer sinnentleerten Welt.
Was thematisieren die „Fünf Marienlieder des Kuno Kohn“?
Sie verknüpfen religiöse Motive (Maria) mit profanen, oft grotesken oder leidvollen Erfahrungen und zeigen die Diskrepanz zwischen göttlichem Ideal und menschlicher Misere.
Welchen Einfluss hatte der Erste Weltkrieg auf die expressionistische Lyrik?
Die anfängliche Kriegseuphorie wich schnell der Erkenntnis totaler Grausamkeit, was zu einer verstärkten Beschäftigung mit Tod, Verfall und der Abwesenheit göttlichen Eingreifens führte.
- Quote paper
- Vicky Boever (Author), 2015, Die Theodizeefrage im Expressionismus erläutert anhand von Alfred Liechtensteins "Die fünf Marienlieder des Kuno Kohn", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292970