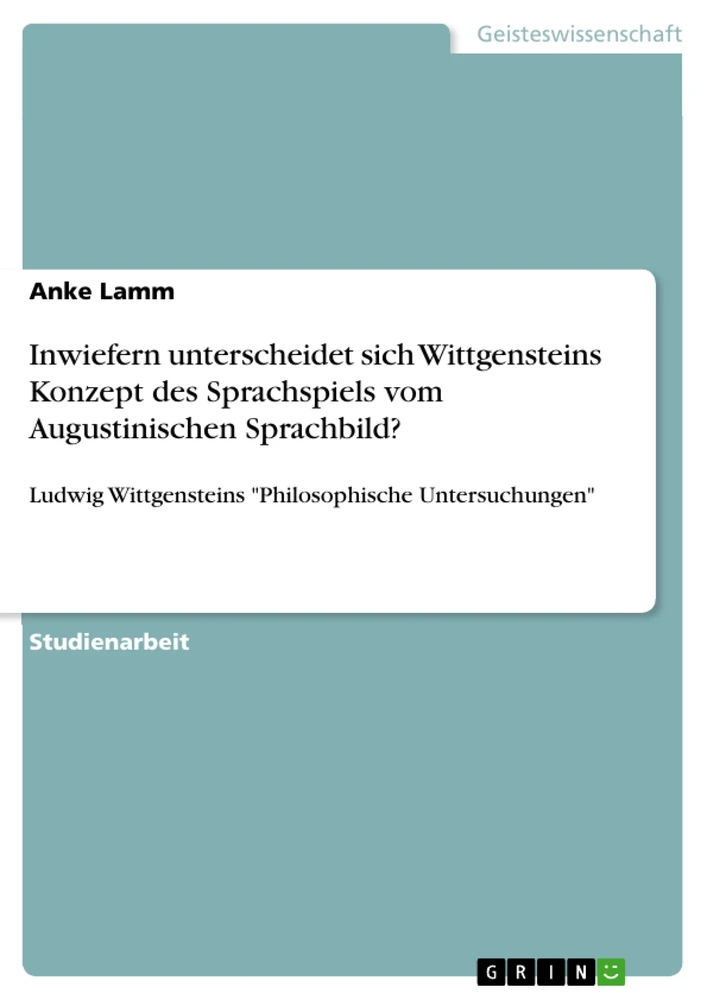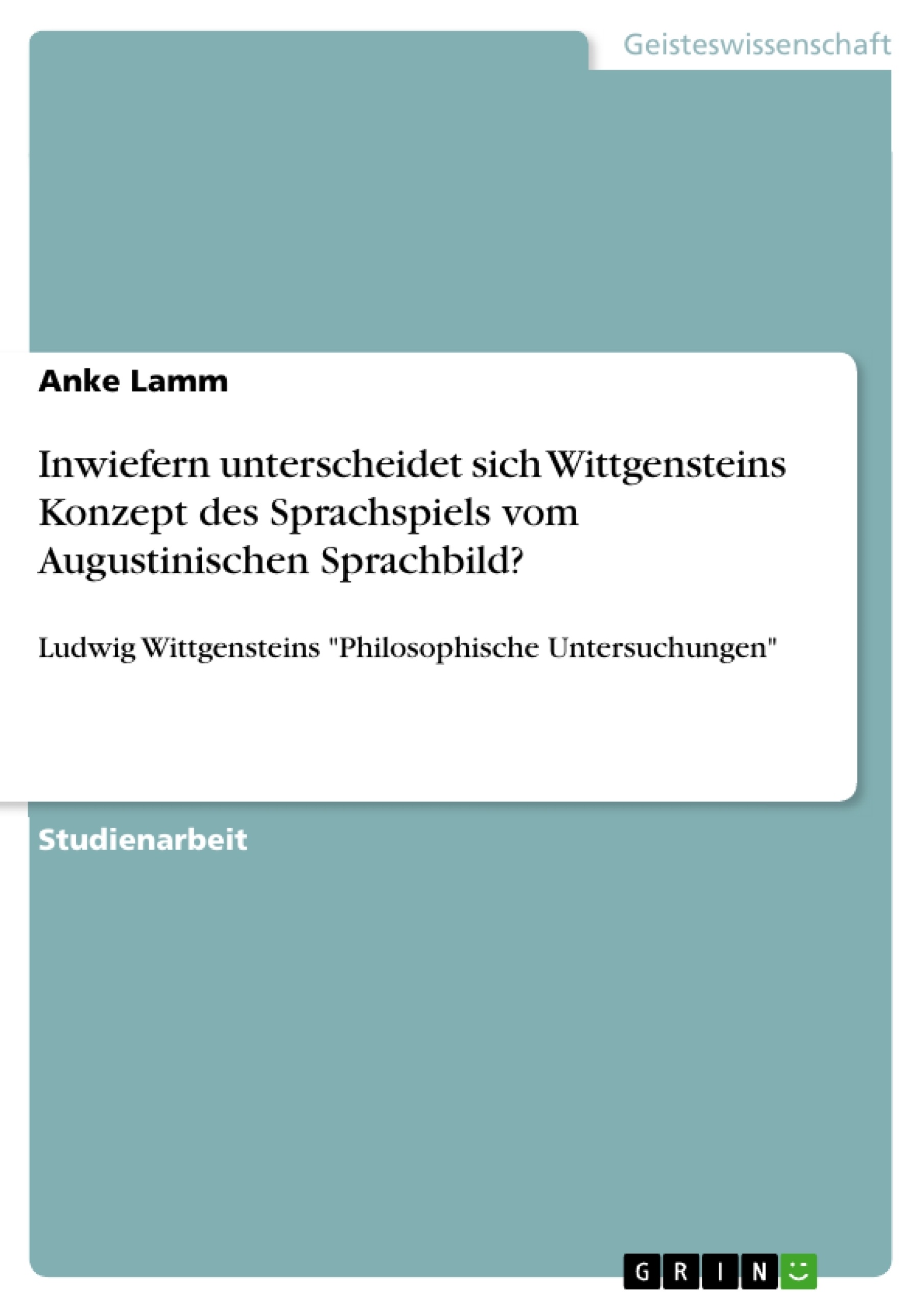Wittgenstein selbst erklärt das Sprachspiel in den ersten Paragraphen seiner Philosophischen Untersuchungen immer in Abgrenzung zum Augustinischen Bild der Sprache. Deswegen erscheint es sinnvoll sich genau diese Abgrenzungen und Unterschiede zu verdeutlichen um Wittgenstein zu verstehen. Die folgenden Ausführungen widmen sich deshalb in erster Linie den Paragraphen 1 bis 64 der Philosophischen Untersuchungen, denn hier wird der Begriff des Sprachspiels über das Aufzeigen eines unvollständigen Sprachbildes bei Augustinus entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SPRACHBILD BEI AUGUSTINUS
- SPRACHSPIEL BEI WITTGENSTEIN
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit Ludwig Wittgensteins Konzept des Sprachspiels und untersucht die Unterschiede zu Augustinus' Sprachbild. Ziel ist es, den Begriff des Sprachspiels zu verstehen und zu definieren, indem die Abgrenzung zu Augustinus' Vorstellung von Sprache aufgezeigt wird.
- Die Vorstellung von Sprache bei Augustinus
- Wittgensteins Kritik am Augustinischen Sprachbild
- Das Sprachspiel-Konzept bei Wittgenstein
- Der Unterschied zwischen Sprachbild und Sprachspiel
- Die Relevanz des Sprachspiel-Konzepts für die Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erklärt, warum Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“ eine besondere Herangehensweise an das Thema Sprache erfordern. Sie erklärt, dass Wittgenstein in seinen Arbeiten kein starres Konzept des Sprachspiels liefert, sondern es in Abgrenzung zum Augustinischen Sprachbild entwickelt.
- Sprachbild bei Augustinus: In diesem Kapitel wird das Sprachbild Augustinus vorgestellt, das auf der Vorstellung beruht, dass Sprache aus Wörtern besteht, die konkrete Gegenstände benennen. Der Prozess des Spracherwerbs wird erläutert und die zentrale Bedeutung von Hinweisen und Benennungen hervorgehoben.
- Sprachspiel bei Wittgenstein: Dieses Kapitel führt in Wittgensteins Kritik am Augustinischen Sprachbild ein und erklärt, wie er mit dem Konzept des Sprachspiels eine alternative Sichtweise auf Sprache präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Sprachphilosophie Wittgensteins und das Konzept des Sprachspiels. Wesentliche Themen sind das Augustinische Sprachbild, die Kritik an diesem Bild und die daraus resultierende Alternative, die das Sprachspiel darstellt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ludwig Wittgenstein unter einem "Sprachspiel"?
Ein Sprachspiel bezeichnet bei Wittgenstein die Einheit aus Sprache und den Handlungen, in die sie verwoben ist. Die Bedeutung eines Wortes ergibt sich aus seinem Gebrauch im Spiel.
Wie unterscheidet sich Wittgensteins Konzept vom Sprachbild des Augustinus?
Augustinus sieht Sprache als Benennung von Gegenständen. Wittgenstein kritisiert dies als unvollständig, da Sprache viel vielfältigere Funktionen als nur das reine Benennen hat.
Warum ist die Kritik am Augustinischen Sprachbild zentral?
Wittgenstein nutzt diese Abgrenzung in den "Philosophischen Untersuchungen", um aufzuzeigen, dass Sprache nicht durch ein starres System, sondern durch sozialen Gebrauch definiert wird.
Was spielt der Spracherwerb für eine Rolle?
Während Augustinus den Spracherwerb als das Lernen von Namen beschreibt, sieht Wittgenstein darin das Erlernen von Regeln innerhalb verschiedener sozialer Praktiken.
Welche Paragraphen der "Philosophischen Untersuchungen" sind hier wichtig?
Die Arbeit konzentriert sich primär auf die Paragraphen 1 bis 64, in denen Wittgenstein den Begriff des Sprachspiels systematisch entwickelt.
- Citar trabajo
- Master Anke Lamm (Autor), 2010, Inwiefern unterscheidet sich Wittgensteins Konzept des Sprachspiels vom Augustinischen Sprachbild?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292981