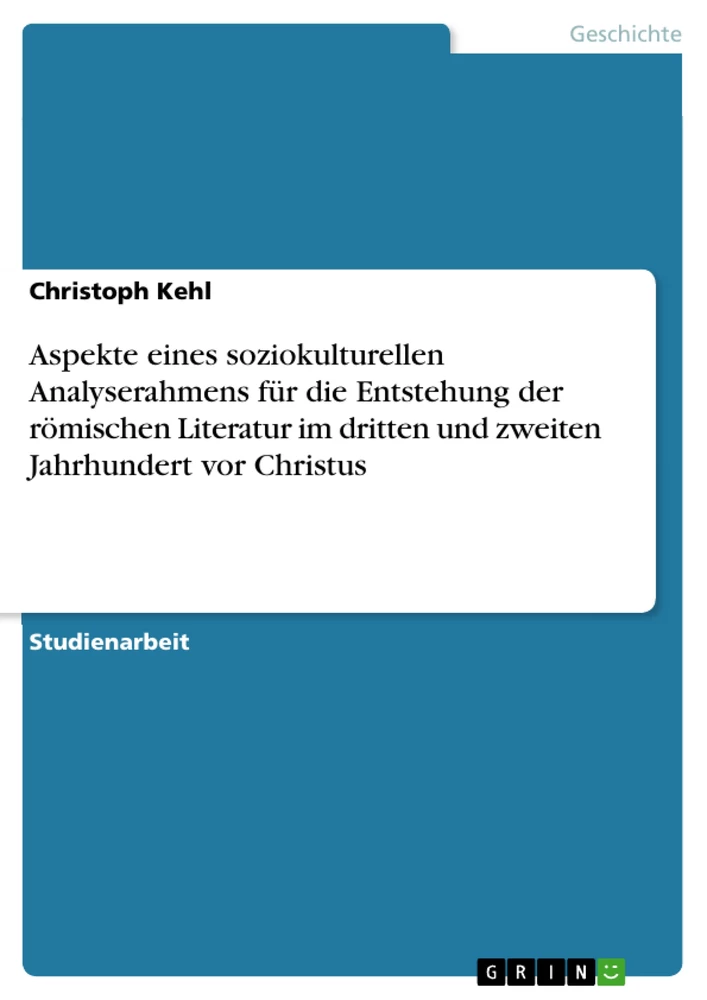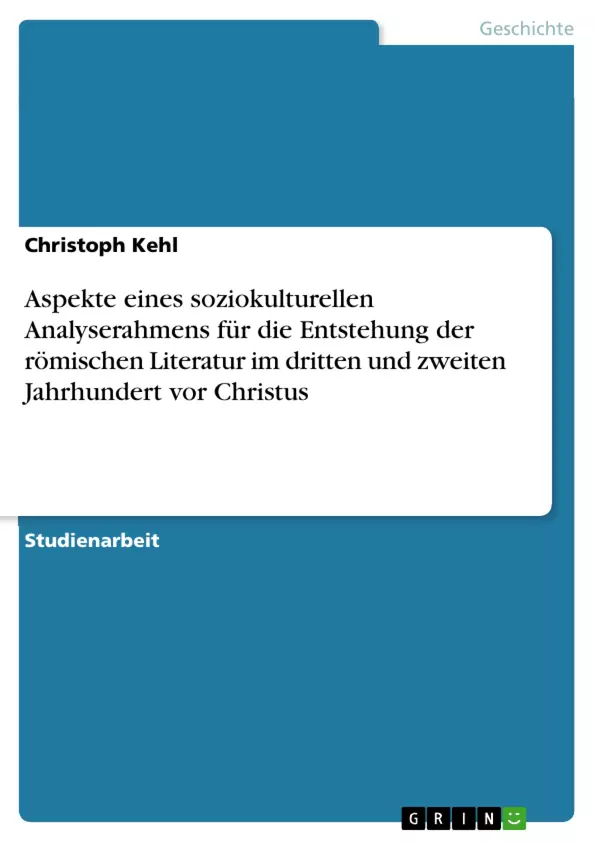Mit der Expansionswelle im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus steigt Rom zur Großmacht im Mittelmeerraum auf. Das Ausgreifen zunächst über die gesamte italische Halbinsel und ab 200 vor Christus auch auf das griechische beziehungsweise makedonischen Festland führt dazu, dass die Römer in immer engeren Kontakt zur griechisch-hellenistischen Kultur treten. Lange Zeit ging man in der Wissenschaft davon aus, dass der daraus resultierende kulturelle Austausch ausschlaggebend für die Herausbildung der römischen Literatur war.
Wissenschaftliche Erkenntnisse und vor allem Funde aus der Archäologie zeigen jedoch, dass zu dieser Zeit bereits seit mehr als 100 Jahren Kontakt zu griechischsprachigen Kulturen bestand. Durch Handel oder andere Formen sozialer Interaktion hätten die Römer viel früher Kenntnis von den kulturellen Leistungen ihrer Nachbarn nehmen müssen. Die überlieferten Quellen zeugen allerdings erst ab 240 vor Christus von einem Adaptionsprozess der griechisch-hellenistischen Literatur, der die folgenden Jahrzehnte prägt.
Um der Frage nachzugehen, warum sich gerade zu dieser Zeit eine Kunstform herausbildete, die bis heute tradiert und rezipiert wird, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, vor welchem soziokulturellen Hintergrund die Adaption der hellenistischen Literatur stattgefunden hat. Sofern es an einigen Stellen sinnvoll erscheint, werden politische Aspekte mit in die Ausführungen einfließen, sie werden jedoch keine zentrale Stellung einnehmen.
Anhand ausgewählter Biographien, Werk-, Epochen- und Gattungsmerkmalen sollen die gesellschaftlichen Umstände der Zeit analysiert und interpretiert werden. Der Untersuchungszeitraum beschränkt sich auf die Jahre von 240 – 146 vor Christus. Mit der Zerstörung Karthagos und dem Ende der Punischen Kriege bricht eine Zeit an, die sich nach Stimmung, Geiteshaltung und literarischer Produktion erheblich von den Vorjahren unterscheidet.
Aufgrund der fragmentarischen Quellenlage, bezogen sowohl auf einzelne Werke als auch auf die gesamte Epoche, können die folgenden Ansätze oftmals nur interpretativen Charakter erreichen. Um die historischen und vor allem sozialen Hintergründe rekonstruieren zu können, muss zumeist auf die literarischen Quellen selbst und deren Merkmale zurückgegriffen werden. Daher folgt in Kapitel 2 zunächst eine Skizze der relevanten Entwicklungsstufen beider Literaturen mit einigen Besonderheiten
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturgeschichtlicher Hintergrund
- Die hellenistische Literatur
- Die Entstehung der römischen Literatur im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus
- Soziokulturelle Analyse
- Die römische Gesellschaft im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus
- Soziale Ursachen der Herausbildung der römischen Literatur
- Die Rolle des Adels
- Staatliche und gesamtgesellschaftliche Aspekte der Literaturentwicklung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die soziokulturellen Bedingungen, die zur Entstehung der römischen Literatur im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus führten. Sie analysiert den Adaptionsprozess der hellenistischen Literatur in Rom und beleuchtet die gesellschaftlichen Umstände, die diese Entwicklung begünstigten.
- Die Rolle der hellenistischen Kultur im römischen Kontext
- Die Bedeutung des Adels für die Entwicklung der römischen Literatur
- Die gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die die Entstehung der römischen Literatur beeinflussten
- Die Adaption griechischer literarischer Formen und Inhalte durch die Römer
- Die Entwicklung der römischen Literatur im Kontext der römischen Expansion und der Begegnung mit anderen Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den historischen Kontext der Entstehung der römischen Literatur. Sie beleuchtet die Bedeutung des kulturellen Austauschs zwischen Rom und der hellenistischen Welt und stellt die These auf, dass die Adaption der hellenistischen Literatur durch soziale und politische Faktoren beeinflusst wurde.
Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die hellenistische Literatur und ihre Entwicklung. Es werden die wichtigsten Merkmale der hellenistischen Literatur, ihre Funktionen und ihre Bedeutung für die Entstehung der römischen Literatur dargestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die römische Gesellschaft im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus und untersucht die sozialen Ursachen der Herausbildung der römischen Literatur. Es werden die Rolle des Adels, die staatlichen und gesamtgesellschaftlichen Aspekte der Literaturentwicklung sowie die Bedeutung der römischen Expansion für die Entstehung der römischen Literatur beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Entstehung der römischen Literatur, die hellenistische Literatur, die römische Gesellschaft im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus, die Rolle des Adels, die staatlichen und gesamtgesellschaftlichen Aspekte der Literaturentwicklung sowie die Adaption griechischer literarischer Formen und Inhalte durch die Römer.
Häufig gestellte Fragen
Wann entstand die erste römische Literatur?
Ein gezielter Adaptionsprozess der griechisch-hellenistischen Literatur ist in Rom ab etwa 240 v. Chr. nachweisbar.
Welchen Einfluss hatte der römische Adel auf die Literatur?
Der Adel spielte eine zentrale Rolle als Förderer und Auftraggeber, da Literatur als Mittel zur Repräsentation und zur Festigung des sozialen Status genutzt wurde.
Warum dauerte es so lange, bis Rom die griechische Literatur übernahm?
Obwohl Kontakte schon lange bestanden, fehlte zuvor der soziokulturelle Bedarf. Erst mit der Expansion zur Großmacht entstand das Bedürfnis nach einer eigenen, anspruchsvollen Kunstform.
Was war der zeitliche Rahmen der Untersuchung?
Die Analyse konzentriert sich auf die Jahre 240 bis 146 v. Chr., also von den Anfängen bis zur Zerstörung Karthagos am Ende der Punischen Kriege.
Welche Rolle spielten politische Aspekte bei der Literaturentstehung?
Politische Faktoren wie die Expansion im Mittelmeerraum schufen die Rahmenbedingungen für den kulturellen Austausch, doch die sozialen Ursachen innerhalb der römischen Gesellschaft waren ausschlaggebend.
- Quote paper
- Christoph Kehl (Author), 2012, Aspekte eines soziokulturellen Analyserahmens für die Entstehung der römischen Literatur im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292982