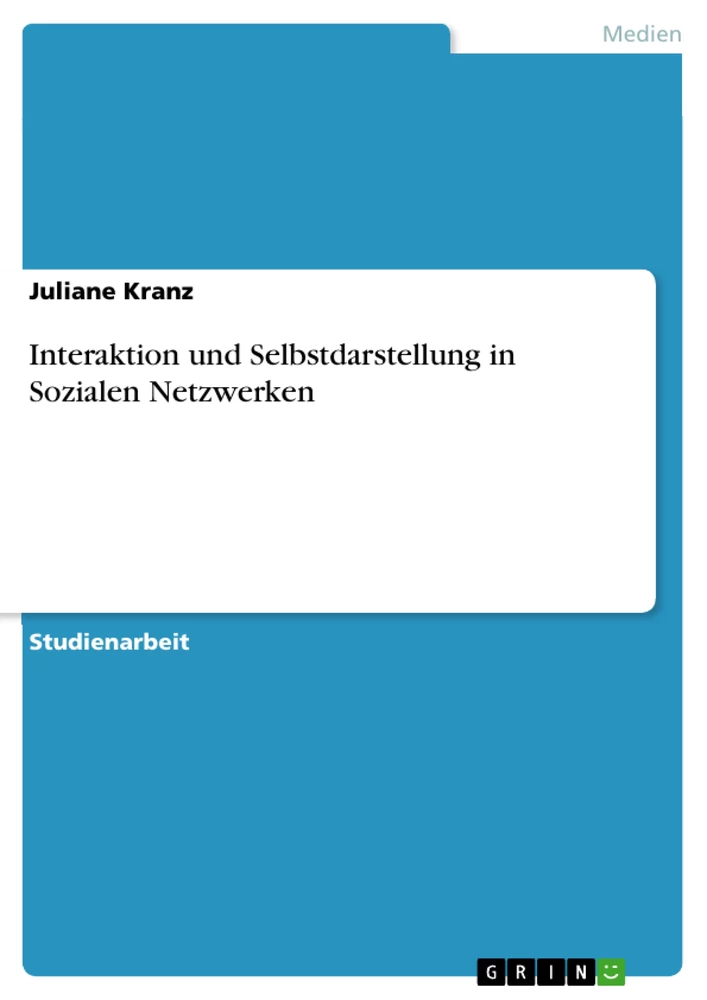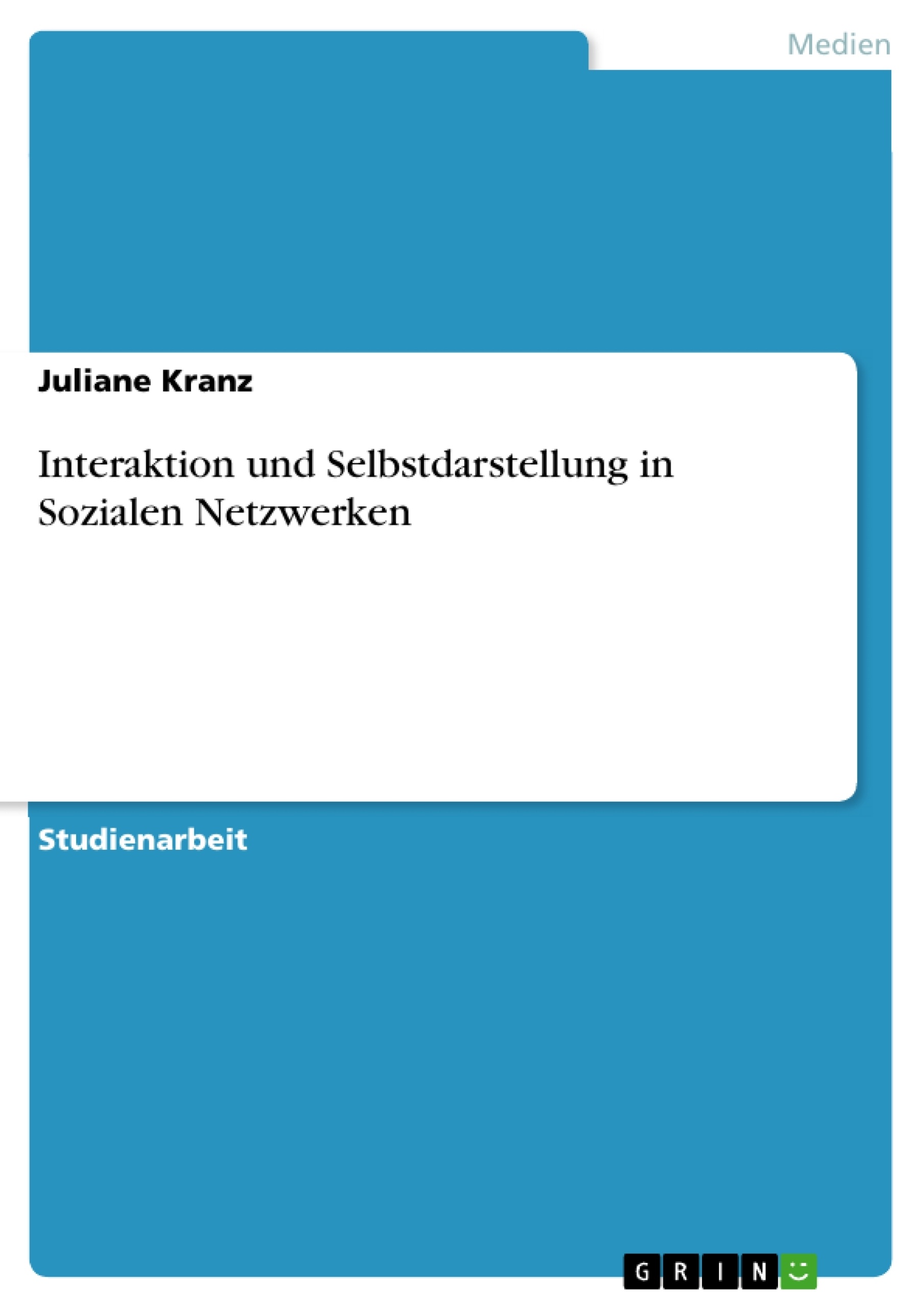In der vorliegenden Arbeit soll auf der Grundlage der mikrosoziologischen Theorien Goffmans untersucht werden, ob sich tägliche Interaktionen heute tatsächlich nur noch auf die eingleisige Bühne des Lebens reduzieren lassen, oder die damals postulierte Theatermetapher moduliert werden muss, um gegenwärtig Anwendung zu finden.
Nach einer kurzen biografischen Vorstellung von Erving Goffman, folgt eine kurze Erläuterung seines dramaturgischen Ansatzes und dessen Soziologische Relevanz. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Interaktion nach Goffman näher erläutert und im Anschluss geprüft, ob und inwiefern der Interaktionsbegriff an die Möglichkeiten und Gegebenheiten auf der Online-Plattform Facebook modifiziert werden muss. Darauffolgend steht das Modell der Theatermetapher im Zentrum der Ausführungen. In Kapitel drei werden die theoretischen Grundgedanken im Hinblick auf die soziale Welt als Bühne im Goffmanschen Sinne erläutert, und damit im Zusammenhang stehende, wichtige Begriffe näher definiert. Im Anschluss daran folgt der zentrale Teil dieser Arbeit: die Übertragung der Theatermetapher auf das Online-Netzwerk Facebook.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erving Goffman
- Biographie
- Der dramaturgische Ansatz nach Goffman
- Soziale Situation und Interaktion nach Goffman
- Die soziale Situation als virtuelle Umgebung
- Facebook als Soziales Netzwerk
- Facebook als Soziale Interaktion – Die Erweiterung der Goffman-Theorie
- Interaktionsmöglichkeiten auf Facebook
- Theatermetapher - Wir alle spielen (Facebook) -Theater
- Der Theaterrahmen und seine Darsteller
- Facebook als Bühne
- Selbstdarstellung durch das Facebook-Profil
- Postings und Statusmeldungen
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Interaktion und Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Facebook, unter Anwendung des dramaturgischen Ansatzes nach Erving Goffman. Ziel ist es, die Relevanz der Goffmanschen Theorie für die Analyse von Online-Interaktionen zu untersuchen und zu beleuchten, inwiefern sich die Theatermetapher auf die virtuelle Welt übertragen lässt.
- Die Anwendung des dramaturgischen Ansatzes von Goffman auf Facebook
- Die Rolle der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken
- Die Interaktionsmöglichkeiten und -formen auf Facebook
- Die Auswirkungen von Facebook auf die soziale Interaktion
- Die Relevanz der Theatermetapher für die Analyse von Online-Interaktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken ein und stellt die Relevanz von Facebook als Plattform für Interaktion und Selbstdarstellung heraus. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Inwiefern lässt sich die Theatermetapher von Goffman auf die virtuelle Welt von Facebook übertragen?
Kapitel 1 bietet eine kurze Biografie von Erving Goffman und erläutert seinen dramaturgischen Ansatz. Dieser Ansatz betrachtet soziale Interaktionen als eine Art Theaterstück, in dem Individuen verschiedene Rollen spielen und versuchen, ein bestimmtes Bild von sich selbst zu präsentieren.
Kapitel 2 erweitert den Begriff der Interaktion nach Goffman auf die virtuelle Umgebung von Facebook. Es wird untersucht, inwiefern sich die Interaktionsformen und -möglichkeiten in der Online-Welt von den traditionellen Interaktionen unterscheiden.
Kapitel 3 beleuchtet die Theatermetapher im Detail und erklärt die zentralen Begriffe wie "Theaterrahmen" und "Darsteller" im Kontext der Goffmanschen Theorie.
Kapitel 4 analysiert Facebook als Bühne für Selbstdarstellung. Es werden die Möglichkeiten der Selbstdarstellung durch das Facebook-Profil und die Nutzung von Postings und Statusmeldungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den dramaturgischen Ansatz, die Selbstdarstellung, die Interaktion, soziale Netzwerke, Facebook, Goffman, Theatermetapher, virtuelle Umgebung, Online-Interaktion, Profil, Postings, Statusmeldungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie lässt sich Goffmans Theatermetapher auf Facebook übertragen?
Facebook dient als virtuelle Bühne, auf der das Profil die Kulisse bildet und Postings die Inszenierung des eigenen Selbst darstellen.
Was bedeutet „Selbstdarstellung“ in sozialen Netzwerken?
Individuen spielen Rollen, um ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln, wobei Facebook die Kontrolle über diesen Eindruck durch Profileinstellungen erleichtert.
Was ist der „dramaturgische Ansatz“ nach Erving Goffman?
Dieser Ansatz betrachtet soziale Interaktionen als Theateraufführungen, bei denen Akteure versuchen, ihr Publikum zu beeinflussen.
Wie verändert Facebook die soziale Interaktion?
Die Arbeit zeigt auf, dass Online-Interaktionen die klassischen Begriffe von Raum und Situation erweitern und neue Formen der Selbstdarstellung ermöglichen.
Was sind die zentralen Begriffe der Goffman-Theorie im Kontext Facebook?
Zentrale Begriffe sind Theaterrahmen, Darsteller, Bühne und die soziale Situation als virtuelle Umgebung.
- Arbeit zitieren
- Juliane Kranz (Autor:in), 2014, Interaktion und Selbstdarstellung in Sozialen Netzwerken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293046