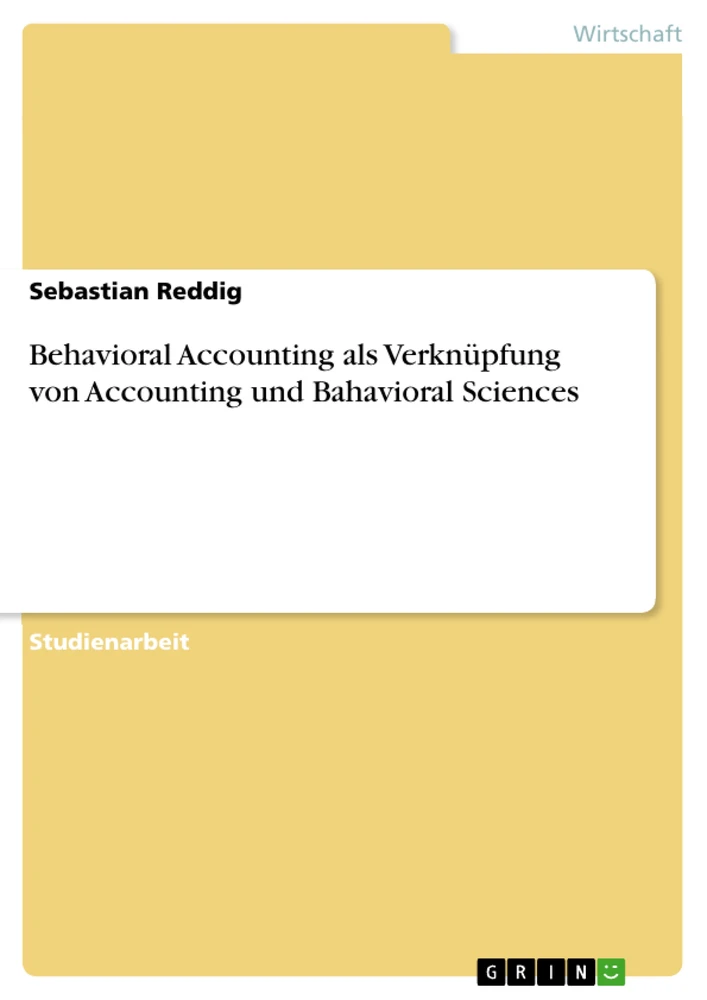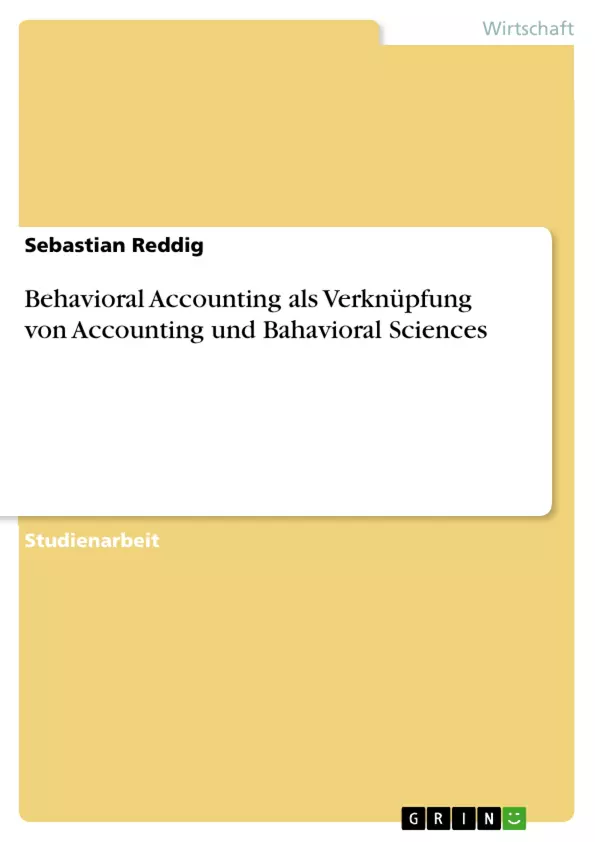Anfangs wurde das Accounting, die englische Bezeichnung für das Rechnungswesen, als Fremdkörper in der Wissenschaft betrachtet. In den letzten Jahrzehnten jedoch haben Forschungsbemühungen im Bereich des Rechnungswesens kontinuierlich zugenommen und diese Problematik wurde zu einem anerkannten Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre. Inzwischen ist das Accounting als eine Wissenschaft mit diversen Modellen und Instrumenten anerkannt. Eine Weiterentwicklung dieser Forschungsthematik ist das Behavioral Accounting, was seit den 1960er Jahren vorwiegend in der angloamerikanischen Betriebswirtschaftslehre Gegenstand von Forschungsaktivitäten ist. Die konventionelle Aufgabe des Rechnungswesens ist die Versorgung mit relevanten und aktuellen Informationen über die finanziellen Aktivitäten eines Unternehmens, um interne und externe Adressaten bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dabei konzentriert sich das zahlengetriebene Accounting lediglich auf die Bereitstellung finanzieller Informationen. Im Laufe der Zeit wurde den Entscheidungsträgern im Unternehmen klar, dass die rein quantitative Betrachtung von Sachverhalten zum Treffen von fundierten Entscheidungen nicht ausreicht. Manager und Buchhalter verlangen zunehmend nach zusätzlichen nichtbilanziellen Informationen. Aus diesem Sachverhalt heraus entstand die verhaltensorientierte Rechnungswesenforschung (Behavioral Accounting), welche das menschliche Verhalten und dessen Auswirkungen auf das Rechnungswesen bzw. die Auswirkungen des Rechnungswesens auf das menschliche Verhalten untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den aktuellen Stand der Literatur sowie die Charakteristik des Behavioral Accounting herauszuarbeiten, um anschließend die Unterschiede dieses Ansatzes im Vergleich zum traditionellen Accounting aufzuzeigen. Für ein besseres Verständnis soll dem Leser zu Beginn das Accounting mit seinen Wesensmerkmalen vorgestellt und erläutert werden (Kapitel 2). Daran anschließend werden die Verbindungen zu den Behavioral Sciences, die Notwendigkeit zur Herausbildung einer neuen Forschungsdisziplin sowie wesentliche Aufgaben und Kernbereiche des Behavioral Accounting dargestellt (Kapitel 3). Die Ausführungen schließen mit einem Fazit, in dem die Unterschiede dieser beiden Forschungsdisziplinen herausgestellt werden (Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Ziel der Arbeit
- Theoretische Grundlagen des Accounting
- Definition Accounting
- Systematisierung und Adressaten des Rechnungswesens
- Aufgaben und Funktionen des Accounting
- Entscheidungstheorie und Prämissen des Homo Oeconomicus
- Verknüpfung des Accounting mit den Behavioral Sciences
- Behavioral Sciences als Wurzeln des Behavioral Accounting
- Notwendigkeit, Definition und Aufgaben des Behavioral Accounting
- Kernbereiche der Behavioral Accounting-Forschung und deren Inhalte
- Behavioral Financial Accounting
- Behavioral Tax Accounting
- Behavioral Management Accounting
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel der Arbeit ist es, den aktuellen Stand der Literatur sowie die Charakteristik des Behavioral Accounting herauszuarbeiten, um anschließend die Unterschiede dieses Ansatzes im Vergleich zum traditionellen Accounting aufzuzeigen. Dabei werden die grundlegenden Konzepte des Accounting und seine Verknüpfung mit den Behavioral Sciences untersucht.
- Das traditionelle Accounting und seine Funktionen
- Die Entstehung und Relevanz des Behavioral Accounting
- Die Kernbereiche der Behavioral Accounting-Forschung
- Die Unterschiede zwischen traditionellem Accounting und Behavioral Accounting
- Die Bedeutung des Behavioral Accounting für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen des Accounting
Dieses Kapitel stellt die grundlegenden Konzepte des Accounting vor, darunter die Definition des Accounting, die Systematisierung und die verschiedenen Adressaten des Rechnungswesens. Außerdem werden die Aufgaben und Funktionen des Accounting sowie die Entscheidungstheorie und die Prämissen des Homo Oeconomicus behandelt.
Kapitel 3: Verknüpfung des Accounting mit den Behavioral Sciences
In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen dem Accounting und den Behavioral Sciences beleuchtet. Es werden die Wurzeln des Behavioral Accounting, seine Notwendigkeit und seine wesentlichen Aufgaben und Kernbereiche dargestellt.
Schlüsselwörter
Behavioral Accounting, Rechnungswesen, Behavioral Sciences, Financial Accounting, Management Accounting, Tax Accounting, Entscheidungstheorie, Homo Oeconomicus, Informationsbedürfnisse, Adressaten, Funktionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Behavioral Accounting?
Behavioral Accounting (verhaltensorientiertes Rechnungswesen) untersucht das menschliche Verhalten im Zusammenhang mit Buchhaltungsinformationen und wie diese Informationen Entscheidungen beeinflussen.
Wie unterscheidet es sich vom traditionellen Accounting?
Traditionelles Accounting ist zahlengetrieben und quantitativ. Behavioral Accounting bezieht psychologische Faktoren und nichtbilanzielle Informationen in die Analyse ein.
Was ist der „Homo Oeconomicus“?
Ein theoretisches Modell eines rein rational handelnden Menschen. Behavioral Accounting kritisiert dieses Modell und zeigt, dass Menschen oft irrational oder subjektiv entscheiden.
Was sind die Kernbereiche des Behavioral Accounting?
Dazu gehören Behavioral Financial Accounting (Anlegerverhalten), Behavioral Management Accounting (Kontrolle und Motivation) und Behavioral Tax Accounting (Steuermoral).
Warum ist dieser Ansatz für Manager wichtig?
Er hilft Managern zu verstehen, wie Budgetvorgaben oder Berichte das Verhalten der Mitarbeiter beeinflussen, um Fehlsteuerungen im Unternehmen zu vermeiden.
- Citation du texte
- Sebastian Reddig (Auteur), 2014, Behavioral Accounting als Verknüpfung von Accounting und Bahavioral Sciences, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293105