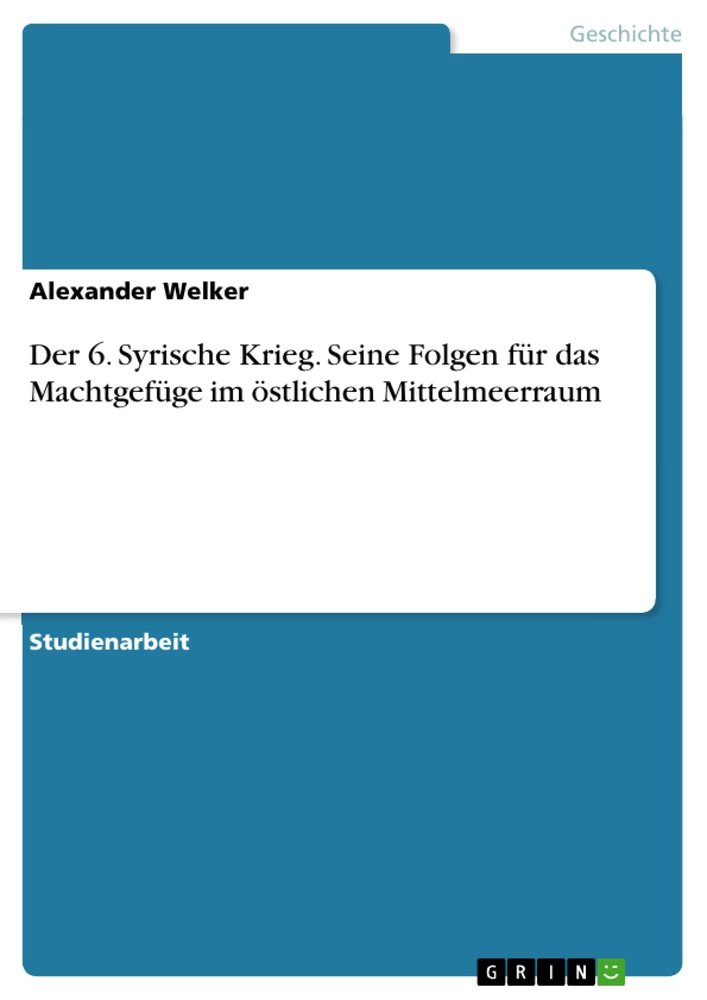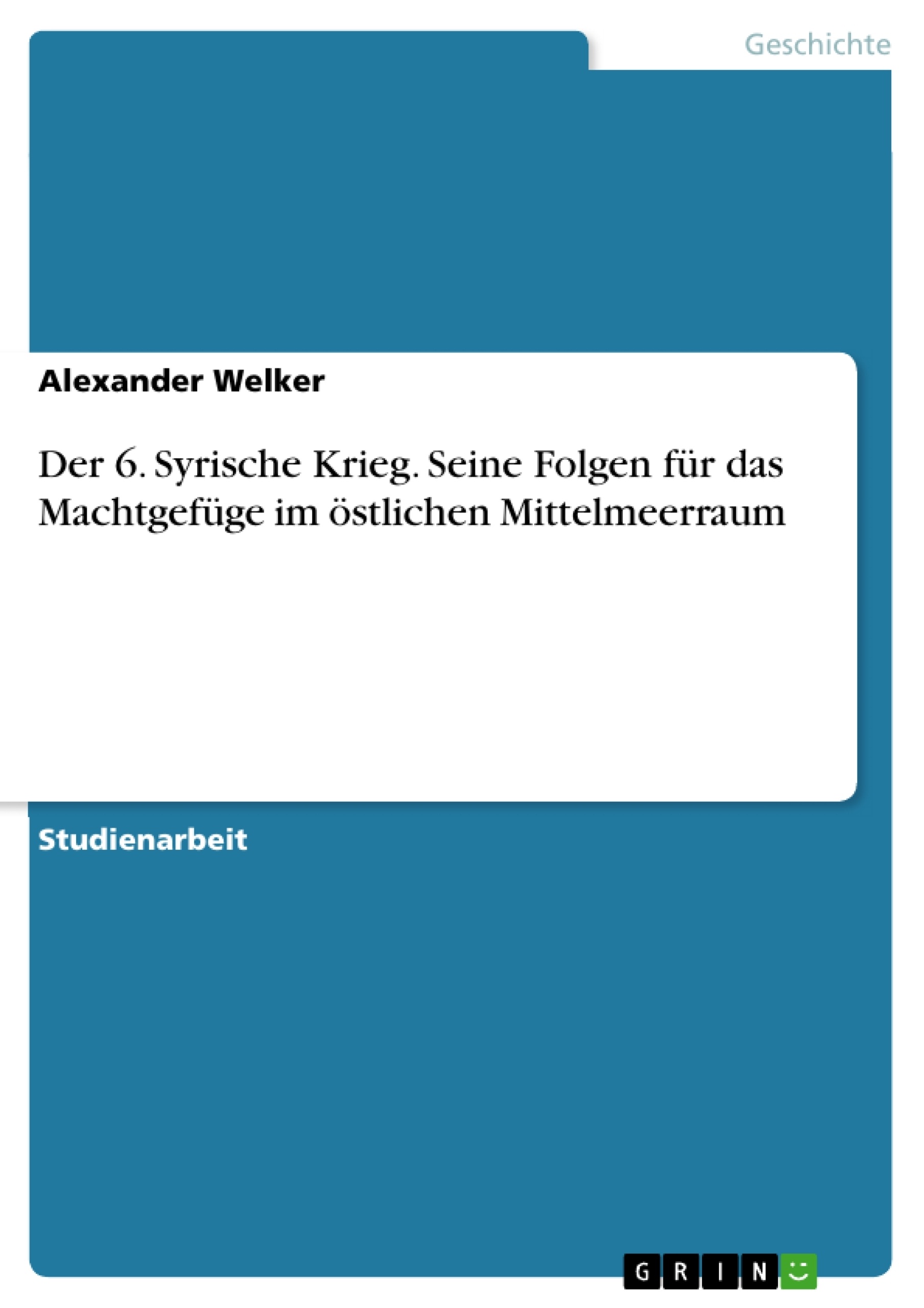Innerhalb einer Zeitspanne von etwas mehr als einhundert Jahren im zweiten und dritten vor-christlichen Jahrhundert haben das ptolemäische Ägypten und das Seleukidenreich eine Reihe von Kriegen ausgefochten, die in der modernen Forschungsliteratur als Syrische Kriege bezeichnet werden. Der sechste und letzte Syrische Krieg, der in den Jahren 170/169 v. Chr. bis 168 v. Chr. stattfand, wurde zwischen einem wechselnden ptolemäischen Regiment und dem Seleukidenkönig Antiochos IV. ausgetragen.
Die kriegerische Auseinandersetzung wurde von den Ptolemäern mit dem Ziel provoziert, das ehemals ägyptische strategisch bedeutsame Koilesyrien, das im 5. Syrischen Krieg (202 v. Chr. – 195 v. Chr.) an die Seleukiden abgetreten werden musste, zurückzuerobern.
Ähnlich wie beim 5. Syrischen Krieg, wurde der 6. Syrische Krieg von dem 3. Makedonischen Krieg, einer erneuten militärischen Auseinandersetzung zwischen Rom und Makedonien unter König Perseus, begleitet.
Obwohl der römische Staat einen eigenen Krieg ausgefochten hat, war dieser im letzten Syrischen Krieg konstant involviert. Durch Gesandtschaften versuchten die beiden hellenistischen Kriegsparteien die Gunst Roms und dessen Unterstützung für sich zu gewinnen. Geleitet von einer machiavellistisch eingestellten Außenpolitik hat der römische Senat keine eindeutige Partei in dem ägyptisch-syrischen Konflikt ergriffen. Jede Konfrontation zwischen hellenistischen Großreichen, in denen diese ihre Kräfte aufrieben und sich gegenseitig schwächten, war Rom höchst gelegen, besonders zum Zeitpunkt der makedonischen Bedrohung.
Der durch zahlreiche antike Autoren berühmt gewordene „Tag von Eleusis“ markierte das Ende des 6. Syrischen Krieges; überhaupt erst möglich geworden durch den römischen Sieg über Perseus bei Pydna. Durch den Sieg über Makedonien hat sich Rom endgültig als die dominierende Macht im östlichen Mittelmeerraum durchgesetzt, während die beiden hellenistischen Mächte Ägypten und das Seleukidenreich durch Eleusis in eine noch stärkere Abhängigkeit und Fügsamkeit gegenüber Rom gerieten.
Die vorliegende Arbeit ist so gegliedert, dass zunächst auf die Vorgeschichte und den Ausbruch des 6. Syrischen Krieges eingegangen werden soll, wobei hier der ptolemäische Staat im Vordergrund stehen wird. Danach sollen die beiden ägyptischen Feldzüge des Antiochos IV. Epiphanes geschildert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der 6. Syrische Krieg (170/169 v. Chr. – 168 v. Chr.)
- Die Vorgeschichte und Ausbruch des Krieges
- Der erste ägyptische Feldzug des Antiochos IV. Epiphanes
- Der zweite ägyptische Feldzug des Antiochos IV. Epiphanes
- Die politischen Folgen des Tages von Eleusis
- Die politischen Folgen von Eleusis für das ptolemäische Regiment und das Ptolemäerreich
- Die politischen Folgen von Eleusis für Antiochos IV. Epiphanes und das Seleukidenreich
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem 6. Syrischen Krieg (170/169 v. Chr. – 168 v. Chr.), der zwischen dem ptolemäischen Ägypten und dem Seleukidenreich unter Antiochos IV. Epiphanes ausgetragen wurde. Ziel ist es, die Vorgeschichte und den Ausbruch des Krieges zu beleuchten, die beiden ägyptischen Feldzüge des Antiochos IV. Epiphanes zu schildern und die politischen Folgen des Krieges für beide Seiten zu analysieren. Dabei soll insbesondere die Rolle Roms im Kontext des 3. Makedonischen Krieges und die Auswirkungen des Tages von Eleusis auf das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum untersucht werden.
- Die Vorgeschichte und der Ausbruch des 6. Syrischen Krieges
- Die beiden ägyptischen Feldzüge des Antiochos IV. Epiphanes
- Die politischen Folgen des Tages von Eleusis für das ptolemäische Regiment und das Ptolemäerreich
- Die politischen Folgen des Tages von Eleusis für Antiochos IV. Epiphanes und das Seleukidenreich
- Die Rolle Roms im 3. Makedonischen Krieg und die Auswirkungen auf das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des 6. Syrischen Krieges ein und stellt den historischen Kontext sowie die Bedeutung des Krieges für das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum dar. Das erste Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte des Krieges, die mit dem Tod des Ptolemaios V. Epiphanes im Jahr 180 v. Chr. beginnt. Es werden die politischen und militärischen Ereignisse, die zum Ausbruch des Krieges führten, sowie die Rolle der beteiligten Akteure, insbesondere der ptolemäischen Regenten und des Seleukidenkönigs Antiochos IV. Epiphanes, analysiert. Das zweite Kapitel widmet sich den beiden ägyptischen Feldzügen des Antiochos IV. Epiphanes, die im Verlauf des Krieges stattfanden. Es werden die militärischen Strategien, die Schlachten und die politischen Hintergründe der Feldzüge beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den politischen Folgen des Tages von Eleusis, der den 6. Syrischen Krieg beendete. Es werden die Auswirkungen des Krieges auf das ptolemäische Regiment und das Ptolemäerreich, sowie auf Antiochos IV. Epiphanes und das Seleukidenreich, untersucht. Dabei wird auch die Rolle Roms im Kontext des 3. Makedonischen Krieges und die Auswirkungen des Tages von Eleusis auf das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den 6. Syrischen Krieg, das ptolemäische Ägypten, das Seleukidenreich, Antiochos IV. Epiphanes, Koilesyrien, der Tag von Eleusis, der 3. Makedonische Krieg, Rom, das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum, politische Folgen, militärische Strategien, Feldzüge, historische Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Hauptbeteiligten im 6. Syrischen Krieg?
Der Krieg wurde zwischen dem ptolemäischen Ägypten und dem Seleukidenreich unter König Antiochos IV. Epiphanes ausgetragen.
Was war der Anlass für den Ausbruch des Krieges?
Die Ptolemäer provozierten den Konflikt mit dem Ziel, das strategisch wichtige Koilesyrien zurückzuerobern.
Was bedeutet der "Tag von Eleusis"?
Er markiert das Ende des Krieges, als Rom durch eine Gesandtschaft den Seleukidenkönig Antiochos IV. ultimativ zum Rückzug aus Ägypten zwang.
Welche Rolle spielte Rom in diesem Konflikt?
Rom agierte als dominierende Macht im Hintergrund, verfolgte eine machiavellistische Außenpolitik und nutzte den Sieg über Makedonien, um seinen Einfluss im Osten zu festigen.
Welche politischen Folgen hatte der Krieg für die hellenistischen Reiche?
Sowohl Ägypten als auch das Seleukidenreich gerieten in eine stärkere Abhängigkeit und Fügsamkeit gegenüber dem römischen Staat.
- Citation du texte
- Alexander Welker (Auteur), 2014, Der 6. Syrische Krieg. Seine Folgen für das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293208