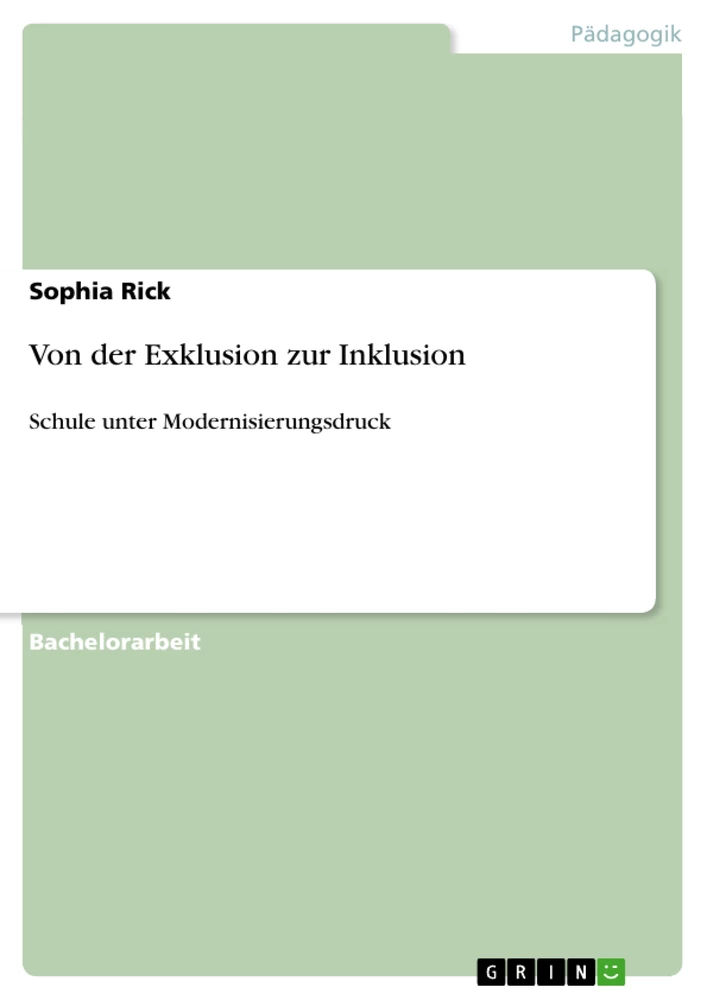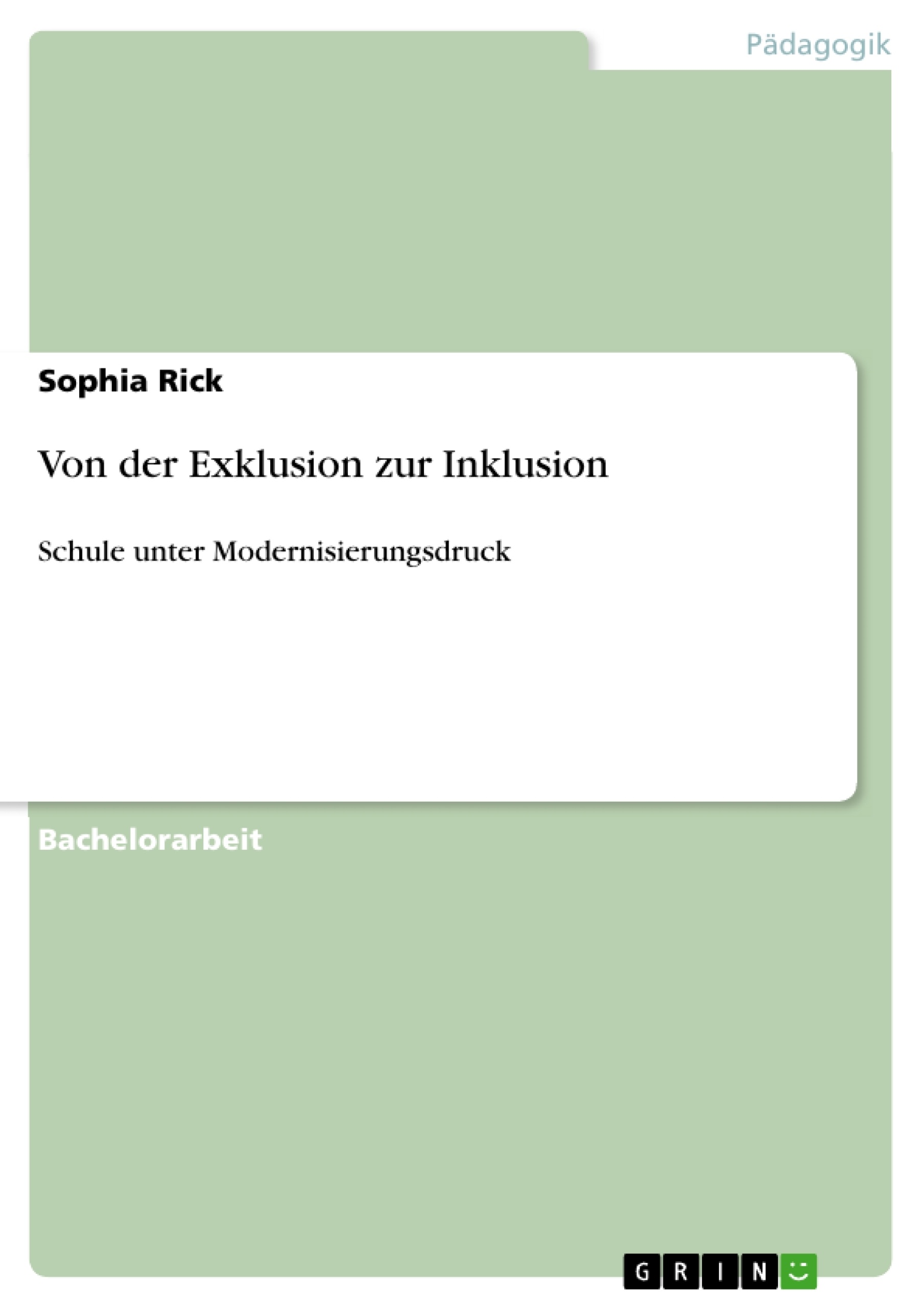Nach der Salamanca-Erklärung zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse im Jahre 1994 fordern die Staaten der vereinten Nationen erstmals, die Erziehung behinderter Personen als festen Bestandteil des Schulsystems umzusetzen. Als Argumente dafür werden unter anderem das Menschenrecht für Alle auf Bildung, „unabhängig von individuellen Unterschieden“ und die „Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ genannt (Salamanca Erklärung, 1994).
Im Dezember 2006 wurde darauf aufbauend auf der UN-Behindertenrechts-konvention ein „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ verabschiedet, indem es nun in Art. 1 lautet: „Dass (…) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden“ und „gleichberechtigt mit anderen in einer Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“.
Daraufhin änderte der Stadtstaat Hamburg sein Schulgesetz und formulierte den § 12 neu, dessen Absatz 1 von nun an besagt: „Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen (...)“ (Hamburgisches Schulgesetz, 2014)
Damit war die große Debatte um die Inklusion an allgemeinbildenden Schulen erwacht.
Doch was bedeutet eigentlich Inklusion?
Welche Rolle spielt Exklusion dabei?
Können die Schulen dem Anspruch der Inklusion gerecht werden?
Findet Inklusion wirklich statt? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Exklusion und Inklusion in der Gesellschaft
- Die segmentäre und die stratifizierte Gesellschaft
- Die funktional differenzierte Gesellschaft
- Von der Exklusion zur Inklusion im Bildungssystem
- Schulische Inklusion
- Aktuelle Zahlen
- Heterogenität in der Schule
- Die „gute" Schule
- Ausblick: Voraussetzungen für inklusiven Unterricht
- Die Professionalisierung des Lehrers
- Pädagogische Diagnostik
- Strukturelle Voraussetzungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Bedeutung von Exklusion und Inklusion im Bildungssystem, insbesondere im Kontext der schulischen Inklusion. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Einführung der Inklusion an allgemeinbildenden Schulen ergeben, und beleuchtet die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gelingen. Die Arbeit verbindet dabei soziologische und erziehungswissenschaftliche Perspektiven.
- Historische Entwicklung von Exklusion und Inklusion in verschiedenen Gesellschaften
- Herausforderungen und Chancen der schulischen Inklusion
- Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gelingen der Inklusion
- Die Rolle der Heterogenität in der Schule
- Die Bedeutung der Professionalisierung von Lehrkräften für die Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle Debatte um die Inklusion an allgemeinbildenden Schulen einleitet und die zentralen Fragestellungen der Arbeit formuliert. Anschließend wird im ersten Teil der Arbeit der soziologische Kontext von Exklusion und Inklusion beleuchtet. Hierbei wird auf die Theorie von Niklas Luhmann eingegangen, der die Entwicklung und Bedeutung von Inklusion und Exklusion in verschiedenen Gesellschaften analysiert. Der Fokus liegt dabei auf der funktional differenzierten Gesellschaft und der Rolle des Bildungssystems in diesem Kontext.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der schulischen Inklusion. Hier werden aktuelle Zahlen und Statistiken zur Inklusion in Deutschland und Hamburg vorgestellt. Anschließend wird das Thema Heterogenität in der Schule behandelt und die Frage erörtert, was eine „gute Schule“ sein könnte und welche Rolle Inklusion dabei spielt.
Im dritten Teil der Arbeit werden die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gelingen der Inklusion beleuchtet. Hier werden die Professionalisierung von Lehrkräften, die Bedeutung der pädagogischen Diagnostik und die strukturellen Voraussetzungen für inklusiven Unterricht diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Begriffe Exklusion, Inklusion, Schulsystem, Bildung, Heterogenität, Inklusion, Professionalisierung, pädagogische Diagnostik, strukturelle Voraussetzungen, Modernisierung, Gesellschaft, funktional differenzierte Gesellschaft, Salamanca-Erklärung, UN-Behindertenrechtskonvention, Hamburgisches Schulgesetz.
- Citar trabajo
- Sophia Rick (Autor), 2014, Von der Exklusion zur Inklusion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293280