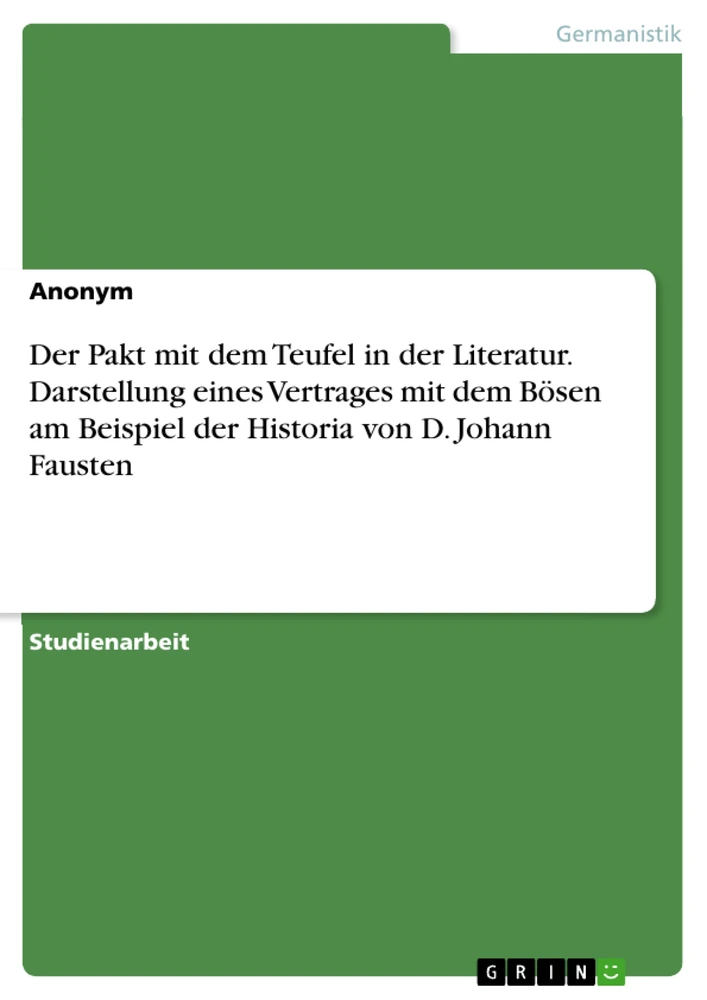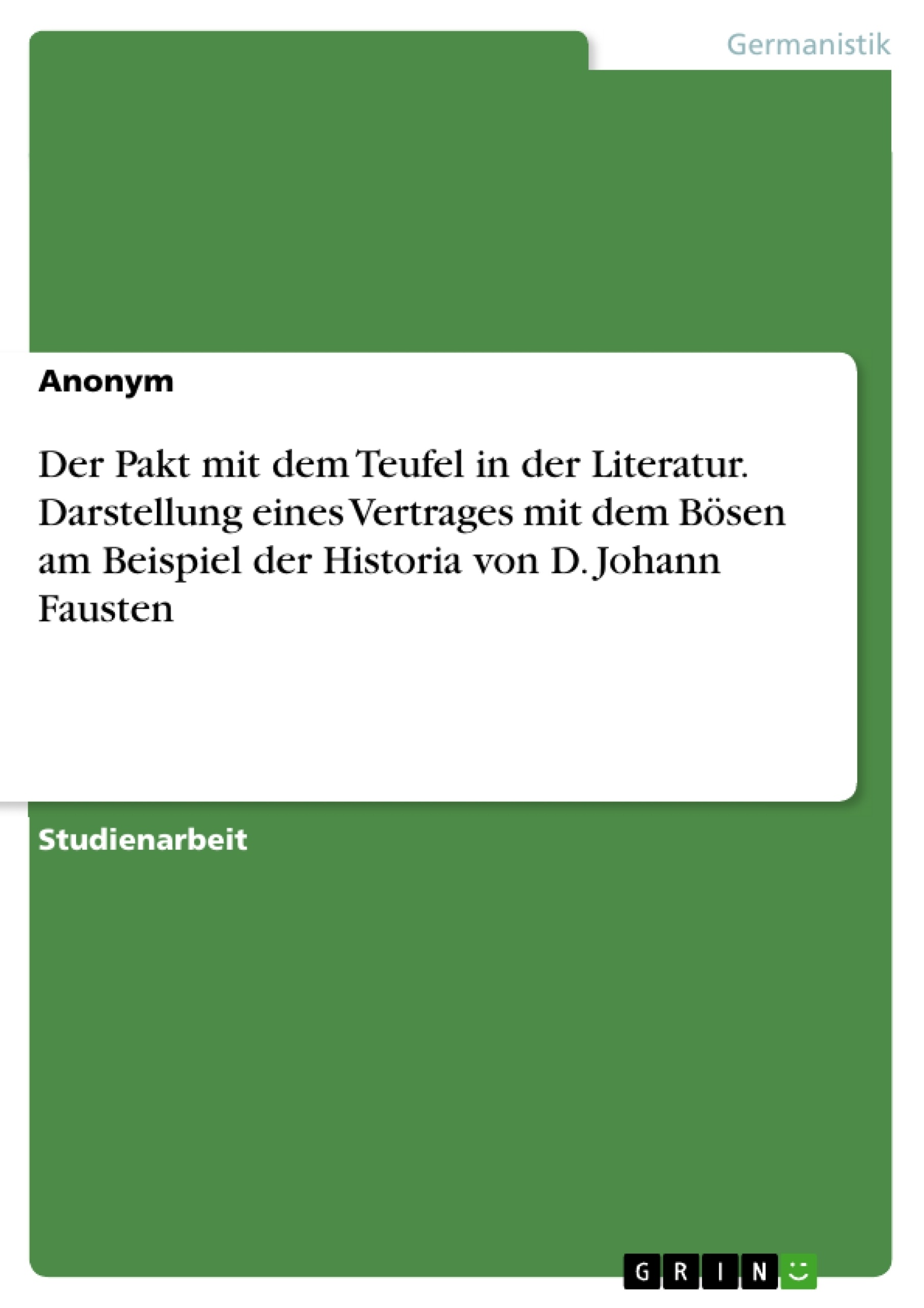Die im Mittelalter thematisierte Bündnisliteratur zwischen Mensch und Teufel nimmt zwar zahlenmäßig eine eher unbedeutende Stellung ein, da die Verbreitung von biblischen Motiven oder die Erzählungen von Wundernachrichten weitaus mehr genutzt wurden, um den christlichen Glauben zu stärken, jedoch ist sie eine äußerst beliebte Schilderung des zentralen Problems in jedem Glauben. Sie verdeutlicht die Möglichkeiten eines jeden Anhängers, die Glaubensregeln zu übertreten oder sich einer anderen Glaubensrichtung anzuschließen.
Die Legende bildet, neben der Historia, eine der am weitesten verbreiteten Darstellungen der Bündnisliteratur. Sie dient dazu, an den christlichen Glauben zu appellieren und den Menschen vor gottwidrigem Verhalten zu warnen. Denn auch wenn hier ein Pakt mit dem Teufel eingegangen wird, gelingt es dem Sünder sich durch aufrichtige Reue und der Zuwendung zu Gott aus dem Vertrag mit dem Bösen zu befreien. Es soll auf diese Weise die Macht des himmlischen über die des Teufels verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundkonstanten und Voraussetzungen für einen Pakt mit dem Teufel
- Forderungen und Leistungen in einem Pakt mit dem Teufel
- Die Forderungen und Leistungen des Teufels in der Historia
- Die Aufhebung eines Vertrages mit dem Teufel
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die literarische Darstellung von Pakten mit dem Teufel im Mittelalter. Dabei fokussiert sie sich auf die "Historia", eine literarische Form, die von der "Legende" abgegrenzt wird. Die Arbeit zeigt die grundlegenden Konstanten und Voraussetzungen auf, die einen Pakt mit dem Teufel charakterisieren, sowie die Forderungen und Leistungen, die von Mensch und Teufel in diesem Kontext ausgetauscht werden.
- Die Bedeutung der "Historia" im Vergleich zur "Legende"
- Die zentralen Elemente eines Teufelspaktes: Mensch, Teufel, Forderungen und Leistungen
- Die Voraussetzungen für einen Teufelspakt: Initiative des Menschen, Abkehr von Gott
- Das Beispiel des Dr. Johann Fausten als Fallstudie für einen Teufelspakt in der "Historia"
- Die Rolle des Wissens und der Verlangen nach mehr Wissen als Motiv für den Pakt mit dem Teufel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die "Historia" als literarische Darstellung von Pakten mit dem Teufel vor und hebt ihre Besonderheiten gegenüber der "Legende" hervor. Sie betont die Bedeutung der "Historia" für das Verständnis von Glaubensfragen im Mittelalter.
- Grundkonstanten und Voraussetzungen für einen Pakt mit dem Teufel: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Elemente eines Teufelspaktes, wie Mensch und Teufel, sowie die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein solcher Vertrag zustande kommt. Dazu gehören die Initiative des Menschen und der Verzicht auf Gott und seine Lehren.
- Forderungen und Leistungen in einem Pakt mit dem Teufel: Das Kapitel beschreibt die wechselseitigen Forderungen und Leistungen, die zwischen Mensch und Teufel ausgetauscht werden. Es werden die wichtigsten Punkte des Teufelspaktes wie die Forderung nach der Seele des Menschen und die Gegenleistung des Teufels in Form von Erfüllung von Wünschen und Diensten hervorgehoben.
- Die Forderungen und Leistungen des Teufels in der Historia: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die spezifischen Forderungen und Leistungen des Teufels in der "Historia". Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Seele und Körper sowie die Rolle des Neugeborenen im Kontext des Teufelspaktes.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche der Arbeit sind: Teufelspakt, Historia, Legende, Mittelalter, Glaube, Gott, Teufel, Mensch, Forderungen, Leistungen, Voraussetzungen, Dr. Johann Fausten, Wissen, Verlangen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Der Pakt mit dem Teufel in der Literatur. Darstellung eines Vertrages mit dem Bösen am Beispiel der Historia von D. Johann Fausten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293343