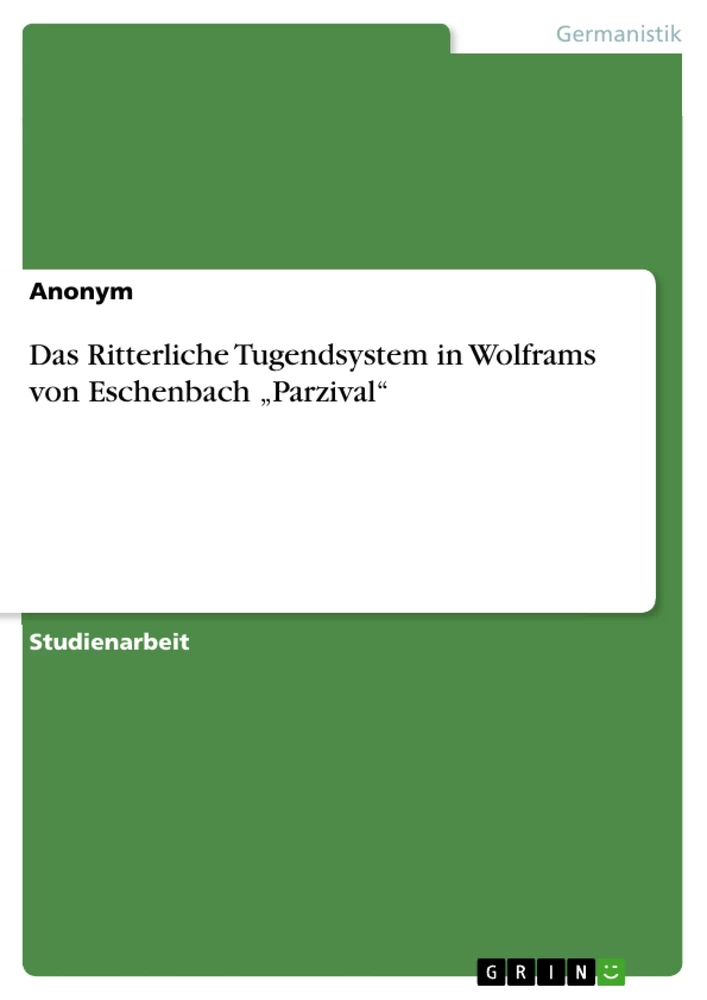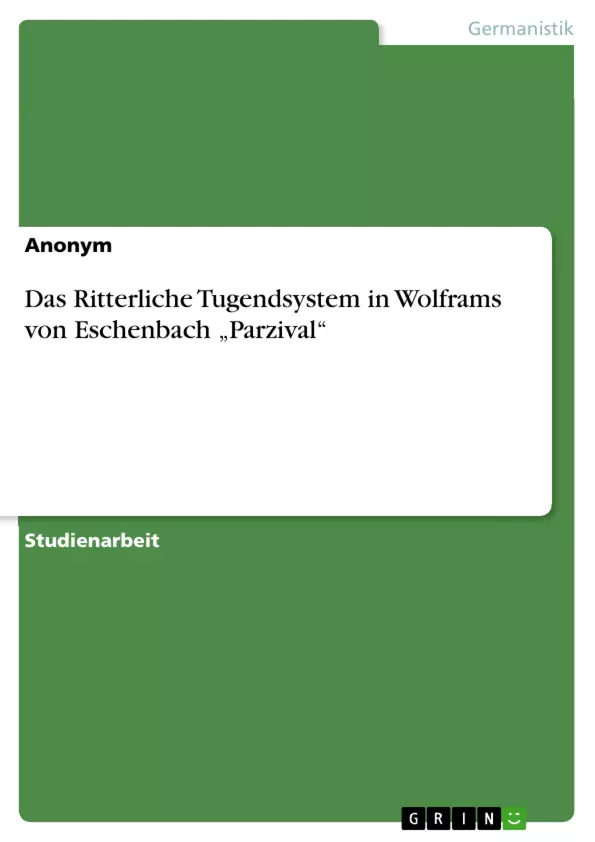Im Folgenden soll das mittelalterliche Werk „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach näher betrachtet werden.
Es handelt sich hierbei um eine fiktive Erzählung über den jungen Helden Parzival, der sich in zahlreichen Prüfungen bewähren muss und anschließend Gralskönig wird.
Das Werk stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert und
zählt zu den Artusromanen, welche auf Chrétien des Troyes zurückgehen. Es lässt sich somit in die matiére Bretagne einordnen.
Besonderes Augenmerk liegt bei dieser Arbeit auf dem „Ritterlichen Tugendsystem“, welches erstmals von Gustav Ehrismann analysiert und festgehalten wurde.
Bei seiner Analyse bezieht er sich vor allem auf Erkenntnisse aus der Antike und bedient sich der Darstellung von Rittern in literarischen Texten aus dem Mittelalter.
In erster Linie soll ein Verglich zwischen der Analyse von Ehrismann und der Darstellung Eschenbachs, in
Bezug auf die ritterlichen Tugenden des Parzivals, erarbeitet werden. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich das Ritterliche Tugendsystem mit der im "Parzival" geschilderten
Erziehung und Ausbildung zum Ritter vereinbaren lässt.
Um ein eindeutiges Ergebnis zu erlangen, steht vor allem seine Kindheit und seine Jugend unter Beobachtung, da sich in diesem Lebensabschnitt der Werdegang eines Ritters am deutlichsten nachvollziehen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ritterbegriff
- Das ,,Ritterliche Tugendsystem" von Gustav Ehrismann
- Grundlagen zum Parzival als Artusroman
- Parzivals Jugend und seine ritterliche Erziehung
- Abgleich des „Ritterlichen Tugendsystems“ mit der Erziehung Parzivals
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem mittelalterlichen Werk „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach und untersucht, inwiefern die im Werk dargestellten Tugenden des Protagonisten Parzival mit dem „Ritterlichen Tugendsystem“ von Gustav Ehrismann übereinstimmen. Die Arbeit analysiert die Erziehung und Ausbildung des jungen Helden und vergleicht diese mit den von Ehrismann festgehaltenen ethischen Vorstellungen eines tugendhaften Ritters.
- Der Ritterbegriff im Mittelalter
- Das „Ritterliche Tugendsystem“ nach Ehrismann
- Die Darstellung von Parzivals Erziehung und Ausbildung im Werk von Wolfram von Eschenbach
- Vergleich zwischen Ehrismanns Analyse und der Darstellung von Parzivals Tugenden im „Parzival“
- Die Bedeutung des „Ritterlichen Tugendsystems“ für die Interpretation des „Parzival“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Übereinstimmung zwischen dem „Ritterlichen Tugendsystem“ und der Darstellung von Parzivals Tugenden im „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach. Sie erläutert die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das Kapitel „Der Ritterbegriff“ beleuchtet die historische Entwicklung des Rittertums und die Entstehung des Ritterstandes. Es werden die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften eines Ritters im Mittelalter dargestellt, wobei der Fokus auf der Abgrenzung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen und der Bedeutung des Lehnswesens liegt.
Das Kapitel „Das ,,Ritterliche Tugendsystem" von Gustav Ehrismann“ stellt die Analyse von Ehrismann vor, die sich mit den ethischen Vorstellungen eines tugendhaften Ritters im Mittelalter befasst. Es werden die wichtigsten Tugenden und ihre Bedeutung für die Ritterkultur des Mittelalters erläutert.
Das Kapitel „Grundlagen zum Parzival als Artusroman“ gibt einen Überblick über die Gattung des Artusromans und die Bedeutung des „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach innerhalb dieser Gattung. Es werden die wichtigsten Elemente des Artusromans und die Rolle des Grals in der Geschichte von Parzival dargestellt.
Das Kapitel „Parzivals Jugend und seine ritterliche Erziehung“ beschreibt die Entwicklung des jungen Parzival vom Kind zum Ritter. Es werden die wichtigsten Stationen seiner Erziehung und Ausbildung dargestellt, wobei der Fokus auf den Einfluss seiner Umgebung und seiner eigenen Entscheidungen liegt.
Das Kapitel „Abgleich des „Ritterlichen Tugendsystems“ mit der Erziehung Parzivals“ vergleicht die von Ehrismann festgehaltenen Tugenden mit der Darstellung von Parzivals Erziehung und Ausbildung im „Parzival“. Es werden die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen analysiert und die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Interpretation des Werkes von Wolfram von Eschenbach diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das „Ritterliche Tugendsystem“, die Tugenden des Ritters, Wolfram von Eschenbach, „Parzival“, Artusroman, Gralsgeschichte, Erziehung, Ausbildung, Mittelalter, Geschichte, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Ritterliche Tugendsystem" nach Gustav Ehrismann?
Es ist eine wissenschaftliche Analyse mittelalterlicher Tugenden, die ethische Vorstellungen wie Beständigkeit, Maßhaltung und Treue als Kern des ritterlichen Verhaltens definiert.
Worum geht es in Wolframs von Eschenbach „Parzival“?
Die Erzählung folgt dem Helden Parzival, der nach einer schwierigen Jugend und zahlreichen Prüfungen schließlich zum Gralskönig aufsteigt.
Wie wird Parzival zum Ritter erzogen?
Parzivals Erziehung ist geprägt von einem Wechselspiel zwischen der isolationistischen Erziehung seiner Mutter Herzeloyde und der späteren höfischen Ausbildung durch Gurnemanz.
Stimmen Parzivals Tugenden mit Ehrismanns System überein?
Die Arbeit untersucht genau diesen Abgleich und stellt fest, inwieweit die literarische Darstellung Eschenbachs mit den theoretischen Tugendidealen der Forschung vereinbar ist.
Zu welcher Gattung gehört der „Parzival“?
Er zählt zu den Artusromanen der mittelhochdeutschen Blütezeit und ist Teil der sogenannten "matière de Bretagne".
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Das Ritterliche Tugendsystem in Wolframs von Eschenbach „Parzival“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293344