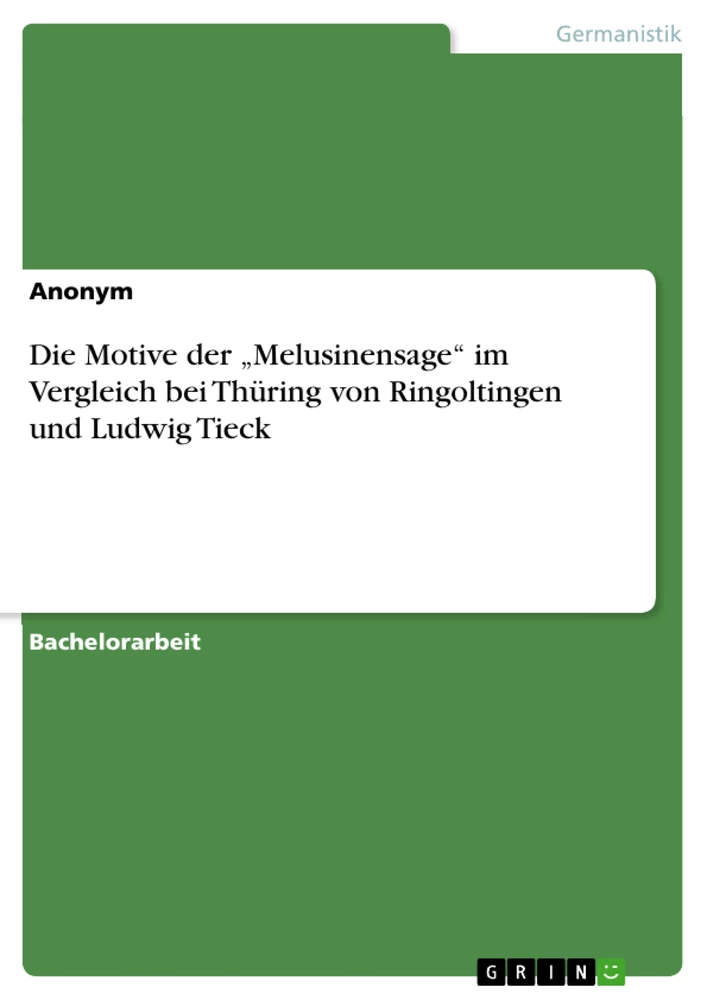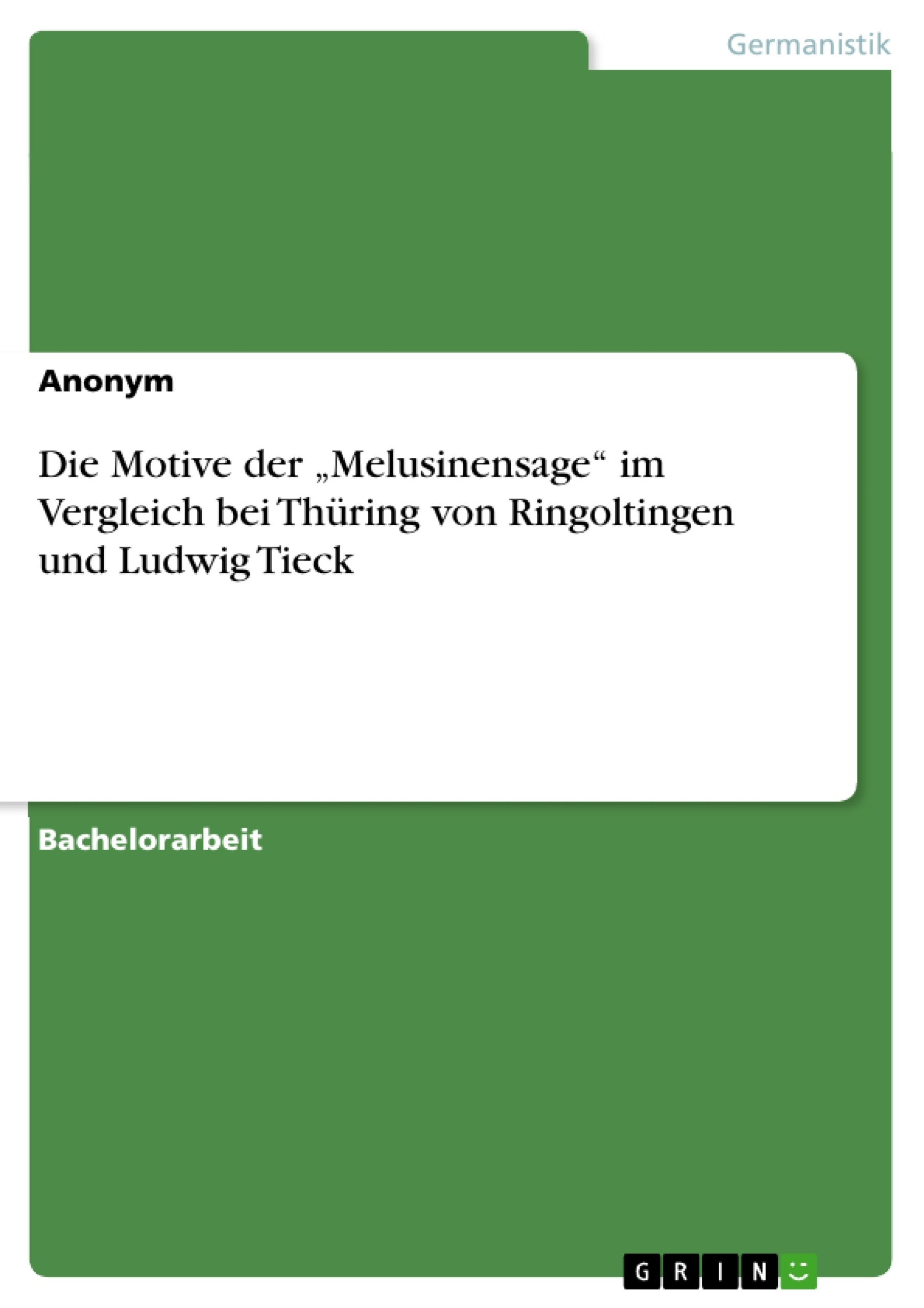In der folgenden Arbeit soll ein Vergleich erarbeitet werden, bei dem zwei Versionen der "Melusinensage" gegenüber gestellt werden. Der verarbeitete Stoff dieser Sage handelt von der Erzählung einer Fee, welche sich an jedem Sonnabend in eine Schlangenfrau verwandelt, indem ihr vom Nabel abwärts ein Fischschwanz wächst.
Sie kann nur dann von ihrem Schicksal erlöst werden, wenn sie einen Mann findet, der sich an ihr Verbot hält und ihr niemals an einem Samstag nachsteigt.
Sollte er sich daran jedoch nicht halten, wären beide für immer verloren.
Dieser Stoff wird zum einen in dem Prosaroman von Thüring von Ringoltingen verarbeitet, welcher sein Werk im Jahr 1456 vollendete. Es handelt sich hierbei um eine Auftragsarbeit für den Marktgrafen Rudolf von Hohenberg, der mit diesem Werk beabsichtigte, seine Abstammung auf die des Hauses Lusignan zu rechtfertigen. Aus diesem Grund bediente sich Thüring bei seiner Version an der Vorlage von Jean d’Arras, welche in den Jahren 1387-93 verfasst wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Melusinensage bei Thüring von Ringoltingen und Ludwig Tieck
- Der Hintergrund des Melusinenstoffs
- Thüring von Ringoltingen
- Der Prosaroman
- Ludwig Tieck
- Die romantische Erzählung
- Genealogie als Hintergrund der Melusinensage
- Die Genealogie bei Thüring von Ringoltingen
- Die Genealogie bei Ludwig Tieck
- Das Motiv der Mahrtenehe
- Die Mahrtenehe bei Thüring von Ringoltingen
- Die Mahrtenehe bei Ludwig Tieck
- Der Tabubruch in der Mahrtenehe
- Der Tabubruch bei Thüring von Ringoltingen
- Der Tabubruch bei Ludwig Tieck
- Die Person der Melusine
- Die Melusine bei Thüring von Ringoltingen
- Die Melusine bei Ludwig Tieck
- Analyse weiterer Unterscheidungsmerkmale
- Resümee
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Vergleich zweier Versionen der Melusinensage: der Prosaversion von Thüring von Ringoltingen (1456) und der romantischen Erzählung von Ludwig Tieck (um 1800). Ziel ist es, die zentralen Motive der Sage in beiden Versionen zu analysieren und zu vergleichen, um herauszufinden, ob Tiecks Version eine bloße Kopie der Vorlage ist oder ob er entscheidende Veränderungen vorgenommen hat, die zu zwei eigenständigen Varianten des Stoffes führen.
- Genealogie als Mittel der Legitimation
- Die Mahrtenehe als zentrales Motiv
- Der Tabubruch als Wendepunkt der Geschichte
- Die Darstellung der Melusine als übernatürliches Wesen
- Unterschiede in der Umsetzung des Stoffes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Melusinensage ein und stellt die beiden zu vergleichenden Versionen von Thüring von Ringoltingen und Ludwig Tieck vor. Sie erläutert die Bedeutung der Sage als Legitimationsmittel und die zentralen Motive, die im Fokus der Arbeit stehen.
Das Kapitel „Die Melusinensage bei Thüring von Ringoltingen und Ludwig Tieck“ beleuchtet zunächst den Hintergrund des Melusinenstoffs, der auf der Geschichte einer Fee mit einem Schlangenschwanz basiert, die nur dann von ihrem Fluch erlöst werden kann, wenn ihr Mann ihr Geheimnis nicht lüftet. Anschließend werden die beiden Versionen der Sage im Detail vorgestellt, wobei die jeweiligen historischen und literarischen Kontexte beleuchtet werden.
Das Kapitel „Genealogie als Hintergrund der Melusinensage“ analysiert die Rolle der Genealogie in beiden Versionen. Es wird gezeigt, wie die Sage als Mittel der Legitimation eingesetzt wurde, um die Abstammung des Hauses Lusignan zu rechtfertigen.
Das Kapitel „Das Motiv der Mahrtenehe“ untersucht die Verbindung zwischen einem Menschen und einem übernatürlichen Wesen, die der Melusinensage zugrunde liegt. Es werden die verschiedenen Aspekte der Mahrtenehe in den beiden Versionen beleuchtet.
Das Kapitel „Der Tabubruch in der Mahrtenehe“ analysiert den Tabubruch, der das Ende der Mahrtenehe bedeutet. Es wird gezeigt, wie der Tabubruch in beiden Versionen dargestellt wird und welche Folgen er für die Protagonisten hat.
Das Kapitel „Die Person der Melusine“ untersucht die Darstellung der Melusine in beiden Versionen. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Charakterisierung der Figur herausgearbeitet.
Das Kapitel „Analyse weiterer Unterscheidungsmerkmale“ beleuchtet weitere Unterschiede zwischen den beiden Versionen der Melusinensage, die über die vier zentralen Motive hinausgehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Melusinensage, Thüring von Ringoltingen, Ludwig Tieck, Genealogie, Mahrtenehe, Tabubruch, übernatürliche Wesen, Legitimation, Vergleich, Literaturgeschichte, Romantik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Melusinensage?
Die Sage handelt von einer Fee, die sich jeden Samstag in eine Schlangenfrau verwandelt. Ihr Mann darf sie an diesem Tag nicht beobachten, sonst ist ihr gemeinsames Glück verloren.
Wer war Thüring von Ringoltingen?
Er verfasste 1456 eine Prosaversion der Melusinensage als Auftragsarbeit, um die Abstammung des Hauses Lusignan genealogisch zu rechtfertigen.
Wie unterscheidet sich Ludwig Tiecks Version?
Tieck verarbeitete den Stoff um 1800 als romantische Erzählung und setzte dabei eigene literarische Schwerpunkte, die über die mittelalterliche Vorlage hinausgehen.
Was ist das Motiv der "Mahrtenehe"?
Es bezeichnet die Verbindung zwischen einem sterblichen Mann und einem übernatürlichen Wesen (Fee/Elementargeist), die an eine bestimmte Bedingung (Tabu) geknüpft ist.
Welche Rolle spielt die Genealogie in der Sage?
Die Sage diente adligen Familien oft als Mittel der Legitimation, um ihre Herkunft auf übernatürliche oder besonders ehrwürdige Ahnen zurückzuführen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Die Motive der „Melusinensage“ im Vergleich bei Thüring von Ringoltingen und Ludwig Tieck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293348