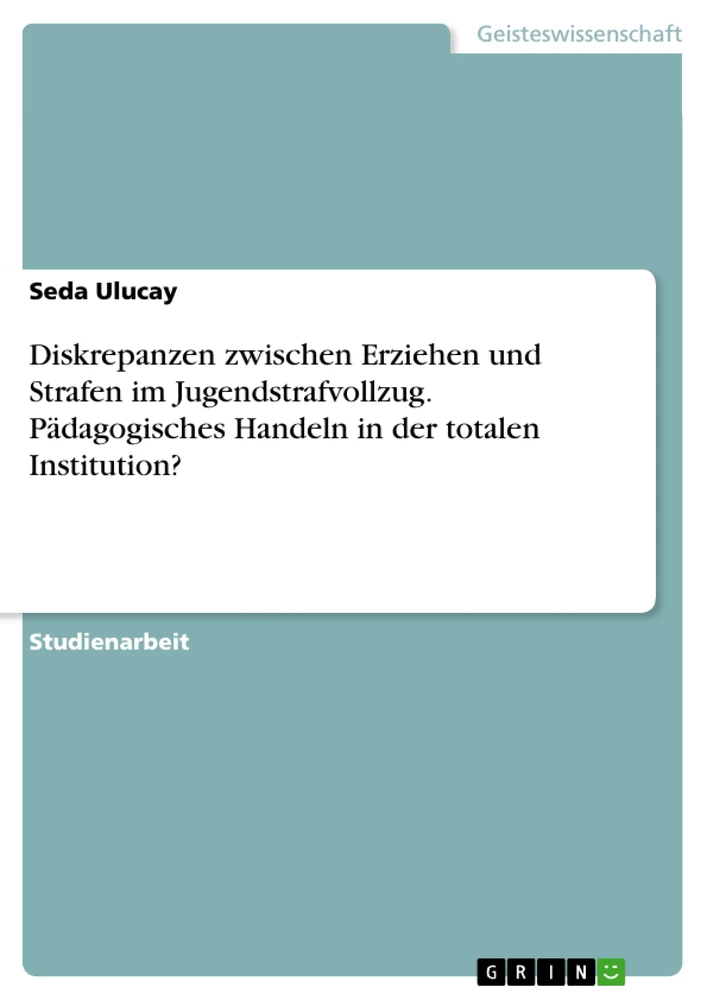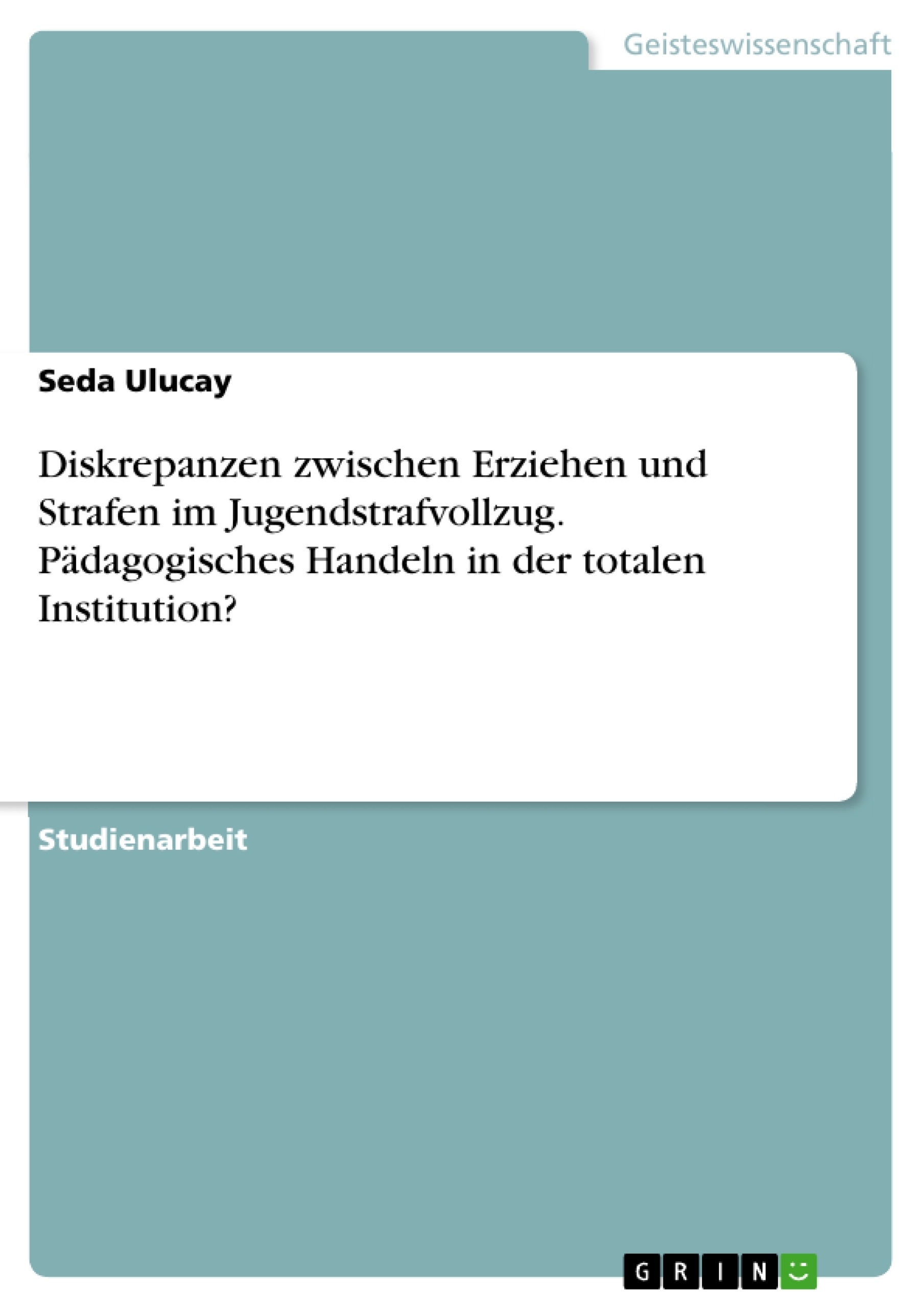„Der Vollzug des Jugendarrests soll das Ehrgefühl des Jugendlichen wecken und ihm eindringlich zum Bewußtsein bringen, daß er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen hat. Der Vollzug des Jugendarrests soll erzieherisch gestaltet werden. Er soll dem Jugendlichen helfen, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die zur Begehung der Straftat beigetragen haben.“ §90 Abs.1 JGG
In dieser Arbeit werde ich mich mit der Frage beschäftigen, in wieweit eine Institution wie der Jugendvollzug erzieherisch gestaltet werden kann, so dass auch die Anforderung im §90 Abs.1 des Jugendgerichtsgesetzes erfüllt werden kann. Es geht um die Diskussion der Tauglichkeit des pädagogischen Handelns in der Jugendvollzugsanstalt und um die damit zusammenhängenden Diskrepanzen zwischen Strafen und Erziehen. Da der Jugendvollzug schon immer den Charakter den Strafens und des totalitären Klimas hatte und hat, ist es fraglich ob pädagogische Initiativen generell eine Chance und Aussicht auf eine Förderung zum gesetzeskonformen Leben und zur Resozialisierung bieten und den Strafgedanken in diesem Kontext verdrängen. Um diesen Fragen etwas Antwort geben zu können, werde ich zunächst allgemeine Informationen zum Thema Straffälligkeit geben. Hierbei werde ich die Bereiche der Kriminalität und Jugenddelinquenz in Deutschland anschneiden.
Im weiteren Verlauf werde ich zum Spannungsverhältnis Erziehung und Strafe kommen und einen Einblick in das pädagogische Geschehen bzw. die Bedingungen des pädagogischen Handelns im Kontext der Jugendvollzugsanstalt bieten. Damit gehen auch die Möglichkeiten und Grenzen des pädagogischen Handelns einher. Diese Arbeit wird zusammenfassend und mit einem Ausblick abgeschlossen – hier wird deutlich werden, ob das pädagogische Handeln in der JVA erfolgreich sein kann und wie sich die geforderte erzieherische Gestaltung auf Institution und Klientel auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Straffälligkeit und Jugenddelinquenz
- III. Ist die Erziehung in der totalen Institution möglich? Oder: Das pädagogische Handeln im Jugendstrafvollzug
- IV. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit eine Institution wie der Jugendvollzug erzieherisch gestaltet werden kann, um die Anforderungen des §90 Abs.1 des Jugendgerichtsgesetzes zu erfüllen. Dabei wird insbesondere der Fokus auf das pädagogische Handeln im Kontext der Jugendvollzugsanstalt und die damit verbundenen Diskrepanzen zwischen Strafen und Erziehen gelegt.
- Die Tauglichkeit des pädagogischen Handelns in der Jugendvollzugsanstalt
- Diskrepanzen zwischen Strafen und Erziehen im Jugendstrafvollzug
- Möglichkeiten und Grenzen des pädagogischen Handelns in einer totalen Institution
- Die Rolle der Jugendstrafe im Kontext der Resozialisierung
- Das Verhältnis von Strafgedanken und pädagogischen Initiativen im Jugendvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Thematik des pädagogischen Handelns im Jugendstrafvollzug im Kontext des §90 Abs.1 des Jugendgerichtsgesetzes. Die Autorin stellt die Frage, inwieweit der Jugendvollzug erzieherisch gestaltet werden kann und diskutiert das Spannungsverhältnis zwischen Strafen und Erziehen. Sie führt die Notwendigkeit von pädagogischen Maßnahmen im Jugendstrafvollzug ein und stellt die Frage, ob sie eine Chance zur Förderung eines gesetzeskonformen Lebens und zur Resozialisierung bieten können.
II. Straffälligkeit und Jugenddelinquenz
Das Kapitel behandelt die Thematik der Straffälligkeit und Jugenddelinquenz in Deutschland. Es beleuchtet die unterschiedlichen Formen von Jugendkriminalität und stellt verschiedene Faktoren dar, die diese beeinflussen können, wie z.B. soziale Probleme, das Familienklima und Peergroups. Darüber hinaus werden Statistiken zur Jugendkriminalität präsentiert und die Verhängung von Jugendstrafen gemäß §17 des Jugendgerichtsgesetzes erläutert.
Schlüsselwörter
Jugendstrafvollzug, pädagogisches Handeln, totale Institution, Diskrepanzen, Strafen und Erziehen, Resozialisierung, Jugenddelinquenz, Jugendkriminalität, Jugendgerichtsgesetz, §90 Abs.1, §17 JGG, soziale Verantwortung, Vollzugsplan, Förderung, soziales Benachteiligung, Bildung, berufliche Qualifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was fordert § 90 Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG)?
Der Paragraph fordert, dass der Jugendarrest erzieherisch gestaltet werden soll, um das Ehrgefühl des Jugendlichen zu wecken und ihm bei der Bewältigung seiner Schwierigkeiten zu helfen.
Kann Erziehung in einer „totalen Institution“ wie dem Gefängnis funktionieren?
Das ist ein zentrales Spannungsfeld der Arbeit. Das totalitäre Klima des Strafvollzugs steht oft im Widerspruch zu pädagogischen Zielen der Freiheit und Selbstverantwortung.
Was ist das Ziel der Resozialisierung im Jugendstrafvollzug?
Ziel ist es, den Jugendlichen durch Bildung, berufliche Qualifizierung und soziale Förderung zu einem gesetzeskonformen Leben in der Gesellschaft zu befähigen.
Welche Faktoren beeinflussen die Jugenddelinquenz in Deutschland?
Einflussfaktoren sind unter anderem soziale Benachteiligung, das familiäre Klima, der Einfluss von Peergroups sowie individuelle Bildungsdefizite.
Was ist ein Vollzugsplan?
Ein Vollzugsplan legt die individuellen erzieherischen und fördernden Maßnahmen fest, die während der Haftzeit umgesetzt werden sollen, um die Rückfallgefahr zu minimieren.
- Quote paper
- Seda Ulucay (Author), 2013, Diskrepanzen zwischen Erziehen und Strafen im Jugendstrafvollzug. Pädagogisches Handeln in der totalen Institution?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293359