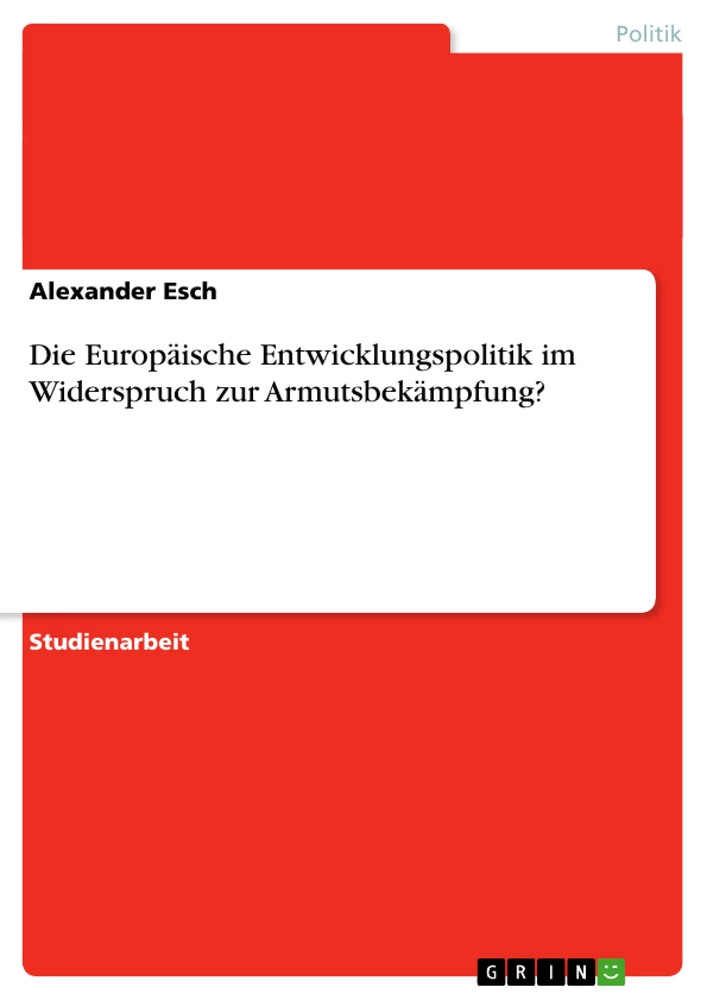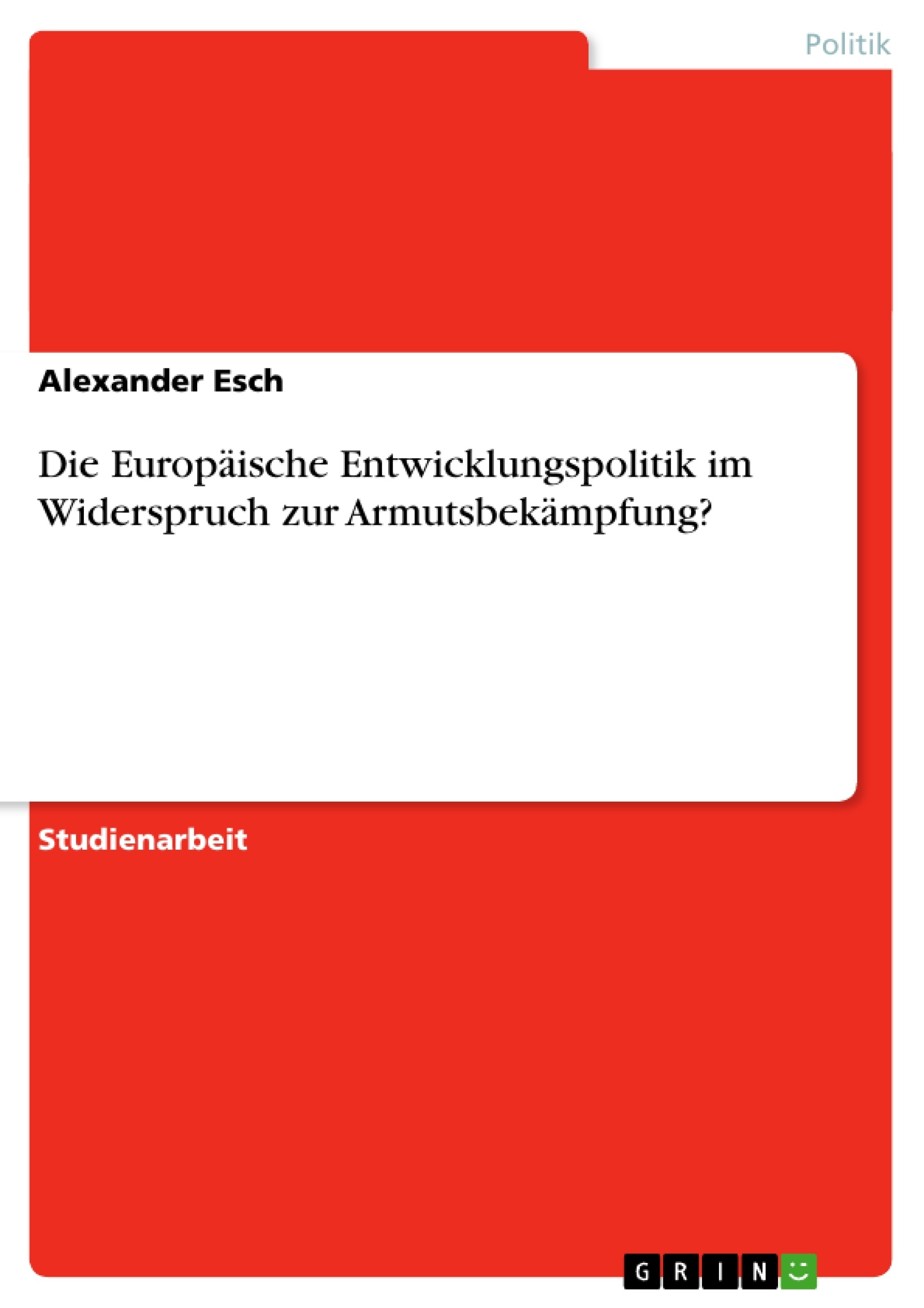In dieser sich zunehmend globalisierenden Welt, in der Globalisierung fast ausschließlich neoliberal definiert wird, scheinen sich die Prognosen, die von Anhängern eben dieser Neoliberalität gestellt wurden und dem armen Teil der Weltbevölkerung euphorische Versprechungen machten, nicht zu erfüllen. Im Gegenteil: „Der wirtschaftliche Liberalismus hat den politischen Liberalismus nicht gefördert, die Distanz zwischen den Kulturen und Völkern hat sich nicht verringert, der Lebensstandard zwischen Nord und Süd driftet weiter auseinander.“1 Das Bruttoinlandsprodukt stieg in den Jahren von 1970 bis 1990 in den OECD-Staaten um 35%, während es sich in den Entwicklungsländern gerade mal um 3% steigerte.2 Nach dem Entwicklungsbericht der ´Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung´ (UNCTAD) von 1997 war das persönliche Einkommen 1965 in den G7-Ländern 20-mal höher als das in den sieben ärmsten Ländern. 1995 war es 40-mal höher.3 Über ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt heute in vollständiger Armut und die Hälfte der Weltbevölkerung hat nicht mehr als 2 Dollar pro Tag zur Verfügung, so daß heute das Vermögen der drei reichsten Männer der Welt größer ist als das von 50% der ärmsten Länder. Die UNCTAT macht die Liberalisierungspolitik für diese Entwicklung verantwortlich und es scheint, als ob diese immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich „ein notwendiges Strukturelement der neoliberalen Globalisierung“4 darstellt, indem sie als Wettbewerbsvorteil genutzt wird. Angesichts dieser Bilanz stellt sich nicht zuletzt die Frage, was die Entwicklungspolitik in diesem Zusammenhang leistet und bisher geleistet hat, da sie per definitionem das Ziel verfolgt, diese Verhältnisse nach bestimmten Vorgaben abzufangen und einen gegenteiligen Prozeß in Gang zu bringen. [...] 1 Nikonoff, Jacques: Die Finanzierung der Entwicklung, 10.10.2001. Online/Internet: attac. org/fra/list/doc/nikonoff3.de.htm [Stand 7.8.2002], S. 3. 2 Vgl. Brüne, Stefan: Europas Entwicklungspolitiken. Anspruch, Zielkonflikte, Interessen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 45 (1995) 29, S. 32. 3 Vgl. Mies, Maria: Das globale Freihandelssystem als Neokoloniales Kriegssystem. Online/Internet: attacnetzwerk. de/archiv/0110mm_globalkrieg.pdf [Stand 5.8.2002], S. 3. 4 Mies: a.a.O., S. 3.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsphase Europäischer Entwicklungspolitik
- Assoziierung
- Yaoundé I-II
- Lomé I
- Lomé II – Cotonou: Tendenzen und Probleme europäischer Nord-Süd-Politik
- EEF
- STABEX
- Demokratie und Mens chenrechte
- Strukturanpassungspolitik
- Vervielfältigte Auslandsengagements der EU
- Liberalisierungspolitik
- Gemeinschaftliche versus nationale Entwicklungspolitik
- Abschluß
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Europäische Entwicklungspolitik im Kontext der Globalisierung und analysiert, ob sie im Widerspruch zur Armutsbekämpfung steht. Der Text beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der europäischen Nord-Süd-Politik, wobei die Lomé-Politik als zentraler Bestandteil dieser Entwicklung im Fokus steht.
- Die Entwicklung der Europäischen Entwicklungspolitik von ihren Anfängen bis zum Cotonou-Abkommen
- Die Rolle der EU in der Armutsbekämpfung und die Kritik an ihren Entwicklungspolitiken
- Die Auswirkungen der Liberalisierungspolitik auf die Entwicklungsländer
- Die Ambivalenz der europäischen Entwicklungspolitik zwischen Hilfe und neoliberalen Interessen
- Die Herausforderungen und Probleme der europäischen Nord-Süd-Politik im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Globalisierung und die daraus resultierenden Disparitäten zwischen Nord und Süd in den Mittelpunkt. Sie führt Statistiken an, die die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich aufzeigen und die Frage nach der Wirksamkeit der Entwicklungspolitik aufwerfen.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Entstehungsphase der Europäischen Entwicklungspolitik. Es schildert die Assoziierungsphase und die Entwicklung der Yaoundé- und Lomé-Abkommen.
Das vierte Kapitel analysiert die Lomé-Politik und ihre Weiterentwicklung bis zum Cotonou-Abkommen. Es beleuchtet die verschiedenen Instrumente und Ziele der europäischen Nord-Süd-Politik, sowie die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Europäische Entwicklungspolitik, Globalisierung, Armutsbekämpfung, Lomé-Politik, Cotonou-Abkommen, Nord-Süd-Politik, Liberalisierungspolitik, Strukturanpassungspolitik, Demokratie, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Steht die EU-Entwicklungspolitik im Widerspruch zur Armutsbekämpfung?
Die Arbeit untersucht die Kritik, dass neoliberale Liberalisierungsvorgaben oft im Widerspruch zum eigentlichen Ziel der Armutsreduzierung in Entwicklungsländern stehen.
Was ist das Lomé-Abkommen?
Ein historisch bedeutendes Handels- und Hilfsabkommen zwischen der EU und Staaten aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik (AKP-Staaten), das später durch das Cotonou-Abkommen ersetzt wurde.
Wie beeinflusst die Liberalisierungspolitik die Entwicklungsländer?
Kritiker argumentieren, dass die Öffnung der Märkte oft die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert, da Entwicklungsländer im globalen Wettbewerb benachteiligt sind.
Was versteht man unter „Strukturanpassungspolitik“?
Dabei handelt es sich um wirtschaftspolitische Auflagen (z.B. Privatisierung, Sparmaßnahmen), die Länder erfüllen müssen, um Kredite oder Unterstützung zu erhalten.
Warum wächst die Kluft zwischen Nord und Süd trotz Entwicklungshilfe?
Die Arbeit thematisiert strukturelle Elemente der Globalisierung, die Industrieländer bevorzugen, während das Einkommen in den ärmsten Ländern im Vergleich dazu stagniert.
- Arbeit zitieren
- Alexander Esch (Autor:in), 2002, Die Europäische Entwicklungspolitik im Widerspruch zur Armutsbekämpfung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29341