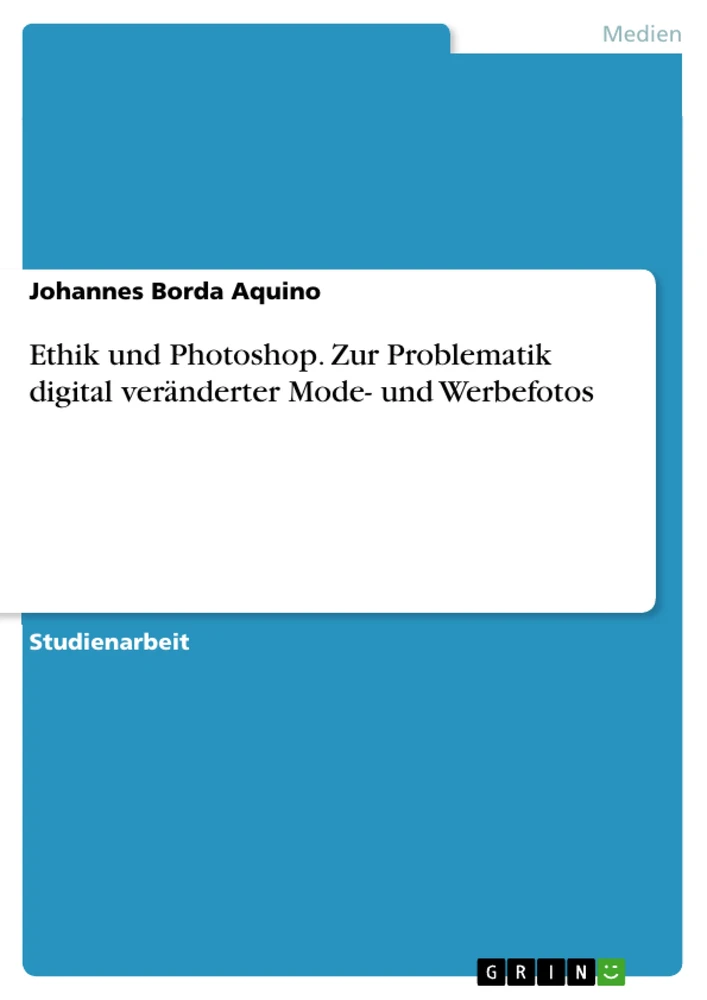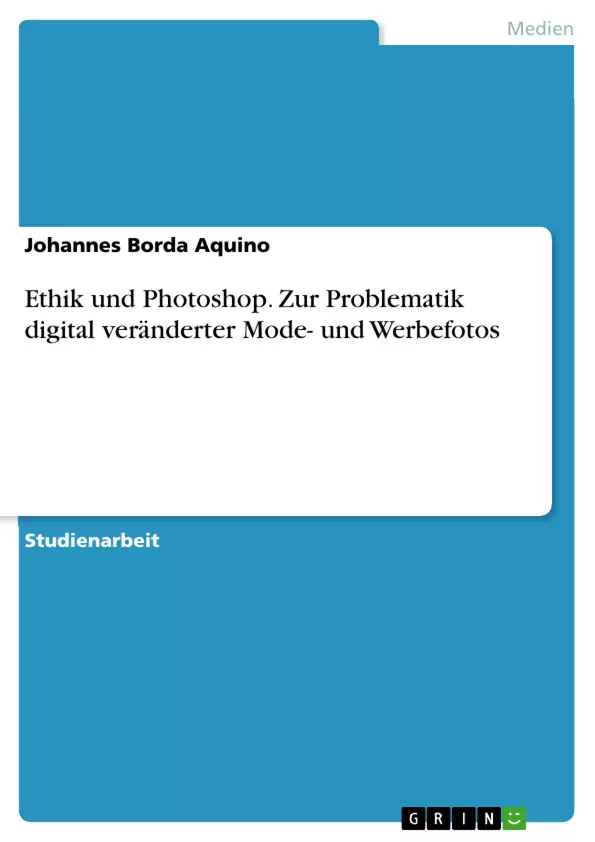Im von medialen Einflüssen verschiedenster Couleur durchsetzten Alltag in unserer Gesellschaft sind wir geradezu ununterbrochen mit der Notwendigkeit konfrontiert, der steten Informationsflut aktiv zu begegnen, sei es durch – bewusstes oder auch unbewusstes – Konsumieren oder eben auch Nicht-Konsumieren spezifischer Informationskanäle, die selektive Auslese und das individuelle Bewerten von Informationen mit Blick auf Wesensart und Herkunft der Nachricht wie auch das Motiv der Urheberin bzw. des Urhebers. Wir stehen dabei vor dem Problem, die augenscheinlich auf reinen „Fakten“ basierende Nachricht – eine weiterführende Auseinandersetzung um die mutmaßliche „Objektivität“ einer Nachricht findet Platz im nächsten Kapitel – von den explizit subjektiv gefärbten Veröffentlichungen, seien es nun solche zum Zwecke der Meinungsäußerung, der Unterhaltung oder letztlich auch jene mit dem Ziel der kommerziellen Werbung oder der politischen Propaganda, abgrenzen können zu müssen. Je nach Charakter und Thematik der Nachricht – selbige wird im Übrigen nicht nur in schriftlicher Form oder über das gesprochene Wort vermittelt, sondern, und darauf soll der Fokus dieser Arbeit liegen, auch über visuelle Medien kommuniziert – wird auch der Botschaft ein unterschiedlich hoher Anspruch an die eigene Objektivität zuteil. Konkret möchte sich die vorliegende Arbeit mit den idealtypischen Körperbildern in der Werbebranche auseinandersetzen, den öffentlichen Diskurs über die mutmaßlichen Auswirkungen der medialen Vermarktung eines abstrakten, in seiner Einfalt und Perfektion unerreichbaren Schönheitsideals auf junge Frauen nachzeichnen und sich anschließend der Fragestellung widmen, ob und in wie weit digital veränderte Werbefotos zu
kennzeichnen sein sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ethische Begriffe
- Ethik und Moral
- Medienethik
- Ethik im Bildjournalismus
- Ethik in der Werbung
- Gesinnungs- und Verantwortungsethik
- Bildmanipulation
- Authentizität und Objektivität
- Bildmanipulation am Beispiel
- Öffentlicher Diskurs
- Schönheit und Schönheitsideal
- Debatte um die Kennzeichnungspflicht
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Problematik digital veränderter Mode- und Werbefotos und untersucht die ethischen Fragen, die sich daraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Auswirkungen von Bildmanipulation auf die Wahrnehmung von Schönheit und dem damit verbundenen öffentlichen Diskurs.
- Ethische Aspekte der Bildmanipulation in der Werbung
- Einfluss digital veränderter Fotos auf das Schönheitsideal
- Der öffentliche Diskurs über die Kennzeichnungspflicht von Bildmanipulation
- Die Rolle der Medienethik im Kontext von Bildmanipulation
- Verantwortungsethik und die Rolle der einzelnen Akteure im medialen Gestaltungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Bildmanipulation im Kontext von Mode- und Werbefotos. Anschließend werden die ethischen Begriffe Ethik und Moral sowie die Medienethik definiert und in Bezug zur Bildmanipulation gesetzt. Das Kapitel über Bildmanipulation beleuchtet die Problematik der Authentizität und Objektivität im Bereich des Bildjournalismus und analysiert anhand eines Beispiels die Auswirkungen digital veränderter Fotos.
Im Anschluss wird der öffentliche Diskurs über die Problematik der Bildmanipulation und deren Auswirkungen auf das Schönheitsideal beleuchtet. Die Debatte um die Kennzeichnungspflicht von Bildmanipulation wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Medienethik, Bildmanipulation, Werbefotos, Schönheitsideal, Authentizität, Objektivität, Kennzeichnungspflicht, Verantwortungsethik, Gender Mainstreaming.
Häufig gestellte Fragen
Welche ethischen Probleme entstehen durch Bildmanipulation in der Werbung?
Die Manipulation mit Programmen wie Photoshop erzeugt unrealistische Schönheitsideale, die besonders auf junge Menschen negativen Einfluss haben können und die Grenze zwischen Authentizität und Täuschung verwischen.
Sollten digital veränderte Werbefotos gekennzeichnet werden?
In der Medienethik wird intensiv über eine Kennzeichnungspflicht diskutiert, um Konsumenten für die Künstlichkeit der Bilder zu sensibilisieren und den Druck durch unerreichbare Perfektion zu mindern.
Was ist der Unterschied zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik in diesem Kontext?
Gesinnungsethik fragt nach der inneren Haltung des Gestalters, während Verantwortungsethik die tatsächlichen gesellschaftlichen Auswirkungen der manipulierten Bilder in den Fokus rückt.
Wie beeinflussen manipulierte Fotos unser Schönheitsideal?
Sie schaffen ein „abstraktes Ideal“, das in der Realität nicht existiert. Dies kann zu Körperunzufriedenheit führen, da die mediale Darstellung als Maßstab für die eigene Identität missverstanden wird.
Gilt für Werbung der gleiche Objektivitätsanspruch wie für den Journalismus?
Nein, Werbung ist explizit subjektiv und kommerziell motiviert. Dennoch stellt sich die ethische Frage, wo die legitime Optimierung endet und die schädliche Manipulation beginnt.
- Citation du texte
- Dipl.-Ing. (FH) Johannes Borda Aquino (Auteur), 2010, Ethik und Photoshop. Zur Problematik digital veränderter Mode- und Werbefotos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293491