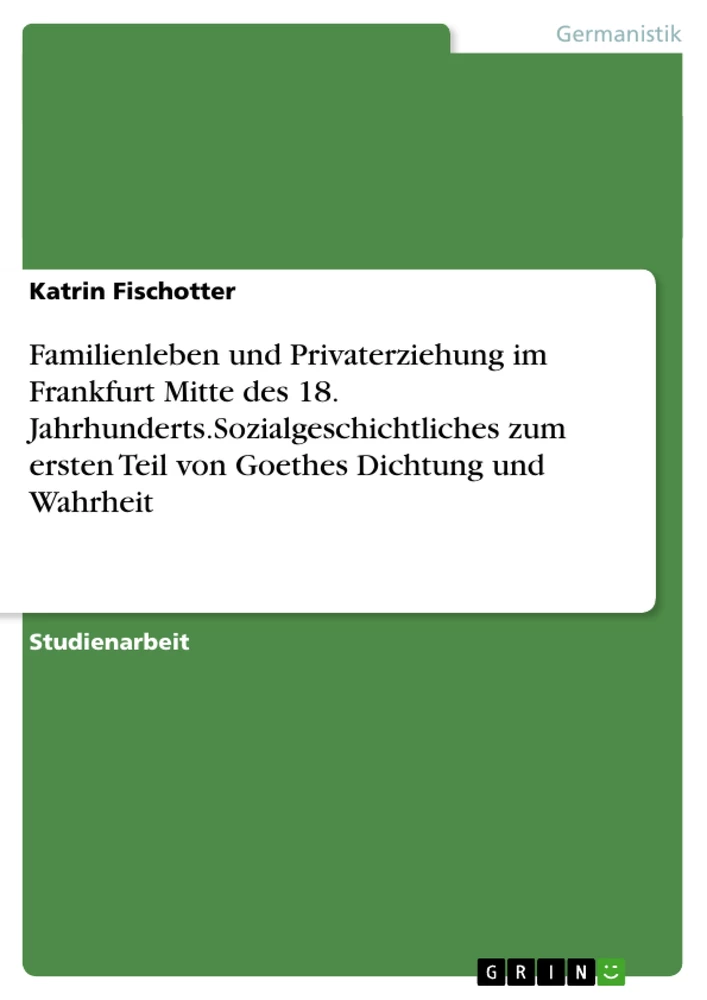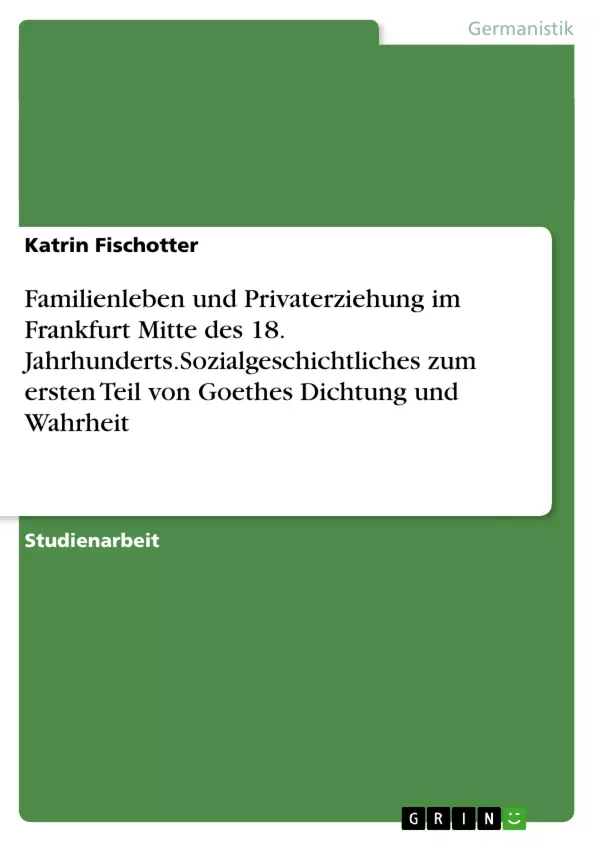Autobiographien bieten uns heutigen Menschen einen unglaublichen Einblick in das tatsächliche Leben vergangener Zeiten, wie es bloße historische Fakten nicht tun können. Sie geben uns die Möglichkeit die Menschen in einer vergangenen Epoche auch wirklich als solche zu sehen, zu verstehen wie das private Leben der Zeit aussah, welche Moralvorstellungen die Menschen hatten, was für sie von Bedeutung war und wie sie miteinander auskamen. Autobiographien sind sozusagen ‚Zeitzeugen’, die helfen jene Distanz die zwischen den Jahrhunderten liegt abzubauen. Goethes Autobiographie, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, spiegelt das Leben des 18. Jahrhunderts wider. An seinem Buch kann man gut sozialgeschichtliche Strukturen des Bildungsbürgertums der Neuzeit ablesen. Goethe betrachtet, als er den ersten Teil des Buches verfasst, sechzig jährig seine Kindheit in Frankfurt und wird sich dabei ‚selbst historisch’. Er stellt, wie der Titel schon sagt, sein Leben nicht nur in faktischer Wahrheit dar, sondern weist sofort darauf hin, dass erlebte Geschichte nicht als bloße Wahrheit abzubilden ist, sondern es zugleich der Dichtung benötigt, um das eigene Leben literarisch abzufassen. Dessen muss man sich bei der sozialgeschichtlichen Betrachtung des Werkes sicherlich bewusst werden. Aber Goethes Autobiographie will gerade: „den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darstellen“2 und damit ist das Werk, auch wenn einige Details oder Geschehnisse nicht der ‚ganzen Wahrheit’ entsprechen, dennoch ein gutes Zeugnis des Lebens des Bildungsbürgertums im 18. Jahrhundert. Der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen – steht als Motto zu den zwanzig Büchern der Autobiographie Goethes. Ist dieses Motto auch tatsächlich eine Erziehungsmaxime des 18. Jahrhunderts und wurde Goethe in seiner Kindheit wirklich so ‚geschunden’? Dies sind Fragen, die durch die genauere Betrachtung des Familienlebens in der Mitte des 18. Jahrhunderts deutlich werden. [...] 1 Johann Wolfgang von Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, Erich Trunz (Hrsg.) Johann Wolfgang von Goethe Werke Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band 9 und 10: Autobiographische Schriften, München 121994, S.7,4 und S.641 (Kommentar von Erich Trunz) 2 FA I, 14, S.13 aus: Benedikt Jeßing, Dichtung und Wahrheit. Entstehung, Quellen, Textgeschichte, in: Bernd Witte/Peter Schmidt (Hrsg.), Goethe Handbuch, Band 3: Prosaschriften, Stuttgart/Weimar, 1997, S.278-330, hier S.280
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Geburt und Kindersterblichkeit in der Familie
- 2.2 Vom „ganzen Haus“ zur „Kernfamilie“
- 2.3 Die Rolle der Frau innerhalb der bürgerlichen Familie
- 2.4 Die Rolle des Mannes innerhalb der bürgerlichen Familie
- 2.5 Erziehung und Privatunterricht im Bildungsbürgertum
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, anhand von Goethes „Dichtung und Wahrheit“ sozialgeschichtliche Aspekte des Familienlebens und der Erziehung im Frankfurter Bildungsbürgertum des 18. Jahrhunderts zu beleuchten. Goethes Autobiographie dient als Quelle, um Einblicke in die Lebenswirklichkeit dieser Zeit zu gewinnen und die damaligen Moralvorstellungen, Bedeutung von Familienstrukturen und Erziehungsmethoden zu verstehen.
- Geburt und Kindersterblichkeit im 18. Jahrhundert
- Wandel des Familienbildes vom „ganzen Haus“ zur „Kernfamilie“
- Rollenverteilung von Mann und Frau in der bürgerlichen Familie
- Erziehung und Privatunterricht im Bildungsbürgertum
- Goethes Kindheitserfahrungen im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Autobiographien als Quelle für sozialgeschichtliche Einblicke in vergangene Epochen. Sie hebt Goethes „Dichtung und Wahrheit“ als repräsentatives Werk des 18. Jahrhunderts hervor und betont den Anspruch des Autors, „den Menschen in seinen Zeitverhältnissen“ darzustellen. Das Motto „Der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen“ wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Familienlebens und der Erziehung im 18. Jahrhundert eingeführt.
2. Hauptteil: Der Hauptteil ist in mehrere Unterkapitel gegliedert, die verschiedene Aspekte des Familienlebens und der Erziehung im 18. Jahrhundert detailliert untersuchen. Er analysiert die hohe Kindersterblichkeit, die Veränderungen im Familienbild, die Rollenverteilung von Mann und Frau und die Praktiken der Erziehung und des Privatunterrichts im Bildungsbürgertum. Die Kapitel greifen auf historische Quellen und Goethes eigene Schilderungen zurück, um ein umfassendes Bild der damaligen Verhältnisse zu zeichnen. Der Fokus liegt auf der Synthese von individuellen Erfahrungen (Goethes) und gesellschaftlichen Realitäten.
2.1 Geburt und Kindersterblichkeit in der Familie: Dieses Kapitel beginnt mit der Beschreibung von Goethes Geburt, die der Autor mit astrologischen Details und symbolischer Bedeutung auflädt. Es wird die hohe Kinder- und Säuglingssterblichkeit im 18. Jahrhundert thematisiert und die Gründe dafür, wie Infektionen und Epidemien, sowie die Risiken bei der Geburt, erläutert. Goethes eigene Erfahrung mit den Pocken wird als Beispiel für die weitverbreiteten Kinderkrankheiten und die damit verbundenen Todesfälle herangezogen. Die Verbesserung des Hebammenwesens im Zuge der Ereignisse um Goethes Geburt wird als Kontextualisierung des Themas verwendet.
Schlüsselwörter
Goethe, Dichtung und Wahrheit, Familienleben, Bildungsbürgertum, 18. Jahrhundert, Kindersterblichkeit, Erziehung, Rollenverteilung, Sozialgeschichte, Autobiographie.
Goethes „Dichtung und Wahrheit“: Häufige Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht sozialgeschichtliche Aspekte des Familienlebens und der Erziehung im Frankfurter Bildungsbürgertum des 18. Jahrhunderts anhand von Goethes „Dichtung und Wahrheit“. Sie beleuchtet Themen wie Geburt und Kindersterblichkeit, den Wandel des Familienbildes, die Rollenverteilung von Mann und Frau sowie Erziehungsmethoden und Privatunterricht.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in Unterkapitel, die detailliert auf folgende Themen eingehen: Geburt und Kindersterblichkeit im 18. Jahrhundert, den Wandel vom „ganzen Haus“ zur „Kernfamilie“, die Rollenverteilung von Mann und Frau in der bürgerlichen Familie, Erziehung und Privatunterricht im Bildungsbürgertum sowie Goethes Kindheitserfahrungen im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Wie wird Goethes „Dichtung und Wahrheit“ in dieser Arbeit verwendet?
Goethes Autobiographie dient als primäre Quelle, um Einblicke in die Lebenswirklichkeit des Frankfurter Bildungsbürgertums im 18. Jahrhundert zu gewinnen. Die Arbeit analysiert Goethes Schilderungen, um die damaligen Moralvorstellungen, Familienstrukturen und Erziehungsmethoden zu verstehen und setzt diese in den Kontext der gesellschaftlichen Realitäten.
Welche Aspekte der Kindersterblichkeit werden behandelt?
Das Kapitel über Geburt und Kindersterblichkeit thematisiert die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit im 18. Jahrhundert, die Gründe dafür (Infektionen, Epidemien, Geburtsrisiken), und veranschaulicht dies anhand von Goethes eigener Erfahrung mit den Pocken. Die Entwicklung des Hebammenwesens wird ebenfalls als Kontextualisierung einbezogen.
Wie wird der Wandel des Familienbildes beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den Wandel vom traditionellen „ganzen Haus“ zur „Kernfamilie“ und analysiert die damit verbundenen Veränderungen in den Familienstrukturen und den Rollen von Männern und Frauen im bürgerlichen Milieu des 18. Jahrhunderts.
Welche Rolle spielen die Geschlechterrollen?
Die Arbeit untersucht die Rollenverteilung von Mann und Frau in der bürgerlichen Familie des 18. Jahrhunderts, basierend auf Goethes Darstellung und dem historischen Kontext.
Wie werden Erziehung und Privatunterricht dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Praktiken der Erziehung und des Privatunterrichts im Bildungsbürgertum des 18. Jahrhunderts, basierend auf Goethes Erfahrungen und den damaligen gesellschaftlichen Normen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Dichtung und Wahrheit, Familienleben, Bildungsbürgertum, 18. Jahrhundert, Kindersterblichkeit, Erziehung, Rollenverteilung, Sozialgeschichte, Autobiographie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, anhand von Goethes „Dichtung und Wahrheit“ sozialgeschichtliche Aspekte des Familienlebens und der Erziehung im Frankfurter Bildungsbürgertum des 18. Jahrhunderts zu beleuchten und ein umfassendes Bild der damaligen Verhältnisse zu zeichnen, indem individuelle Erfahrungen mit gesellschaftlichen Realitäten synthetisiert werden.
- Citation du texte
- Katrin Fischotter (Auteur), 2003, Familienleben und Privaterziehung im Frankfurt Mitte des 18. Jahrhunderts.Sozialgeschichtliches zum ersten Teil von Goethes Dichtung und Wahrheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29357