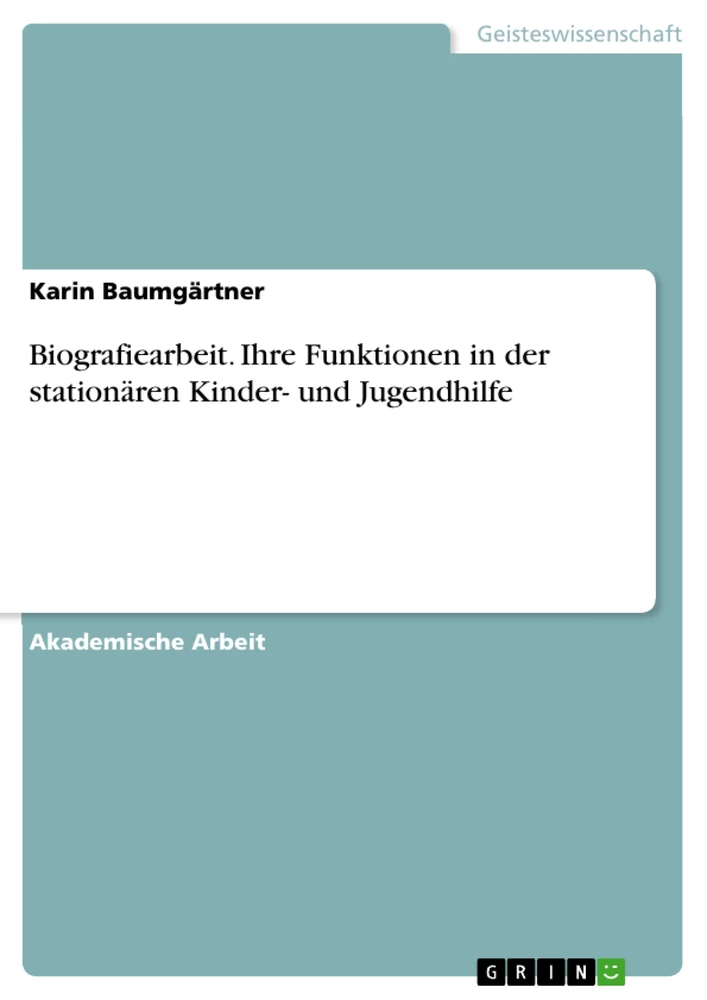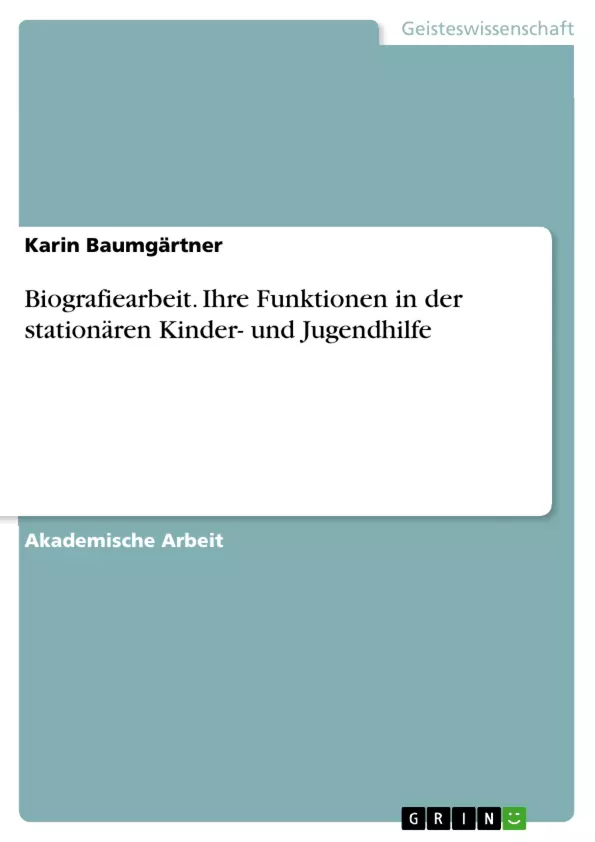In dieser Arbeit geht es um die stationäre Kinder- und Jugendhilfe als Ort für Biografiearbeit und die Funktionen der Biografiearbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe.
Biografiearbeit hat ihren Ausgangspunkt immer in der Gegenwart und übernimmt im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe die Aufgabe, „… ihre Klientel bei der ˏVerknotung` … alltäglicher Biografie zu unterstützen, indem sie orientiert am Alltag der BiografieträgerInnen … ihr biografisches Gewordensein im Kontext und im Kontinuum der Lebensgeschichte thematisiert.“ (Jansen, 2009a, 21). Deshalb ist es wichtig, den Alltag und die Rahmenbedingungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie den Kontext und die Lebenswelt dieser Kinder und Jugendlicher zu betrachten. In beiden Kapiteln soll lediglich ein Abriss gegeben werden, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Im Anschluss soll ganz konkret für das Feld der Kinder- und Jugendhilfe Voraussetzungen für und Anforderungen an den Sozialarbeiter beschrieben werden. Außerdem wird auf die Funktionen der Biografiearbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe als Ort für Biografiearbeit
- Alltag und Rahmenbedingungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Kontext und Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen
- Voraussetzungen und Anforderungen an den Sozialarbeiter
- Funktionen der Biografiearbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Identität und Integration
- Stabilisierung und Hilfe zur Bewältigung
- Aktivierung von Ressourcen
- Definition und Funktion von Ressourcen
- Kohärenz
- Resilienz
- Beziehungsaufbau und -gestaltung
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der stationären Kinder- und Jugendhilfe als Ort für Biografiearbeit und untersucht die Funktionen der Biografiearbeit in diesem Kontext. Sie analysiert die Rahmenbedingungen und den Alltag der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie die Lebenswelt der dort betreuten Kinder und Jugendlichen. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen und Anforderungen an den Sozialarbeiter in diesem Arbeitsfeld beleuchtet.
- Identität und Integration
- Stabilisierung und Hilfe zur Bewältigung
- Aktivierung von Ressourcen
- Beziehungsaufbau und -gestaltung
- Lebensweltorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Alltag und die Rahmenbedingungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Es werden die Unterschiede zwischen dem Familienleben und der künstlichen Gemeinschaft im Heim aufgezeigt, sowie die Herausforderungen der Mitarbeiterfluktuation und der Doppelrolle der Pädagogen als Arbeitskräfte und Bezugspersonen. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung der Lebensweltorientierung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und ihre fünf Dimensionen: Lebenslauf und Übergänge, subjektive Wahrnehmung, soziale Bezüge, Zeit, Raum und soziale Beziehungen sowie Selbsthilfe und Empowerment.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Funktionen der Biografiearbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Es werden die Bedeutung der Biografiearbeit für Identität und Integration, Stabilisierung und Hilfe zur Bewältigung sowie die Aktivierung von Ressourcen und den Beziehungsaufbau und -gestaltung erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Biografiearbeit, Lebensweltorientierung, Ressourcenaktivierung, Beziehungsarbeit, Identität, Integration, Stabilisierung, Hilfe zur Bewältigung, Sozialarbeit, Partizipation, Bezugserzieher, Heimerziehung, Hilfen zur Erziehung, SGB VIII.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Biografiearbeit in der Jugendhilfe?
Biografiearbeit soll Kindern und Jugendlichen helfen, ihre eigene Lebensgeschichte zu verstehen, Identität zu entwickeln und Brüche in ihrem Lebenslauf zu integrieren.
Welche Funktionen übernimmt die Biografiearbeit konkret?
Zu den Hauptfunktionen gehören die Stabilisierung in Krisen, die Aktivierung persönlicher Ressourcen, die Förderung der Resilienz und die Unterstützung beim Beziehungsaufbau.
Was bedeutet Lebensweltorientierung in diesem Kontext?
Es bedeutet, die Arbeit an den alltäglichen Erfahrungen, sozialen Bezügen und der subjektiven Wahrnehmung der Jugendlichen auszurichten, um Selbsthilfe und Empowerment zu fördern.
Welche Anforderungen werden an Sozialarbeiter gestellt?
Sozialarbeiter müssen eine professionelle Haltung einnehmen, die Balance zwischen Arbeitskraft und Bezugsperson halten und sensibel mit den oft traumatischen Biografien umgehen.
Was versteht man unter Ressourcenaktivierung?
Dabei geht es darum, vorhandene Stärken und Fähigkeiten (Ressourcen) der Jugendlichen sichtbar zu machen und zu nutzen, um die Bewältigung des Alltags zu erleichtern.
- Quote paper
- Karin Baumgärtner (Author), 2010, Biografiearbeit. Ihre Funktionen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293642