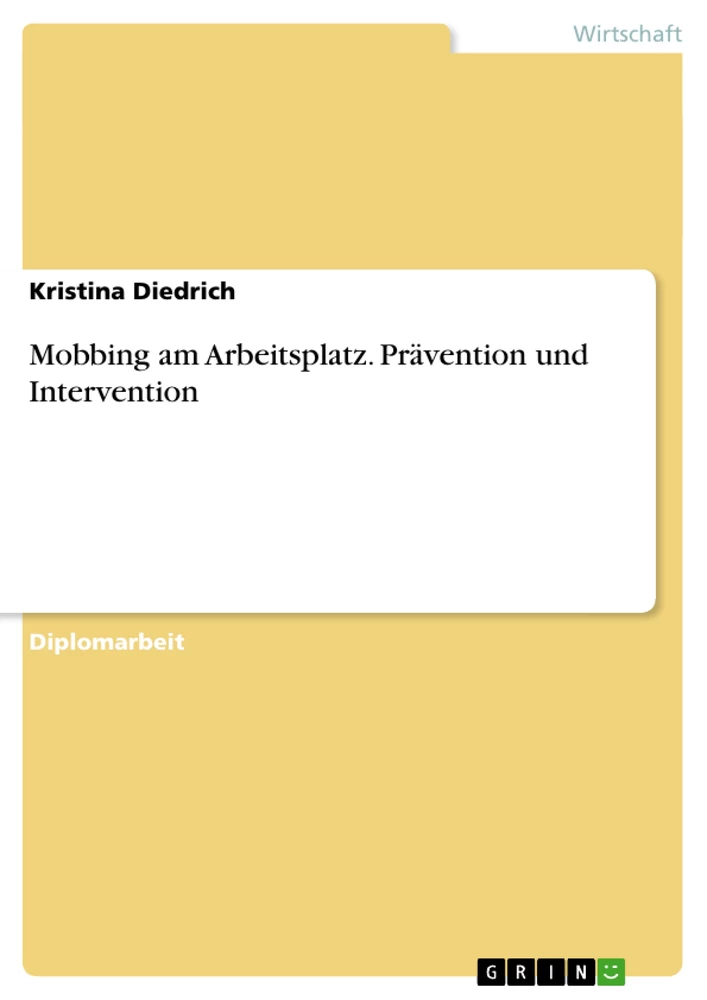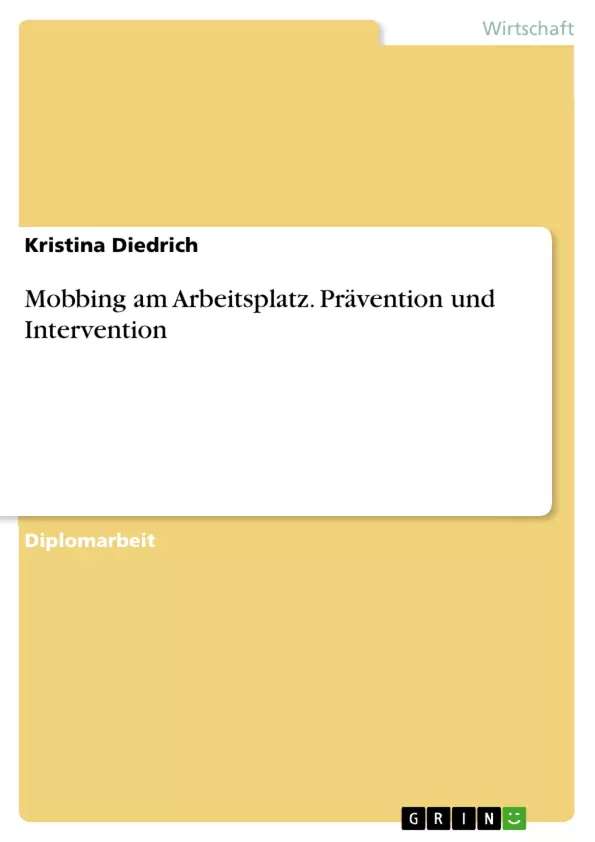Die Einleitung der vorliegenden Arbeit dient zunächst der Hinführung zum Thema, der Formulierung der Problemstellung sowie einer konkreten Zielsetzung. Dabei wird insbesondere
auf die richtige Verwendung des Begriffs Mobbing, mögliche Ursachen, Konsequenzen und den notwendigen Bedarf an Handlungsstrategien hingewiesen. In der Zielsetzung wird aufgezeigt, dass für das Verständnis der Arbeit grundlegende Kenntnisse unerlässlich sind und daher zu Beginn vermittelt werden sollten. Zudem erfolgt im Abschnitt Vorgehensweise eine Erklärung zur Strukturierung und einige kurze Anmerkungen hinsichtlich der einzelnen Bestandteile der Arbeit. Eine Darstellung alternativer Formen unfairen Verhaltens am Arbeitsplatz soll eine Abgrenzung des Mobbing-Begriffs erleichtern und zeigen, dass noch andere Arten feindseliger Übergriffe im Unternehmen existieren.
In den Kapiteln zwei und drei erfolgt eine ausführliche Darstellung des Phänomens Mobbing. Im ersten Teil werden dabei insbesondere die Entstehung und Wortherkunft betrachtet sowie nachfolgend einige prägende Definitionen verschiedener Autoren herausgegriffen und diskutiert. Zudem werden Erscheinungsformen, Handlungsarten und aufschlussreiche Mobbing-Modelle aufgezeigt. Kapitel vier gewährt einen Einblick in die Entwicklung und den Stand der Mobbing-Forschung und versucht anhand konkreter Zahlen, das Ausmaß, die Häufigkeit, die Dauer sowie den Zusammenhang zwischen einigen soziodemographischen Größen und Mobbing zu verdeutlichen. Nachfolgender Teil der Arbeit beschreibt mögliche Ursachen des Mobbing. Das Augenmerk richtet sich hierbei insbesondere auf betriebliche Größen als mobbingbegünstigende Einflussfaktoren.
Im nächsten Abschnitt erfolgt eine Veranschaulichung unterschiedlicher Auswirkungen feindseliger Übergriffe am Arbeitsplatz. Dabei werden schwerwiegende Konsequenzen
für den Betroffenen selbst, dessen soziales und privates Umfeld sowie wirtschaftliche und finanzielle Folgen für das gesamte Unternehmen und letztendlich auch für die Gesellschaft beschrieben.
Das letzte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit präventiven und interventiven Maßnahmen von Seiten des Betroffenen, des Unternehmens, des Vorgesetzten und anderer
Interessenvertreter. Dabei soll vor allem gezeigt werden, welche Vorkehrungen zu treffen sind, um Mobbing im Voraus zu vermeiden bzw. welche Maßnahmen sich bei einem bereits bestehenden Mobbing-Prozess als sinnvoll erweisen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise
- 1.4 Alternative Formen unfairen Verhaltens im Unternehmen
- 1.4.1 Phänomene unfairer Attacken am Arbeitsplatz
- 1.4.2 Instrumente unfairer Attacken am Arbeitsplatz
- 2 Grundlagen von Mobbing
- 2.1 Geschichte und Wortherkunft
- 2.2 Begriffsdefinition
- 2.2.1 Definition nach Leymann
- 2.2.2 Kritik an Leymanns Definition
- 2.2.3 Weitere Definitionen
- 2.3 Typologie der Handlungen
- 2.3.1 Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen
- 2.3.2 Angriffe auf die sozialen Beziehungen
- 2.3.3 Auswirkungen auf das soziale Ansehen
- 2.3.4 Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation
- 2.3.5 Angriffe auf die Gesundheit
- 2.4 Die 45 Mobbing-Handlungen
- 2.5 Kritik an den 45 Mobbing-Handlungen
- 2.6 Mehrdimensionales Mobbing-Modell von Zuschlag
- 2.7 Interaktion von Täter und Opfer
- 2.8 Das vier- bzw. fünfstufige Phasenkonzept von Leymann
- 2.8.1 Phase 1: Die täglichen Konflikte
- 2.8.2 Phase 2: Der Psychoterror beginnt
- 2.8.3 Phase 3: Rechtsverletzungen treten auf
- 2.8.4 Phase 4: Ärztliche und psychologische Fehldiagnosen
- 2.8.5 Phase 5: Der Ausstieg aus dem Arbeitsleben
- 2.9 Kritische Anmerkungen zu Leymanns Phasenkonzept
- 3 Erscheinungsformen von Mobbing
- 3.1 Horizontale Angriffe
- 3.2 Vertikale Angriffe
- 3.2.1 Angriffe von Vorgesetzten gegen Untergebene
- 3.2.2 Angriffe von Untergebenen gegen den Vorgesetzten
- 3.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede
- 4 Entwicklung und heutiger Stand der Forschung
- 4.1 Verbreitung
- 4.2 Häufigkeit und Dauer
- 4.3 Soziodemographische Faktoren
- 5 Ursachen von Mobbing
- 5.1 Fehlerhaftes Führungsverhalten
- 5.2 Arbeitsorganisation
- 5.3 Arbeitsgestaltung
- 5.4 Unternehmenskultur
- 5.5 Ethik und Moral am Arbeitsplatz
- 5.6 Persönlichkeitsbezogene Merkmale
- 5.7 Soziale Stellung des Opfers im Unternehmen
- 5.8 Kommunikationsprobleme
- 6 Auswirkungen von Mobbing
- 6.1 Gesundheitliche Folgen für den Betroffenen
- 6.1.1 Körperliche Beschwerden
- 6.1.2 Psychische Probleme
- 6.2 Auswirkungen auf das private Umfeld
- 6.3 Auswirkungen auf das Unternehmen
- 6.3.1 Auswirkungen auf das Betriebsklima
- 6.3.2 Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit
- 6.4 Auswirkungen auf die Gesellschaft
- 7 Strategien zur Bekämpfung von Mobbing
- 7.1 Präventive Maßnahmen von Seiten des Unternehmens
- 7.1.1 Arbeitsgestaltung und Arbeitsplatzbedingungen
- 7.1.2 Betriebsklima und Arbeitszufriedenheit
- 7.1.3 Unternehmensphilosophie und -politik
- 7.1.4 Offene Kommunikationsstruktur
- 7.2 Präventive Maßnahmen von Seiten des Vorgesetzten
- 7.2.1 Führungsverhalten des Vorgesetzten
- 7.2.2 Mitarbeitergespräche führen
- 7.2.3 Erfolgreiche Mitarbeiterintegration
- 7.2.4 Konfliktgespräche und -bewältigung
- 7.2.5 Motivation der Mitarbeiter
- 7.3 Maßnahmen zur Intervention
- 7.3.1 Handlungsmöglichkeiten des Opfers
- 7.3.2 Handlungsmöglichkeiten der Kollegen
- 7.3.3 Handlungsmöglichkeiten weiterer Interessenvertreter
- 7.3.4 Handlungsmöglichkeiten der Führungskraft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Mobbing am Arbeitsplatz, seine Ursachen, Auswirkungen und mögliche Präventions- und Interventionsstrategien. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu vermitteln und Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Betroffene zu entwickeln.
- Definition und Erscheinungsformen von Mobbing
- Ursachen von Mobbing auf individueller und organisationaler Ebene
- Auswirkungen von Mobbing auf die Gesundheit, das private Umfeld und das Unternehmen
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Mobbing
- Interventionsstrategien bei bereits bestehendem Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Mobbings am Arbeitsplatz ein, beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit und die gewählte Vorgehensweise. Es werden zudem alternative Formen unfairen Verhaltens im Unternehmen beleuchtet, um Mobbing in einen breiteren Kontext einzuordnen und Abgrenzungen zu schaffen. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem sie den Rahmen und die Forschungsfrage definiert.
2 Grundlagen von Mobbing: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition von Mobbing. Es werden verschiedene Definitionen, darunter die bekannte Definition nach Leymann, vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Typologie der Mobbinghandlungen wird detailliert erläutert, verschiedene Modelle zur Beschreibung von Mobbing (z.B. das mehrdimensionale Mobbing-Modell von Zuschlag und das Phasenkonzept von Leymann) werden vorgestellt und deren Stärken und Schwächen analysiert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der komplexen Dynamik von Mobbing.
3 Erscheinungsformen von Mobbing: Hier werden verschiedene Erscheinungsformen von Mobbing unterschieden, insbesondere horizontale und vertikale Angriffe. Der Abschnitt beleuchtet die spezifischen Charakteristika der Angriffe von Vorgesetzten auf Untergebene und umgekehrt, sowie geschlechtsspezifische Unterschiede im Auftreten von Mobbing. Es wird analysiert, wie sich Mobbing je nach Hierarchieebene und Geschlecht manifestiert.
4 Entwicklung und heutiger Stand der Forschung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Mobbing. Es werden Daten zur Verbreitung, Häufigkeit und Dauer von Mobbing präsentiert, sowie soziodemografische Faktoren, die mit dem Auftreten von Mobbing in Verbindung stehen, analysiert. Das Kapitel bietet einen Einblick in die empirische Forschung zu Mobbing am Arbeitsplatz.
5 Ursachen von Mobbing: In diesem Kapitel werden die Ursachen von Mobbing auf individueller und organisationaler Ebene untersucht. Es werden Faktoren wie fehlerhaftes Führungsverhalten, problematische Arbeitsorganisation und -gestaltung, negative Unternehmenskultur, ethische Defizite, persönlichkeitsbezogene Merkmale von Tätern und Opfern, die soziale Stellung des Opfers sowie Kommunikationsprobleme als mögliche Ursachen beleuchtet. Die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und dem Auftreten von Mobbing werden detailliert dargelegt.
6 Auswirkungen von Mobbing: Dieser Abschnitt befasst sich mit den umfassenden Auswirkungen von Mobbing. Die gesundheitlichen Folgen für Betroffene (körperliche und psychische Beschwerden) werden ebenso erörtert wie die Auswirkungen auf das private Umfeld, das Unternehmen (Betriebsklima und Wirtschaftlichkeit) und die Gesellschaft. Der Fokus liegt auf den weitreichenden Konsequenzen von Mobbing auf verschiedenen Ebenen.
7 Strategien zur Bekämpfung von Mobbing: Das Kapitel widmet sich präventiven und interventiven Maßnahmen zur Bekämpfung von Mobbing. Es werden präventive Maßnahmen von Seiten des Unternehmens (Arbeitsgestaltung, Betriebsklima, Unternehmenskultur, Kommunikation), des Vorgesetzten (Führungsverhalten, Mitarbeitergespräche, Konfliktmanagement, Motivation) und interventive Maßnahmen für Opfer, Kollegen, weitere Interessenvertreter und Führungskräfte vorgestellt und diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Strategien, um Mobbing zu verhindern und zu bekämpfen.
Schlüsselwörter
Mobbing, Arbeitsplatz, Prävention, Intervention, Führungsverhalten, Unternehmenskultur, Arbeitsgestaltung, Gesundheit, psychische Belastung, Konfliktmanagement, soziale Beziehungen, soziodemografische Faktoren, Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen zu: Diplomarbeit über Mobbing am Arbeitsplatz
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Mobbing am Arbeitsplatz. Sie behandelt Definitionen, Erscheinungsformen, Ursachen, Auswirkungen und Strategien zur Prävention und Intervention. Die Arbeit analysiert verschiedene Mobbing-Modelle, untersucht den aktuellen Forschungsstand und entwickelt Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Betroffene.
Welche Definitionen von Mobbing werden behandelt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen von Mobbing, mit besonderem Fokus auf Leymanns Definition und deren Kritik. Zusätzlich werden weitere Definitionen vorgestellt und verglichen, um ein differenziertes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen.
Welche Arten von Mobbing werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen horizontalem und vertikalem Mobbing (Angriffe von Vorgesetzten auf Untergebene und umgekehrt). Geschlechtsspezifische Unterschiede im Auftreten von Mobbing werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Ursachen für Mobbing werden untersucht?
Die Ursachenforschung betrachtet sowohl individuelle als auch organisatorische Faktoren. Dazu gehören fehlerhaftes Führungsverhalten, problematische Arbeitsorganisation und -gestaltung, negative Unternehmenskultur, ethische Defizite, persönlichkeitsbezogene Merkmale von Tätern und Opfern, die soziale Stellung des Opfers und Kommunikationsprobleme.
Welche Auswirkungen hat Mobbing?
Die Arbeit beschreibt die weitreichenden Auswirkungen von Mobbing auf die Gesundheit der Betroffenen (körperliche und psychische Beschwerden), das private Umfeld, das Unternehmen (Betriebsklima und Wirtschaftlichkeit) und die Gesellschaft.
Welche Präventions- und Interventionsstrategien werden vorgestellt?
Es werden präventive Maßnahmen auf Unternehmensebene (Arbeitsgestaltung, Betriebsklima, Unternehmenskultur, Kommunikation) und auf Ebene der Führungskräfte (Führungsverhalten, Mitarbeitergespräche, Konfliktmanagement, Motivation) sowie interventive Maßnahmen für Opfer, Kollegen, weitere Interessenvertreter und Führungskräfte vorgestellt und diskutiert.
Welche Modelle zur Beschreibung von Mobbing werden verwendet?
Die Arbeit verwendet und analysiert das mehrdimensionale Mobbing-Modell von Zuschlag und das Phasenkonzept von Leymann, um die komplexe Dynamik von Mobbing zu verstehen und zu beschreiben.
Welchen Forschungsstand berücksichtigt die Arbeit?
Die Arbeit gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Mobbing, inklusive Daten zur Verbreitung, Häufigkeit, Dauer und soziodemografischen Faktoren im Zusammenhang mit Mobbing.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobbing, Arbeitsplatz, Prävention, Intervention, Führungsverhalten, Unternehmenskultur, Arbeitsgestaltung, Gesundheit, psychische Belastung, Konfliktmanagement, soziale Beziehungen, soziodemografische Faktoren, Forschungsstand.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis von Mobbing am Arbeitsplatz zu vermitteln und Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Betroffene zu entwickeln.
- Quote paper
- Kristina Diedrich (Author), 2003, Mobbing am Arbeitsplatz. Prävention und Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29375