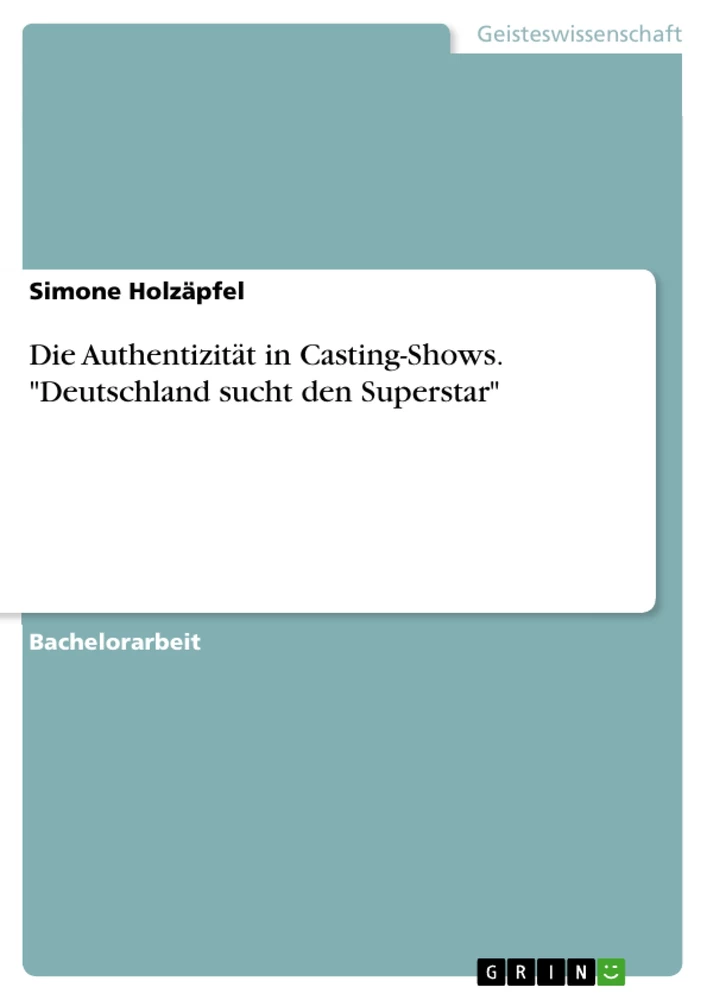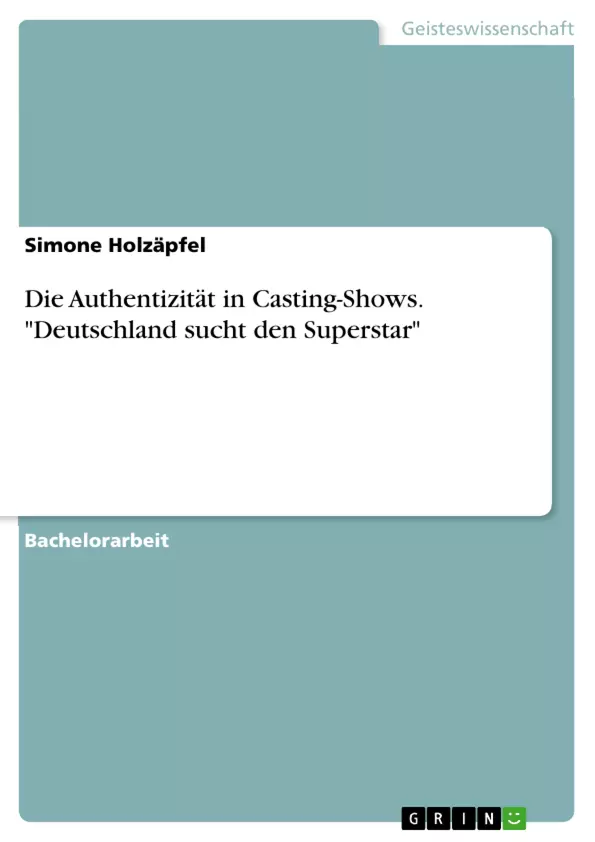Das Format der Castingshow hat sich in den letzten Jahren in nahezu allen privaten Fernsehsendern etabliert. Ein besonders populärer Vertreter dieses Formats ist die Show Deutschland sucht den Superstar (DSDS), die im Jahre 2003 als „Beste Unterhaltungssendung“ mit dem Deutschen Fernsehpreis
ausgezeichnet wurde und durchschnittlich Einschaltquoten von über fünf Millionen Zuschauern erreicht. Dabei besteht das Erfolgskonzept vor allem darin, das meist junge Publikum über einen längeren Zeitraum emotional an die Sendung zu binden.
Der zentrale Aspekt im Hinblick auf die Rezeption von Castingshows ist die Authentizität der Kandidaten, die zu einer Identifikation durch die Zuschauer führt. Damit sich eine Empathie zwischen dem Rezipienten und den Kandidaten
entwickelt, bedient sich das Format unterschiedlicher Inszenierungs- und Marketingstrategien. Beispielsweise wird die emotionale Bindung zum Kandidaten zusätzlich dadurch verstärkt, dass das Publikum per Televoting einen
vermeintlichen Einfluss auf das Siegen und Scheitern des Favoriten hat. Bei genauerer Betrachtung setzt sich DSDS aus einem hochkomplexen, crossmedialen Konzept zusammen, bei dem mehrere Medien von dem Produkt Castingshow profitieren. Somit wird die wöchentliche Sendung am Samstagabend zusätzlich durch ein Magazin ergänzt, das die Kandidaten in
privaten Situationen zeigt und dem Rezipienten die Möglichkeit bietet, eine noch intensivere Beziehung zu seinem Favoriten aufzubauen.
In der Arbeit soll gezielt auf die Frage eingegangen werden, inwieweit man von einer Authentizität der Kandidaten sprechen kann oder inwiefern sie ein Konstrukt der Medien darstellen. Bei der Untersuchung werden die verschiedenen Elemente und Phänomene der Castingshow stets unter dem Aspekt der Authentizität sowie der Identifikation beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Authentizität und Identifikation in der Medienwissenschaft
- 2.2 Parasoziale Interaktion
- 2.3 Identifikation anhand gezielter Marketingstrategien
- 2.4 Casting-Show als liminale Phase?
- 2.5 Allgemeine Struktur von Castingshows
- 2.5.1 Bedeutung der Elemente Jury, Kandidaten und Publikum
- 2.5.2 Struktur der Castings und Live-Shows
- 3. Konstruierte Realität- Analyse ausgewählter Filmsequenzen
- 3.1 Kamera- und Lichtdramaturgie in den Liveshows
- 3.2 Einsatz und Bedeutung von Musik
- 3.3 Verhalten und Reaktionen der Kandidaten
- 4. Schlussbemerkung
- 5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Authentizität in Castingshows, insbesondere in "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Die Arbeit analysiert, inwieweit die dargestellte Authentizität der Kandidaten tatsächlich gegeben ist oder ein Konstrukt der Medien darstellt. Dabei werden die verschiedenen Elemente der Show unter dem Aspekt der Authentizität und Identifikation beleuchtet.
- Analyse der Authentizität von Kandidaten in Castingshows
- Untersuchung der Rolle von Medieninszenierung und Marketingstrategien
- Bedeutung der parasozialen Interaktion zwischen Zuschauern und Kandidaten
- Wirkung von Kameraführung, Licht und Musik auf die Rezeption
- Die Castingshow als liminale Phase für die Kandidaten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt das weit verbreitete Format der Castingshow und den Erfolg von DSDS vor. Sie betont die emotionale Bindung des Publikums an die Sendung und die zentrale Rolle der Authentizität der Kandidaten für die Rezeption. Die Arbeit skizziert die Forschungsfrage nach dem Grad der Authentizität der Kandidaten und kündigt die methodischen Vorgehensweisen an, die die verschiedenen Elemente der Show unter dem Aspekt der Authentizität und Identifikation beleuchten werden. Der einführende Teil hebt die interdisziplinäre Natur der Untersuchung hervor, die medienwissenschaftliche, kommunikationswissenschaftliche und theaterwissenschaftliche Perspektiven einbezieht.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Authentizität in Castingshows. Es definiert den Begriff der Authentizität im Kontext der Medienrealität und des Glaubwürdigkeitsprinzips. Es erörtert die Bedeutung der parasozialen Interaktion für die Identifikation des Publikums mit den Kandidaten. Weiterhin werden Marketingstrategien analysiert, die die emotionale Bindung und Identifikation fördern, und die Castingshow als liminale Phase betrachtet, basierend auf den Theorien Victor Turners. Das Kapitel beschreibt außerdem die allgemeine Struktur von Castingshows, einschließlich der Rolle von Jury, Kandidaten und Publikum, und differenziert zwischen Castings und Live-Shows hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Rezeption.
Schlüsselwörter
Authentizität, Castingshow, Deutschland sucht den Superstar (DSDS), Medienrealität, Identifikation, parasoziale Interaktion, Marketingstrategien, Liminalität, Kameraführung, Lichtdramaturgie, Musik, Rezeption, Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Authentizität in Castingshows
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Authentizität von Kandidaten in Castingshows, speziell am Beispiel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Es wird analysiert, inwieweit die dargestellte Authentizität der Kandidaten tatsächlich gegeben ist oder ein Konstrukt der Medien darstellt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Castingshow unter dem Gesichtspunkt der Authentizität und Identifikation. Dazu gehören die Analyse der Authentizität der Kandidaten, die Rolle von Medieninszenierung und Marketingstrategien, die Bedeutung der parasozialen Interaktion zwischen Zuschauern und Kandidaten, die Wirkung von Kameraführung, Licht und Musik auf die Rezeption und die Castingshow als liminale Phase für die Kandidaten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf medienwissenschaftliche, kommunikationswissenschaftliche und theaterwissenschaftliche Perspektiven. Es werden Theorien zur Authentizität in der Medienrealität, zum Glaubwürdigkeitsprinzip, zur parasozialen Interaktion und zur Liminalität (Victor Turner) herangezogen. Marketingstrategien zur Förderung emotionaler Bindung und Identifikation werden ebenfalls analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Analyse ausgewählter Filmsequenzen (Kamera- und Lichtdramaturgie, Musik, Verhalten der Kandidaten), eine Schlussbemerkung und ein Literaturverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Elemente der Castingshow (Kameraführung, Licht, Musik, Verhalten der Kandidaten) unter dem Aspekt der Authentizität und Identifikation. Die genauen methodischen Vorgehensweisen werden in der Einleitung näher erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Authentizität, Castingshow, Deutschland sucht den Superstar (DSDS), Medienrealität, Identifikation, parasoziale Interaktion, Marketingstrategien, Liminalität, Kameraführung, Lichtdramaturgie, Musik, Rezeption, Glaubwürdigkeit.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen der Einleitung (Einführung in das Thema und die Forschungsfrage), der theoretischen Grundlagen (Definitionen und Theorien zur Authentizität, parasozialer Interaktion etc.) und weiterer Kapitel, die die Analyse der Authentizität in DSDS vertiefen.
- Citation du texte
- M.A. Simone Holzäpfel (Auteur), 2012, Die Authentizität in Casting-Shows. "Deutschland sucht den Superstar", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293878