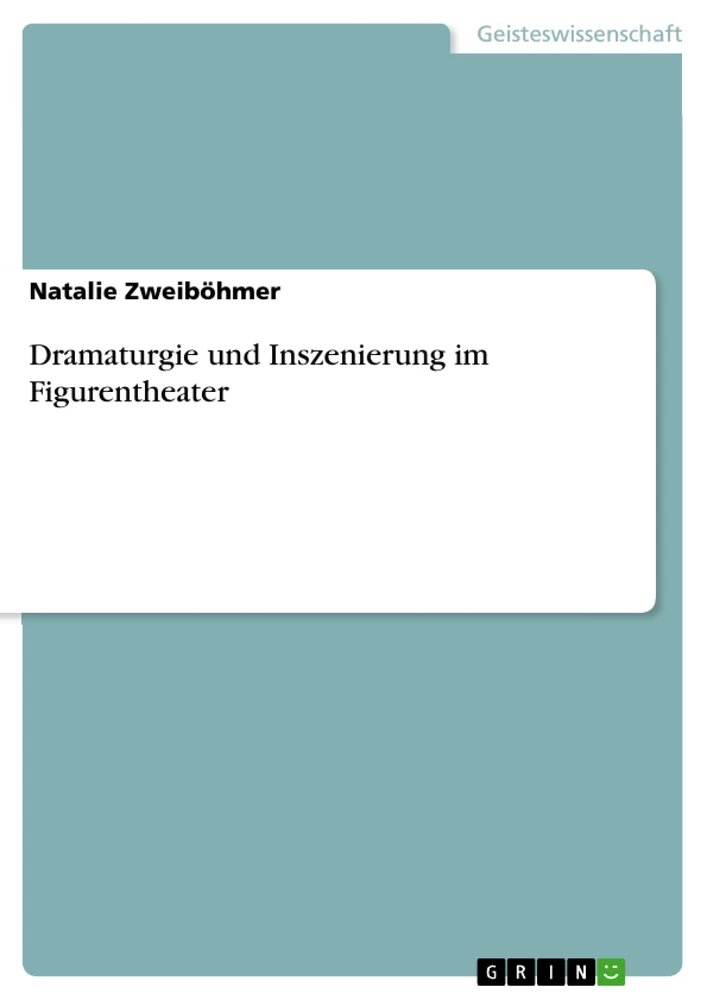Von einer Spielidee, von einem Bild, einem Gedanken über Assoziationen konstruierend zum Ereignis der Schönheit zu gelangen, mit Wortzauberei Bilder durch die Ohren zu infiltrieren, grandeur und misère des Lebens auf die Bühne zu bringen und frohes Erstaunen oder wildes Entsetzen hervorzurufen, Vergnügen, Genuss, Betroffen- oder Ergriffenheit macht aus dem Figurentheater eine rauschende Festlichkeit des Geistes.
Wo dialogischer Text nicht mehr Grundlage eines narrativen Theaterstücks ist, weicht der Inszenierungsprozess einem Prozess der Stückfindung, an dessen Anfang Ideen für den szenischen Umgang mit Objekten stehen: Aus visuellen Eindrücken, bildkünstlerischen Prozessen, psychologischen Beobachtungen, gesellschaftskritischen Impulsen, intellektuellen Spielen, aufgeschnappten Handlungsminiaturen oder sonst woher tauchen sie auf. Ein solcher erster Impuls, von dem der Dramaturg vermutet, dass er das Potential für eine Dramatisierung enthält, muss im Stückfindungsprozess durch Assoziationen erweitert, in bildkünstlerischen Ausdruck transformiert, in szenisches Handeln umgesetzt und ästhetisch verdichtet werden, um letztendlich in einen stimmigen Ablauf eingeschrieben werden zu können. Dabei ist die Verwendung von Sprache keine conditio sine qua non mehr. Wo Sprache aber verwendet wird, kann sie dialogischer Natur, Lyrik oder Prosa sein. Sie kann selbst ganz reduziert werden auf bedeutungslosen präverbalen Ausdruck, wie Stöhnen und Stammeln, oder sich im semantischen Irrgarten des Nonsens bewegen.
Ein derartiger Prozess der Stückfindung birgt durch den Verzicht auf logisch-lineare Handlung grundsätzlich die Gefahr, dass er ins Beliebige verläuft, belanglos wird und die Lust des Zuschauers nicht wach zu halten vermag. Was aber diesen Prozess ausmacht und welche Komponenten ihm zugehörig sind, ist ein zugleich theoretisches Problem wie ein praktisches und soll auch als ein solches doppelgesichtiges im folgenden erfasst werden. Damit aber erhebt der vorliegende Versuch den Anspruch, Handreichung zu sein auf dem Weg postdramatischer Stückentwicklungsprozesse.
Aus dem gesammelten Material, das für dieses Buch zusammengetragen wurde, aus allen Teilaspekten, hat sich nach langen Phasen raumartig vernetzter Gedankenbezüge am Ende eine lineare, argumentative Textform herauskristallisiert, obschon der Prozess der Erarbeitung dieses Buches ein assoziativer und fraktaler war, der sich erst zum Schluss hin in logische Linearität einschreiben ließ.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Dramaturgie
- Erzählstrukturen in Drama und Film - Von Helden und Konflikten
- Das Wahre ist unausdrückbar - Sinnstiftung im postdramatischen Erzählen
- Figurentheater im Wandel – Ein postdramatisches Genre
- Figurentheater ist anders
- Sampling und Fraktale - Suchen, verwerfen und montieren als dramaturgische Verfahren
- Der spatial turn – Wo mehr als eins zusammenkommt, ist Raum
- Animierte Objekte und Spielebenen
- Die Rolle am Nagel – Das Spiel mit Identitäten
- Ich will dir mal was flüstern - Wenn der Souffleur zur Rolle wird
- Wo Lords bei Ratten schlafen - Die Gesellschaft der Figuren
- Verwirrung, Intrige und gute Ratschläge - Über Funktionsfiguren
- Von diebischen Liebenden und teuflischen Richtern - Figurenmotive
- Choreographie
- Stottern, Stammeln, Dialog und Poesie - Das Dirigat der Stimmen
- Kollektives Handeln - Das Dirigat der Körper
- Entfaltung in Zeit und Raum
- Im Hexenkessel der Farben
- Von Koffern und Besen - Die Requisiten
- Das Kleine ganz groß - Zu Proportion und Kontrast
- Leidenschaft und Schweigen - Vom Szenenwechsel
- Prozess, Präsenz und Ereignis
- Schmetterlinge leben nur einen Sommer
- Der schöpferische Zuschauer
- Happy pills und Moral – Das Drama im Dienst der Ästh/ethik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Dramaturgie und Inszenierung im Figurentheater. Sie analysiert die Besonderheiten des Genres und zeigt auf, wie sich die Dramaturgie im Laufe der Zeit entwickelt hat. Dabei werden verschiedene Aspekte der Inszenierung beleuchtet, wie z.B. die Verwendung von Sprache, die Gestaltung von Figuren und die Rolle des Publikums.
- Die Entwicklung der Dramaturgie im Figurentheater
- Die Besonderheiten des Figurentheaters als Genre
- Die Rolle von Sprache, Figuren und Publikum in der Inszenierung
- Die Bedeutung von Raum und Zeit in der Inszenierung
- Die ästhetischen und ethischen Aspekte der Dramaturgie
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Dramaturgie im Figurentheater beleuchtet. Es wird erläutert, wie die Dramaturgie im Laufe der Zeit von einer traditionellen, textbasierten Form zu einer postdramatischen, objektbasierten Form entwickelt hat. Im zweiten Kapitel werden die Erzählstrukturen in Drama und Film analysiert, wobei der Fokus auf den Helden und den Konflikten liegt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Sinnstiftung im postdramatischen Erzählen und zeigt auf, wie die Dramaturgie im Figurentheater neue Wege der Bedeutungsproduktion erschließt. Das vierte Kapitel analysiert den Wandel des Figurentheaters und zeigt auf, wie es sich zu einem postdramatischen Genre entwickelt hat. Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten des Figurentheaters und zeigt auf, wie es sich von anderen Theaterformen unterscheidet. Das sechste Kapitel analysiert die dramaturgischen Verfahren des Samplings und der Fraktale, die im Figurentheater häufig eingesetzt werden. Das siebte Kapitel befasst sich mit dem "spatial turn" und zeigt auf, wie der Raum im Figurentheater eine wichtige Rolle spielt. Das achte Kapitel analysiert die Rolle von animierten Objekten und Spielebenen in der Inszenierung. Das neunte Kapitel befasst sich mit dem Spiel mit Identitäten und zeigt auf, wie Figuren im Figurentheater verschiedene Rollen einnehmen können. Das zehnte Kapitel analysiert die Rolle des Souffleurs im Figurentheater und zeigt auf, wie er zur Rolle werden kann. Das elfte Kapitel befasst sich mit der Gesellschaft der Figuren und zeigt auf, wie Figuren im Figurentheater miteinander interagieren. Das zwölfte Kapitel analysiert die Funktionsfiguren und zeigt auf, wie sie die Handlung des Stückes beeinflussen. Das dreizehnte Kapitel befasst sich mit den Figurenmotiven und zeigt auf, wie sie die Figuren und die Handlung des Stückes prägen. Das vierzehnte Kapitel analysiert die Choreographie im Figurentheater und zeigt auf, wie sie die Bewegung der Figuren und die Dynamik der Inszenierung beeinflusst. Das fünfzehnte Kapitel befasst sich mit dem Dirigat der Stimmen und zeigt auf, wie Sprache im Figurentheater eingesetzt wird. Das sechzehnte Kapitel analysiert das Dirigat der Körper und zeigt auf, wie die Bewegung der Figuren die Inszenierung beeinflusst. Das siebzehnte Kapitel befasst sich mit der Entfaltung in Zeit und Raum und zeigt auf, wie die Inszenierung die Zeit und den Raum des Stückes gestaltet. Das achtzehnte Kapitel analysiert die Verwendung von Farben im Figurentheater und zeigt auf, wie sie die Stimmung und die Atmosphäre des Stückes beeinflussen. Das neunzehnte Kapitel befasst sich mit den Requisiten im Figurentheater und zeigt auf, wie sie die Inszenierung bereichern. Das zwanzigste Kapitel analysiert die Proportion und den Kontrast im Figurentheater und zeigt auf, wie sie die Inszenierung beeinflussen. Das einundzwanzigste Kapitel befasst sich mit dem Szenenwechsel im Figurentheater und zeigt auf, wie er die Dynamik der Inszenierung beeinflusst. Das zweiundzwanzigste Kapitel analysiert den Prozess, die Präsenz und das Ereignis im Figurentheater und zeigt auf, wie sie die Inszenierung prägen. Das dreiundzwanzigste Kapitel befasst sich mit der Lebensdauer von Schmetterlingen und zeigt auf, wie sie die Inszenierung beeinflussen. Das vierundzwanzigste Kapitel analysiert den schöpferischen Zuschauer und zeigt auf, wie er die Inszenierung beeinflusst. Das fünfundzwanzigste Kapitel befasst sich mit dem Drama im Dienst der Ästh/ethik und zeigt auf, wie die Inszenierung die Moral des Stückes beeinflusst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Dramaturgie, die Inszenierung, das Figurentheater, die postdramatische Dramaturgie, die Erzählstrukturen, die Sinnstiftung, die Raumgestaltung, die Figuren, die Sprache, die Choreographie, die Requisiten, die Ästhetik und die Ethik.
- Arbeit zitieren
- Natalie Zweiböhmer (Autor:in), 2015, Dramaturgie und Inszenierung im Figurentheater, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293970