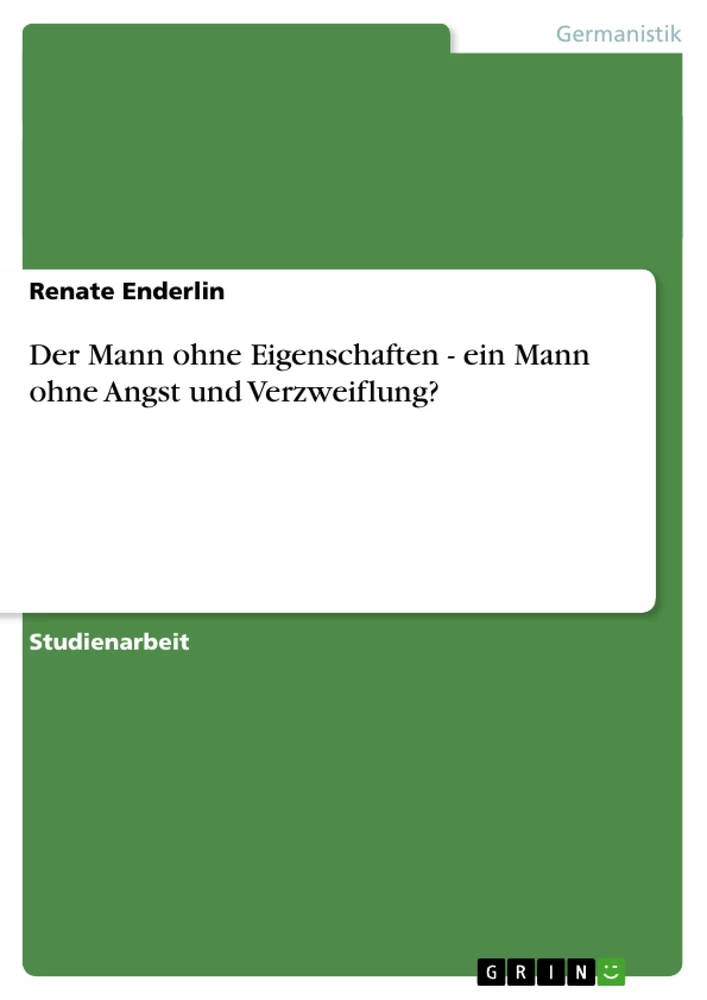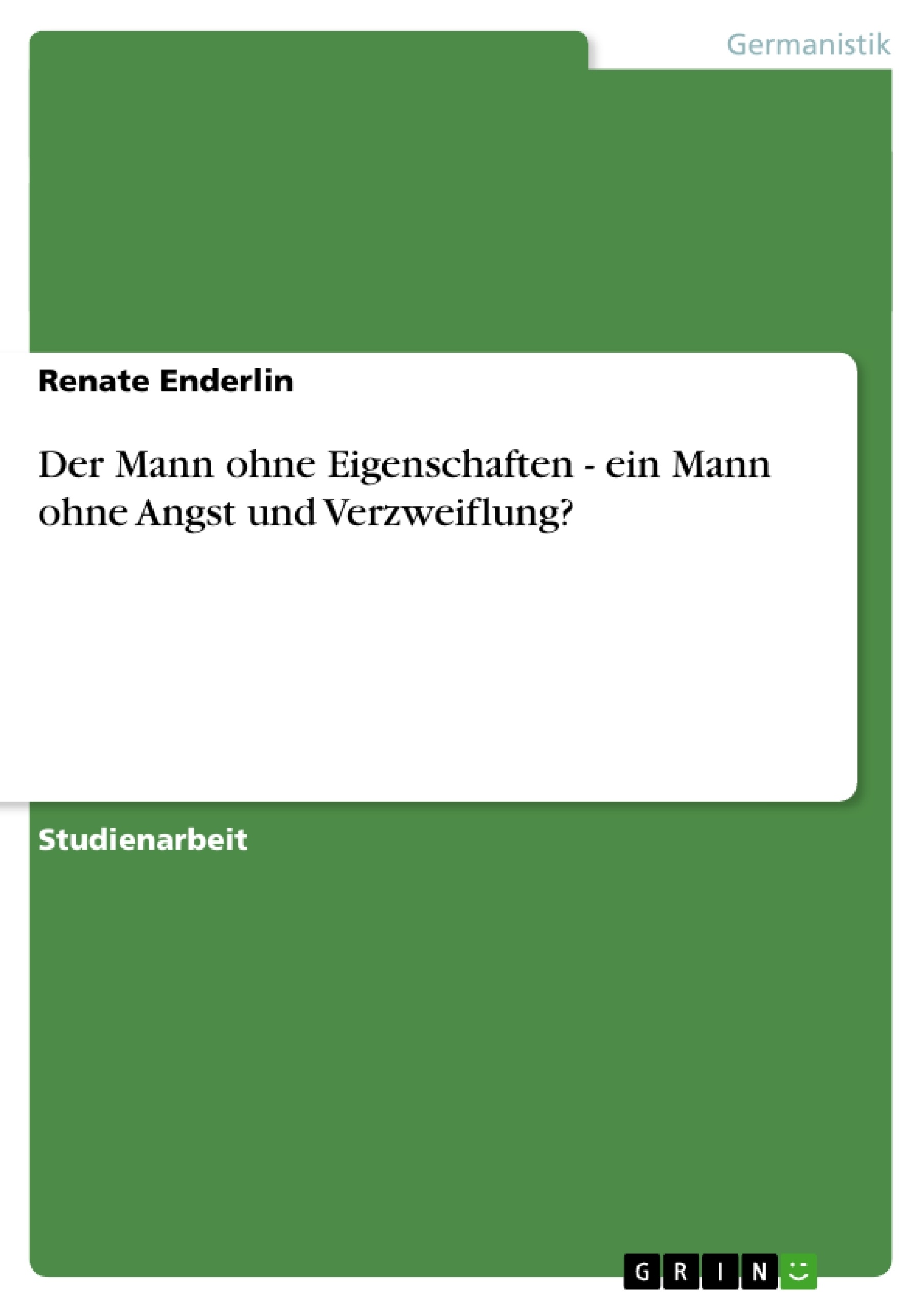In Anlehnung an den Aufsatz von Eugen Drewermann, der die Gedanken Søren Kierkegaards über Angst und Verzweiflung in die Neurosenlehre der Psychoanalyse überträgt, möchte ich die vier dort analysierten Formen der Verzweiflung (Zwangsneurose, Hysterie, Depression und Schizoidie) an einigen Figuren Musils aus Der Mann ohne Eigenschaften darstellen. Meine Seminararbeit versucht auch, Ulrich als Menschen zu beschreiben, der frei von Daseinsangst und deren Konsequenzen lebt – fern jeder Verzweiflung.
Ich möchte versuchen, einen Zusammenhang herzustellen, zwischen Ulrichs Streben nach einem essayistischen Lebensprogramm ohne Angst und Verzweiflung und seinem Denken als Möglichkeitsmensch. Zum besseren Verständnis der vier Formen der Verzweiflung werde ich diese nicht nur (negativ) am Mann ohne Eigenschaften zeigen (wie sie bei Ulrich gerade nicht auftreten), sondern auch (positiv) in ihrem Vorkommen bei anderen Figuren.
Dabei wäre es allerdings falsch, sich vorzustellen, das Schema der vier Verzweiflungsformen wäre bei Menschen tatsächlich streng gegliedert vorzufinden. Auch wenn Neurosenformen nicht nur als Krankheit oder als Konsequenz frühkindlicher Schäden zu sehen sind, sondern als „Spiegel von Konflikten die dem menschlichen Dasein insgesamt zukommen oder sogar deren Grundlage bilden“ , wäre es naiv, sich vorzustellen, es gäbe einen rein depressiven oder rein zwangsneurotischen Menschen. Diese vier Typen sind der Versuch einer vereinfachenden Darstellung seelischer Konflikte und menschlicher Verzweiflung. Weder treffen wir in unserer Wirklichkeit auf diese vier Typen in Reinform, noch in den Figuren in Der Mann ohne Eigenschaften.
Ich setze voraus, dass der Leser diese vier Kategorien als Werkzeug versteht, als Methode der Figurenanalyse ohne zu glauben, man könne die Figuren nach diesem Muster ausreichend charakterisieren. Daher werde ich zugleich immer auch mögliche Einwände anführen, warum die Figuren jenen Typen auch widersprechen. Sicher wäre es interessant, mehrere Charaktere nach diesem Schema zu analysieren und noch andere Belegstellen für eine Typisierung zu finden. Das übersteigt aber den zeitlichen Rahmen meiner Seminararbeit, deren Ziel die Charakterisierung Ulrichs, des Manns ohne Eigenschaften ist – als Mann ohne Angst und Verzweiflung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Verzweiflung und Angst - zwei Aspekte einer Figurenanalyse
- II. Verzweiflung als Konsequenz von Daseinsangst
- 1. Freiheit als Zwang?
- 2. Was ist Verzweiflung?
- 3. Die Angst des Menschen...
- III. Vier Formen der Verzweiflung
- 1. Die Zwangsneurose - Verzweiflung der Notwendigkeit
- 2. Hysterie - Verzweiflung der Möglichkeit
- 3. Depression - Verzweiflung der Unendlichkeit
- 4. Schizoidie - Verzweiflung der Endlichkeit
- IV. Heilung durch Literaturwissenschaft?
- V. Literaturhinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Darstellung von Angst und Verzweiflung bei Figuren in Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften". Das zentrale Ziel ist die Charakterisierung Ulrichs als einen Menschen, der frei von Daseinsangst und Verzweiflung lebt. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Ulrichs Streben nach einem essayistischen Lebensprogramm und seinem Denken als Möglichkeitsmensch.
- Angst und Verzweiflung als zentrale Aspekte der menschlichen Existenz
- Die vier Formen der Verzweiflung nach Kierkegaard und Drewermann (Zwangsneurose, Hysterie, Depression, Schizoidie)
- Die Rolle der Freiheit und deren Ambivalenz
- Figurenanalyse im Kontext der philosophischen Konzepte von Kierkegaard
- Ulrichs Lebenskonzept als Gegenmodell zu den Verzweiflungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Verzweiflung und Angst – zwei Aspekte einer Figurenanalyse: Diese Einleitung stellt die theoretische Grundlage der Arbeit dar. Sie beschreibt den Ansatz, die vier Formen der Verzweiflung nach Eugen Drewermann, basierend auf Kierkegaards Philosophie, auf Figuren aus Musils Roman anzuwenden. Die Arbeit beabsichtigt, Ulrich als Figur darzustellen, die frei von Daseinsangst und deren Konsequenzen ist. Der Fokus liegt auf der Analyse des Zusammenhanges zwischen Ulrichs Streben nach einem angst- und verzweiflungsfreien Leben und seinem Denken als Möglichkeitsmensch. Die Arbeit betont, dass die vier Verzweiflungsformen als analytisches Werkzeug dienen und keine starre Kategorisierung der Figuren ermöglichen.
II. Verzweiflung als Konsequenz von Daseinsangst: Dieses Kapitel erörtert die philosophischen Grundlagen der Arbeit, indem es Kierkegaards Konzepte von Angst, Freiheit und Verzweiflung beleuchtet. Der erste Abschnitt untersucht die Ambivalenz der Freiheit, die als Zwang empfunden werden kann und somit zu Angst führt. Der zweite Abschnitt definiert Verzweiflung als ein Missverhältnis im Selbstverhältnis, das aus dem Scheitern der Synthese von Möglichkeit und Notwendigkeit resultiert. Der dritte Abschnitt behandelt die Angst des Menschen, die als konstitutiv für sein Wesen betrachtet wird, untersucht die verschiedenen Arten von Angst und konzentriert sich auf die vier Formen, die später als Formen der Verzweiflung interpretiert werden.
Schlüsselwörter
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Angst, Verzweiflung, Daseinsangst, Freiheit, Möglichkeit, Notwendigkeit, Kierkegaard, Drewermann, Figurenanalyse, Zwangsneurose, Hysterie, Depression, Schizoidie, Ulrich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der Mann ohne Eigenschaften": Angst, Verzweiflung und Ulrich
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Darstellung von Angst und Verzweiflung bei Figuren in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Figur Ulrich und der Frage, inwiefern er frei von Daseinsangst und Verzweiflung lebt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Angst und Verzweiflung als zentrale Aspekte der menschlichen Existenz, untersucht die vier Formen der Verzweiflung nach Kierkegaard und Drewermann (Zwangsneurose, Hysterie, Depression, Schizoidie), beleuchtet die Rolle der Freiheit und deren Ambivalenz, analysiert Figuren im Kontext der philosophischen Konzepte Kierkegaards und untersucht Ulrichs Lebenskonzept als mögliches Gegenmodell zu den Verzweiflungsformen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt eine Figurenanalyse, basierend auf den vier Formen der Verzweiflung nach Eugen Drewermann (angelehnt an Kierkegaard). Diese Formen dienen als analytisches Werkzeug und ermöglichen keine starre Kategorisierung der Figuren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I stellt die theoretische Grundlage und den Ansatz dar. Kapitel II erörtert die philosophischen Grundlagen von Kierkegaard (Angst, Freiheit, Verzweiflung). Kapitel III analysiert die vier Formen der Verzweiflung. Kapitel IV befasst sich mit der Frage nach einer möglichen "Heilung" durch Literaturwissenschaft. Kapitel V enthält Literaturhinweise.
Welche Rolle spielt Kierkegaard in dieser Arbeit?
Kierkegaards Konzepte von Angst, Freiheit und Verzweiflung bilden die philosophische Grundlage der Arbeit. Seine Gedanken zu diesen Themen werden verwendet, um die Figuren in Musils Roman zu analysieren.
Wie wird Ulrich in dieser Arbeit dargestellt?
Ulrich wird als Figur dargestellt, die versucht, ein angst- und verzweiflungsfreies Leben zu führen. Sein Streben nach einem essayistischen Lebensprogramm und sein Denken als Möglichkeitsmensch stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Angst, Verzweiflung, Daseinsangst, Freiheit, Möglichkeit, Notwendigkeit, Kierkegaard, Drewermann, Figurenanalyse, Zwangsneurose, Hysterie, Depression, Schizoidie, Ulrich.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Das zentrale Ziel ist die Charakterisierung Ulrichs als einen Menschen, der frei von Daseinsangst und Verzweiflung lebt, und die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen seinem Streben nach einem angst- und verzweiflungsfreien Leben und seinem Denken als Möglichkeitsmensch.
- Citar trabajo
- Renate Enderlin (Autor), 2004, Der Mann ohne Eigenschaften - ein Mann ohne Angst und Verzweiflung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29413