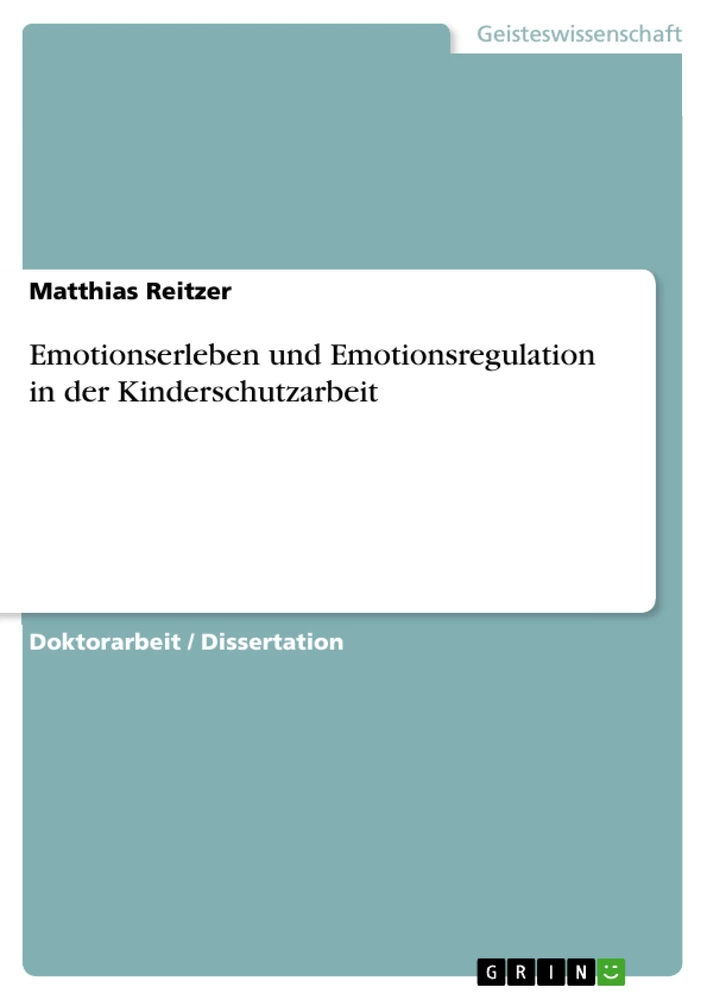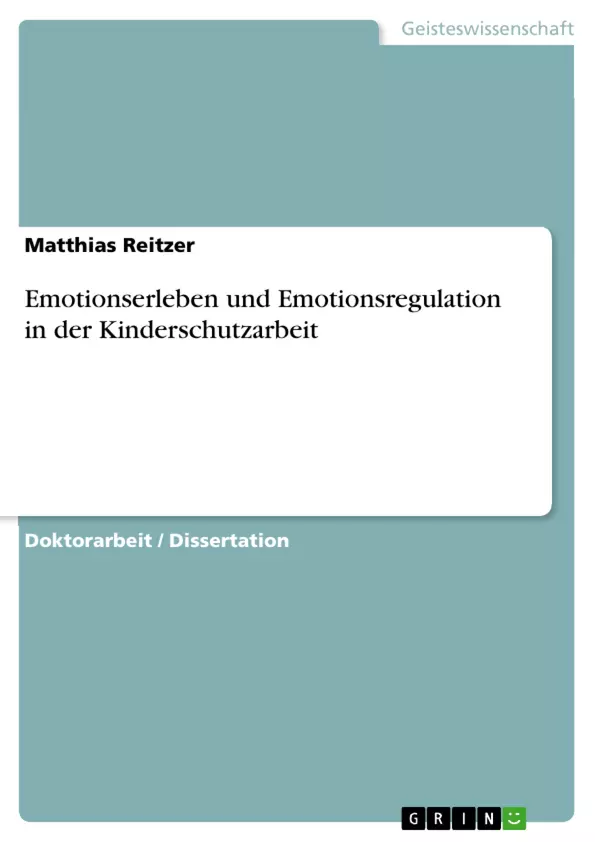Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Inhalte der Kinderschutzarbeit in Österreich und untersucht das Bewältigungsverhalten der MitarbeiterInnen im Umgang mit belastenden Situationen traumatisierter Opfer und deren Bezugssystem. Dabei wird der Fokus auf die Emotionsregulierungsstrategien der HelferInnen gelegt, geschlechtsspezifische Unterschiede erforscht und der Umgang mit sekundären Traumatisierungen beleuchtet.
Figley (1995) prägte den Begriff der „compassion fatigue“, welchen er als eine natürliche, vorhersehbare, behandelbare und verhinderbare unerwünschte Folge der Arbeit mit traumatisierten Menschen definiert und durch Gleichgültigkeitsgefühle, Hypervigilanz, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten charakterisiert.
Der zweite Aspekt, der in dieser Arbeit beleuchtet wird, ist das Emotionserleben und die Emotionsregulation der HelferInnen in den Kinderschutzeinrichtungen.
Der Großteil der Befragten sah sich als wenig „compassion fatigue“- und „burnout“-gefährdet, aber erlebte hohe Zufriedenheit durch die Tätigkeit (Frauen signifikant höher als Männer). Allerdings zeigten sich weder Geschlechtsunterschiede noch Unterschiede in der Berufserfahrung.
Wut, Überforderung und Traurigkeit wurden am häufigsten bei den als subjektiv schwierig erlebten Gefühlen in der Klientenarbeit genannt.
In nahezu allen Strategien gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Geschlecht und Berufsjahren.
Ein signifikanter Unterschied zeigte sich in der selten angewandten Strategie „blackout“, wobei die weniger berufserfahrenen diese Strategie häufiger angaben als die Befragten mit höherer Berufserfahrung.
Ein nahezu signifikanter Geschlechtsunterschied zeigte sich in der Strategie „soziale Unterstützung“, wobei die weiblichen Kolleginnen diese Strategie öfter anwenden als die männlichen Kollegen.
Die Hypothesen dieser Arbeit konnten also nur teilweise bestätigt werden. Allerdings geben die Daten einen guten Einblick in die Kinderschutzarbeit und lassen sich für Maßnahmen der Psychohygiene nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG UND THEORIE
- Geschichte der Kinderschutzarbeit
- Definition und Aufgaben der Kinderschutzzentren
- Kinderschutzgruppen in Österreich
- Traumatischer Stress
- Sekundäre Traumastörungen
- Mitgefühlserschöpfung
- Compassion satisfaction
- Burnout
- Abgrenzung von Burnout zur posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
- Auswirkungen der sekundären Traumastörungen auf Kognitionen und Emotionen
- Gegenübertragungen der TherapeutInnen
- Exkurs zur Emotion Ärger:
- Geschlechtsunterschiede bei sekundären Traumastörungen
- Emotionspsychologie
- Was ist eine Emotion?
- Emotionsregulation
- Geschlechtsunterschiede im emotionalen Verhalten
- Emotionsregulation und Alter
- Zum Zusammenhang zwischen traumatischen Stress und Emotionsregulation
- Ableitung der Fragestellungen und Hypothesen
- METHODE
- Beschreibung der Datenerhebungsinstrumente
- Der „Compassion Fatigue/Satisfaction-Selbsttest“ von Stamm & Figley (2002)
- Fragebogen zur Emotionsregulation (EERQ) von Benecke et al. (2008)
- Versuchsdurchführung
- STATISTISCHE AUSWERTUNG UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
- Deskriptive Statistiken
- Versuchsteilnehmer
- Unterschiede im Alter zwischen männlichen und weiblichen Befragten
- Unterschiede in der Berufserfahrung
- Überprüfung der Normalverteilung aller Mittelwerte
- Auflistung der schwierigen Gefühle in der direkten Klientenarbeit
- Auswertung des „Compassion Fatigue/Satisfaction“-Selbsttests
- Überprüfung der Hypothese 1:
- Überprüfung der Hypothese 2:
- Überprüfung der Hypothese 3:
- Regressionsanalysen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- DISKUSSION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
- Qualitätssicherung und schwierige Gefühle in der Kinderschutzarbeit
- Ergebnisse des Compassion-Fatigue-Tests
- Der Einfluss des Geschlechts und der Berufserfahrung
- Der Einfluss der Emotionsregulierung
- Ableitung eines Modells
- Kritik an der vorliegenden Arbeit und Ausblick
- LITERATURVERZEICHNIS
- INHALTSVERZEICHNIS-ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit dem Emotionserleben und der Emotionsregulation von Fachkräften in der Kinderschutzarbeit. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen von sekundären Traumastörungen auf die Emotionen und Kognitionen von KinderschutzexpertInnen zu untersuchen. Dabei werden insbesondere die Auswirkungen von Mitgefühlserschöpfung und Compassion Satisfaction auf die Emotionsregulation und das emotionale Verhalten der Fachkräfte analysiert. Die Arbeit untersucht zudem den Einfluss von Geschlecht und Berufserfahrung auf die Emotionsregulation und das Auftreten von sekundären Traumastörungen.
- Sekundäre Traumastörungen in der Kinderschutzarbeit
- Emotionsregulation und ihre Bedeutung für die Arbeit mit traumatisierten Kindern
- Einfluss von Geschlecht und Berufserfahrung auf Emotionsregulation und sekundäre Traumastörungen
- Zusammenhang zwischen Mitgefühlserschöpfung und Compassion Satisfaction
- Entwicklung eines Modells zur Erklärung der Zusammenhänge zwischen Emotionsregulation, sekundären Traumastörungen und der Arbeit in der Kinderschutzarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kinderschutzarbeit ein und beleuchtet die Geschichte, Definition und Aufgaben von Kinderschutzzentren. Zudem werden die Konzepte des traumatischen Stresses, der sekundären Traumastörungen und der Emotionsregulation erläutert. Die Arbeit stellt die Bedeutung der Emotionsregulation für die Arbeit mit traumatisierten Kindern heraus und untersucht den Einfluss von Geschlecht und Berufserfahrung auf die Emotionsregulation und das Auftreten von sekundären Traumastörungen.
Das zweite Kapitel beschreibt die Methode der Datenerhebung und die verwendeten Fragebögen. Es werden der „Compassion Fatigue/Satisfaction-Selbsttest“ von Stamm & Figley (2002) und der Fragebogen zur Emotionsregulation (EERQ) von Benecke et al. (2008) vorgestellt. Die Versuchsdurchführung wird detailliert beschrieben.
Das dritte Kapitel präsentiert die statistische Auswertung der erhobenen Daten. Es werden deskriptive Statistiken zu den Versuchsteilnehmern, den Unterschieden im Alter und der Berufserfahrung sowie die Überprüfung der Normalverteilung aller Mittelwerte dargestellt. Die Auswertung des „Compassion Fatigue/Satisfaction“-Selbsttests und die Überprüfung der Hypothesen werden ebenfalls in diesem Kapitel behandelt.
Das vierte Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie und interpretiert die gewonnenen Erkenntnisse. Es werden die Qualitätssicherung und die schwierigen Gefühle in der Kinderschutzarbeit beleuchtet. Die Ergebnisse des Compassion-Fatigue-Tests werden interpretiert und der Einfluss von Geschlecht und Berufserfahrung auf die Emotionsregulation und das Auftreten von sekundären Traumastörungen wird analysiert. Die Arbeit leitet ein Modell zur Erklärung der Zusammenhänge zwischen Emotionsregulation, sekundären Traumastörungen und der Arbeit in der Kinderschutzarbeit ab und diskutiert kritisch die Ergebnisse der Studie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kinderschutzarbeit, sekundäre Traumastörungen, Emotionsregulation, Mitgefühlserschöpfung, Compassion Satisfaction, Geschlecht, Berufserfahrung, Burnout, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Traumatischer Stress, Emotionspsychologie, Gegenübertragung, und die Arbeit mit traumatisierten Kindern.
- Quote paper
- Matthias Reitzer (Author), 2013, Emotionserleben und Emotionsregulation in der Kinderschutzarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294215