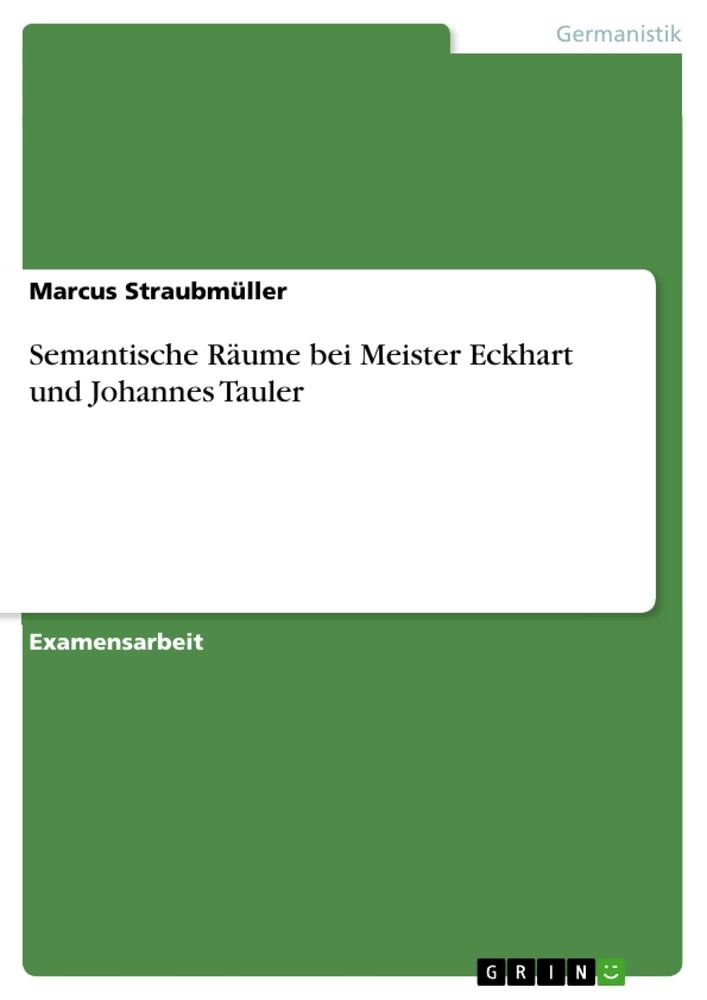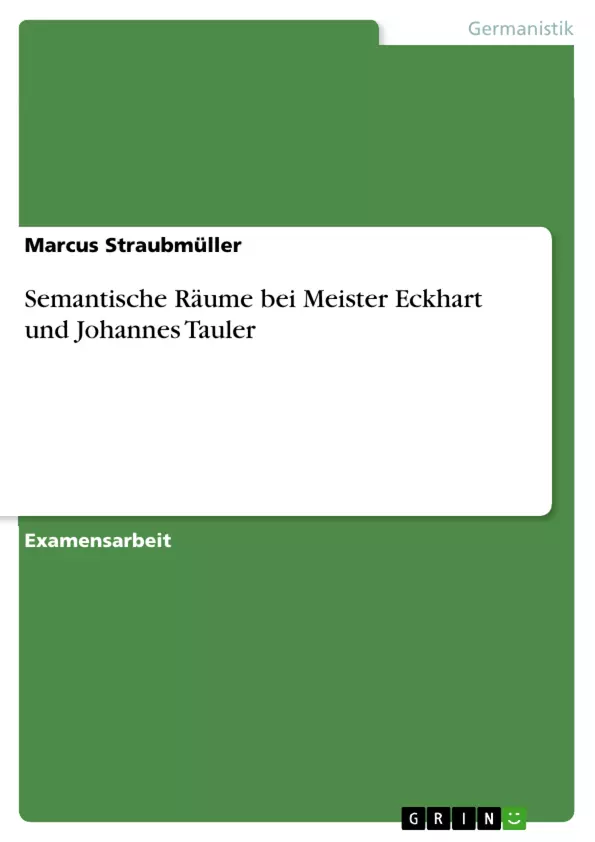Der Dominikaner Meister Eckhart (ca. 1260-1328) entwickelte im Laufe seines Schaffens eine eigene Theologie und Philosophie, die bereits zu seinen Lebzeiten viele faszinierte und bis heute immer wieder neu entdeckt wurde. Er war Lehrer von Heinrich Seuse und wohl auch von Johannes Tauler, die häufig als Dreigestirn der Dominikanermystik bezeichnet werden. Für letzteren steht es außer Frage, dass der Sinn und Zweck des Menschen darin besteht, die Einheit, bzw. das Einssein mit Gott zu erlangen. Welche Hindernisse den Menschen davon abhalten aus der irdischen Ordnung in die göttliche zu wechseln und wie der Mensch dennoch eine Grenzüberschreitung vollziehen kann, davon handeln praktisch alle Predigten. Im Vergleich zu Eckharts theologisch-spekulativem Konzept, entwickelt Tauler einen erfahrungsbasierten Predigtstil, der sich mehr an der geistlichen Praxis orientiert. Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe das ‚Weltmodell der deutschen Mystik‘ mit Hilfe der Lotmanschen Raumsemantik zu rekonstruieren. Dieses Modell wird sodann auf ausgewählte Werke der angesprochenen Mystiker Meister Eckhart und Johannes Tauler angewendet. Analysiert werden zum einen das Traktat Vom edlen Menschen und die Predigt 54 A von Meister Eckhart, sowie Johannes Taulers Predigten 21 und 39.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jurij M. Lotmans Theorie semantischer Räume - Grundlagen und Weiterentwicklungen
- 2.1 Zur Funktion räumlicher Vorstellungen - Der Raum als ‚Link‘ zwischen Denksystem und sozialer Praxis
- 2.2 Der Text als sekundäres modellbildendes System
- 2.3 Die sujetlose Textschicht - Semantische Räume und Weltmodell
- 2.3.1 Der Begriff der Grenze
- 2.3.2 Die interne Struktur semantischer Räume
- 2.4 Die sujethafte Textschicht - Handlung als Ereignis
- 2.4.1 Das Ereignis als revolutionäres Element
- 2.4.2 Der Held als Grenzgänger
- 2.4.3 Ereignistypen
- 2.5 Das Konsistenzprinzip als Motor der Handlung
- 2.5.1 Die Beziehung von Handlungsverlauf und Ereignisstruktur
- 2.5.2 To be continued - Extrempunktregel und Beuteholerschma
- 3. Weltmodell, Mystik - Der Mensch im Spannungsfeld verschiedener semantischer Räume
- 3.1 Der Raum des Irdischen
- 3.1.1 Der „innere“ und der „äußere“ Mensch
- 3.1.2 Die Seele des Menschen als Extrempunkt
- 3.2 Der Raum des Göttlichen
- 3.1 Der Raum des Irdischen
- 4. Die Darstellung des Undarstellbaren als Grenzüberschreitung
- 4.1 Die Transformation des Menschen
- 4.2 Die Transposition des Menschen
- 4.3 Die Zuwendung Gottes zum Menschen
- 5. Eine raumsemantische Analyse ausgewählter Predigten Meister Eckharts und Johannes Taulers
- 5.1 Meister Eckhart - Lehrmeister der deutschen Mystik
- 5.1.1 Vom edlen Menschen
- 5.1.1.1 Die zwei Naturen des Menschen - inner und äußer mensche
- 5.1.1.2 Die Beziehung des inneren Menschen zur göttlichen Ordnung
- 5.1.1.3 Die unmittelbare Gotteserfahrung - zur Struktur der unio
- 5.1.2 Predigt 54 A
- 5.1.2.1 Die Angleichung der Seele an ihren Ursprungszustand
- 5.1.2.2 Gottes Wirken im Seelengrunde
- 5.1.2.3 Die Grenzüberschreitung in den semantischen Raum des Göttlichen
- 5.1.1 Vom edlen Menschen
- 5.2 Johannes Tauler - Lebemeister der deutschen Mystik
- 5.2.1 Predigt 21 - Der Aufstieg als Weg in den doppelten Abgrund
- 5.2.1.1 Jerusalem - Friede im Unfrieden
- 5.2.1.2 Judäa - Gott erkennen und Gott loben
- 5.2.1.3 Samaria - Die Einheit mit Gott
- 5.2.2 Predigt 39 - Drei Stufen zu Gott
- 5.2.2.1 Der erste Grad - jubilacio
- 5.2.2.2 Der zweite Grad - getrenge
- 5.2.2.3 Der dritte Grad - übervart
- 5.2.1 Predigt 21 - Der Aufstieg als Weg in den doppelten Abgrund
- 5.1 Meister Eckhart - Lehrmeister der deutschen Mystik
- 6. Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit rekonstruiert das Weltmodell der deutschen Mystik mithilfe der Lotmanschen Raumsemantik und wendet dieses Modell auf ausgewählte Werke von Meister Eckhart und Johannes Tauler an. Ziel ist es, die in den mystischen Texten dargestellten Ordnungen und Konflikte zwischen diesen Ordnungen zu analysieren und zu verstehen, wie die Grenzüberschreitung zum Göttlichen sprachlich dargestellt und überwunden wird.
- Lotmans Raumsemantik als analytisches Werkzeug
- Das Weltmodell der deutschen Mystik
- Die Darstellung des Undarstellbaren (Gotteserfahrung)
- Analyse ausgewählter Texte von Meister Eckhart und Johannes Tauler
- Konflikte und Grenzüberschreitungen zwischen irdischem und göttlichem Raum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der sprachlichen Darstellung der mystischen Gotteserfahrung in den Texten der deutschen Mystik. Sie verortet die Arbeit im Kontext bestehender Forschungsdebatten um die Aufstiegs- und Abstiegsmystik und begründet die Verwendung der Lotmanschen Raumsemantik als analytisches Instrument zur Rekonstruktion des zugrundeliegenden Weltmodells.
2. Jurij M. Lotmans Theorie semantischer Räume - Grundlagen und Weiterentwicklungen: Dieses Kapitel präsentiert die Grundlagen der Lotmanschen Raumsemantik, die den Text als sekundäres modellbildendes System betrachtet, welches räumliche Vorstellungen nutzt, um nicht-räumliche Sachverhalte auszudrücken. Es wird die Funktion von semantischen Räumen als "Link" zwischen Denksystemen und sozialer Praxis erläutert und die Bedeutung von Grenzen und der internen Struktur dieser Räume hervorgehoben. Die Konzepte der sujetlosen und sujethaften Textschicht werden eingeführt und der Fokus auf das Ereignis als revolutionäres Element gelegt.
3. Weltmodell, Mystik - Der Mensch im Spannungsfeld verschiedener semantischer Räume: Dieses Kapitel beschreibt das Weltmodell der deutschen Mystik als Spannungsfeld zwischen dem Raum des Irdischen und dem Raum des Göttlichen. Der Mensch wird als Wesen dargestellt, das in beiden Räumen existiert, wobei die Seele als Extrempunkt zwischen diesen beiden Räumen fungiert. Der innere und äußere Mensch werden als zwei Aspekte menschlichen Seins vorgestellt.
4. Die Darstellung des Undarstellbaren als Grenzüberschreitung: Das Kapitel konzentriert sich auf die sprachliche Darstellung der mystischen Erfahrung, welche als Grenzüberschreitung zwischen den semantischen Räumen des Irdischen und des Göttlichen interpretiert wird. Die Transformation und Transposition des Menschen und Gottes Zuwendung zum Menschen werden als zentrale Aspekte dieser Grenzüberschreitung diskutiert.
5. Eine raumsemantische Analyse ausgewählter Predigten Meister Eckharts und Johannes Taulers: Dieses Kapitel wendet die Lotmansche Raumsemantik konkret auf ausgewählte Predigten von Meister Eckhart (Vom edlen Menschen und Predigt 54 A) und Johannes Tauler (Predigten 21 und 39) an. Es analysiert die jeweiligen Texte im Hinblick auf ihre Darstellung des Spannungsfelds zwischen irdischem und göttlichem Raum und die Art und Weise, wie die Grenzüberschreitung sprachlich gestaltet wird. Die einzelnen Unterkapitel untersuchen die spezifischen Argumentationslinien und Schlüsselbegriffe in den jeweiligen Predigten.
Schlüsselwörter
Deutsche Mystik, Jurij M. Lotman, Raumsemantik, Semantische Räume, Grenzüberschreitung, Weltmodell, Gotteserfahrung, Meister Eckhart, Johannes Tauler, unio mystica, irdischer Raum, göttlicher Raum, Transformation, Transposition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Raumsemantische Analyse ausgewählter Predigten Meister Eckharts und Johannes Taulers
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Weltmodell der deutschen Mystik, insbesondere bei Meister Eckhart und Johannes Tauler, mithilfe der Raumsemantik von Jurij M. Lotman. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Darstellung der Gotteserfahrung und der Grenzüberschreitung zwischen dem irdischen und dem göttlichen Raum.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet die Lotmansche Raumsemantik als analytisches Werkzeug. Diese Theorie betrachtet Texte als sekundäre modellbildende Systeme, die räumliche Vorstellungen nutzen, um nicht-räumliche Sachverhalte auszudrücken. Die Analyse konzentriert sich auf die Struktur semantischer Räume, Grenzen und die Darstellung von Ereignissen.
Welche Autoren und Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Predigten von Meister Eckhart ("Vom edlen Menschen" und Predigt 54 A) und Johannes Tauler (Predigten 21 und 39). Die Analyse konzentriert sich auf die jeweiligen Argumentationslinien und Schlüsselbegriffe, um die Darstellung des Spannungsfelds zwischen irdischem und göttlichem Raum zu untersuchen.
Wie wird die Gotteserfahrung in den Texten dargestellt?
Die Gotteserfahrung wird als Grenzüberschreitung zwischen den semantischen Räumen des Irdischen und des Göttlichen interpretiert. Die Arbeit untersucht die sprachlichen Mittel, mit denen diese Grenzüberschreitung – etwa durch Transformation und Transposition des Menschen – ausgedrückt wird.
Was ist das Weltmodell der deutschen Mystik nach dieser Arbeit?
Das Weltmodell der deutschen Mystik wird als Spannungsfeld zwischen dem Raum des Irdischen und dem Raum des Göttlichen dargestellt. Der Mensch existiert in beiden Räumen, wobei die Seele als Extrempunkt zwischen diesen beiden Räumen fungiert. Der "innere" und der "äußere" Mensch werden als zwei Aspekte menschlichen Seins betrachtet.
Welche Schlüsselkonzepte der Lotmanschen Raumsemantik werden verwendet?
Die Arbeit nutzt zentrale Konzepte der Lotmanschen Raumsemantik, wie semantische Räume, Grenzen, die sujetlose und sujethafte Textschicht, Ereignisse als revolutionäre Elemente und das Konsistenzprinzip.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie die mystische Gotteserfahrung in den Texten der deutschen Mystik sprachlich dargestellt wird. Die Arbeit untersucht außerdem die Struktur des zugrundeliegenden Weltmodells und die Konflikte und Grenzüberschreitungen zwischen irdischem und göttlichem Raum.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit rekonstruiert das Weltmodell der deutschen Mystik mittels der Lotmanschen Raumsemantik und analysiert, wie die Grenzüberschreitung zum Göttlichen in den ausgewählten Texten von Meister Eckhart und Johannes Tauler sprachlich dargestellt und überwunden wird. Die konkreten Ergebnisse sind im Kapitel 6 zusammengefasst.
- Citar trabajo
- Marcus Straubmüller (Autor), 2015, Semantische Räume bei Meister Eckhart und Johannes Tauler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294218