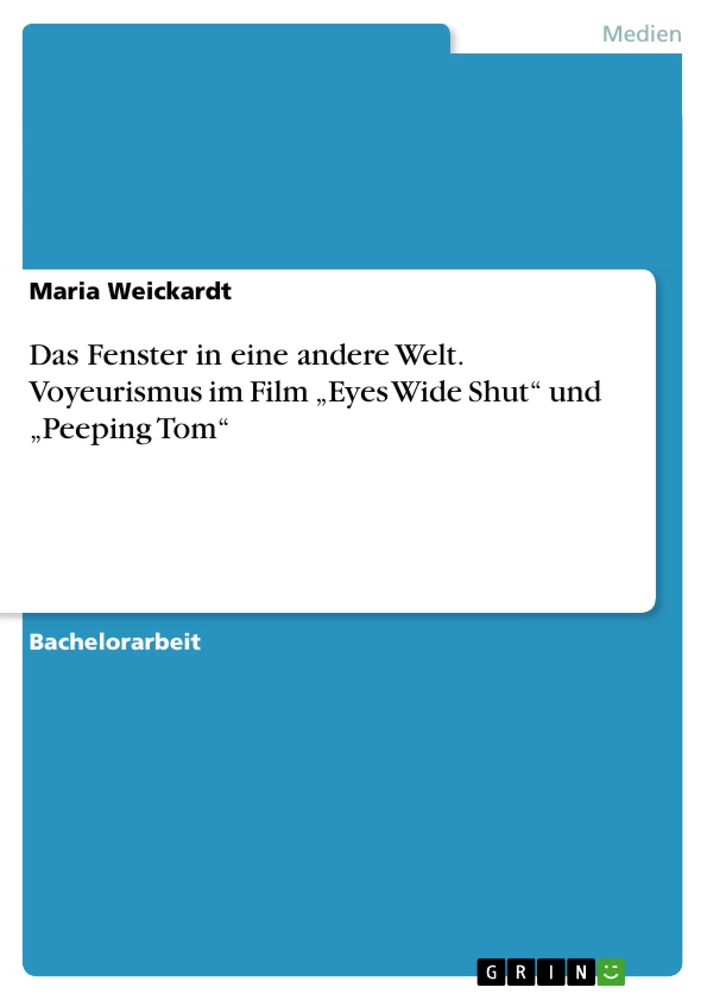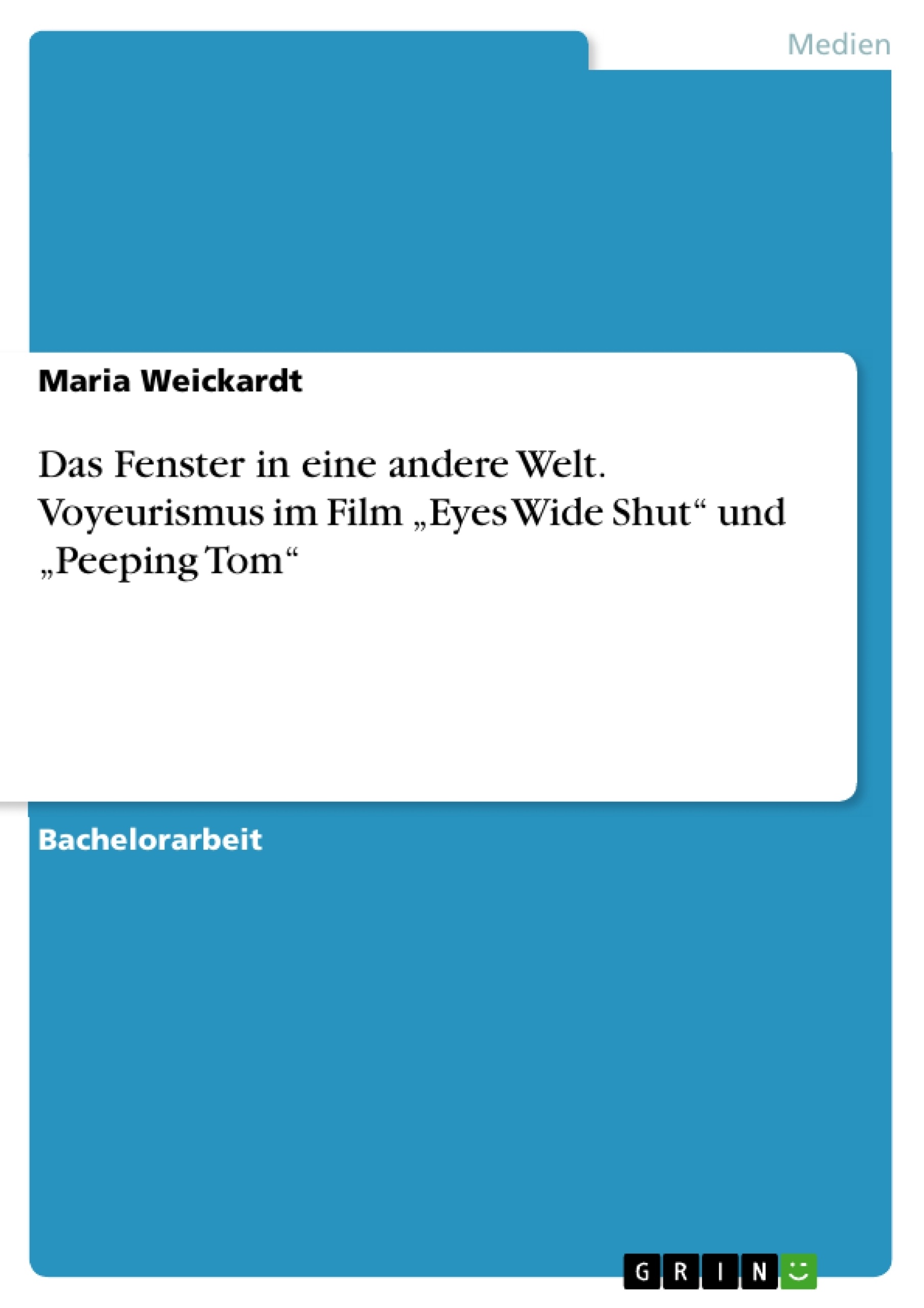Mit der Erfindung des kinematographischen Apparates wurde dem Einzelgänger eine neue Form der visuellen Lustbefriedigung eröffnet: der Film. Einige Kritiker bemängeln zwar, dass ihm das Moment der Unwissenheit der agierenden Person, ebenso wie die Gegenwärtigkeit des Dargestellten fehlt. (Vgl. Stadler 2005, S. 33) Trotzdem, so scheint es, haben es der Film und seine Verörtlichung, das Kino, geschafft, eine kollektive Schaulust zu institutionalisieren. Grauen, Morde und Sexualakte sind nun einem breiten Publikum zugänglich geworden und machen den Rezipienten zum Komplizen, zum Mitwissenden oder auch zum Voyeur:
„[The cinema] made voyeurs out of viewers […] [because] the camera’s lens is more real than the eye.” (Denzin 1995, S. 26)
Im Anschluss an diese These beschäftigt sich die folgende Arbeit mit der Frage, durch welche kinematographischen Besonderheiten und filmischen Stilmittel es möglich ist, Voyeurismus im Film zu erleben und den Rezipienten als Voyeur in die Narration einzubinden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Blickstrukturen im intradiegetischen Raum sowie zwischen dem Rezipienten und der Leinwand liegen. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Abhandlungen von Jean-Louis Baudry, Christian Metz, Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud, Jacques Lacan und Laura Mulvey. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen zur „Illusionsmaschine“ (Handschuh-Heß 2000, S.46) Kino und der Skopophilie des Rezipienten zu erlangen. Die Arbeit erhebt hierbei nicht den Anspruch, die Theorien in ihrer vollständigen Komplexität zu betrachten. Vielmehr geht es darum, sie als theoretische Grundlage für die Analyse der „Voyeurfilme“ (Denzin 1995, S. 7) „Peeping Tom“ und „Eyes Wide Shut“ anzusehen. Diese werden im zweiten Teil der Arbeit in Bezug auf ihre Blickstrukturen, ihren intradiegetischen Voyeurismus und ihre potenzielle Wirkung auf den Rezipienten untersucht. Anschließend werden beide Filme miteinander verglichen. Ziel der Arbeit ist es, das Gebiet der voyeuristischen Blickstrukturen im Film intensiv zu beleuchten, sie an Beispielen zu belegen und dabei interdisziplinär (Medienwissenschaft, Soziologie, Psychologie) eine Brücke zu schlagen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Schaulust, Voyeurismus, Skopophilie – ein Definitionsversuch
- 3 Kinematographischer Voyeurismus
- 3.1 Die symbolische Bedeutung der Leinwand
- 3.2 Der kinematographische Dispositiv nach Baudry
- 3.3 Der imaginäre Signifikant nach Metz
- 4 Die Skopophilie des Rezipienten/der Rezipientin
- 4.1 Der Blick des Anderen nach Sartre
- 4.2 Der perverse Blick nach Freud
- 4.3 Der abwesende Blick nach Lacan
- 4.4 Der männliche Blick nach Mulvey
- 4.5 Zusammenfassung der Theorien
- 5 Michael Powell: „Peeping Tom“
- 5.1 Die Blickstrukturen im Film
- 5.2 Die abwesende Mutter und der strafende Vater
- 5.3 Die Wirkungen auf den Rezipienten
- 6 Stanley Kubrick: „Eyes Wide Shut“
- 6.1 Die Blickstrukturen im Film
- 6.2 Der verbotene Blick und die Bedeutung der Maske
- 6.3 Traum oder Wirklichkeit?
- 6.4 Vergleich „Peeping Tom“ und „Eyes Wide Shut“
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den kinematographischen Voyeurismus anhand der Filme „Peeping Tom“ und „Eyes Wide Shut“. Ziel ist es, theoretische Grundlagen zum Phänomen der Schaulust im Film zu erarbeiten und diese auf die ausgewählten Filme anzuwenden. Dabei wird der Fokus auf die Blickstrukturen und die Einbindung des Rezipienten als Voyeur in die Narration gelegt.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Schaulust, Voyeurismus und Skopophilie
- Theorien zum kinematographischen Voyeurismus und zur Skopophilie des Rezipienten
- Analyse der Blickstrukturen in „Peeping Tom“ und „Eyes Wide Shut“
- Vergleich der filmischen Darstellung von Voyeurismus in beiden Filmen
- Wirkung des Voyeurismus auf den Rezipienten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Voyeurismus im Film ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den kinematographischen Besonderheiten und filmischen Stilmitteln, die Voyeurismus im Film ermöglichen und den Rezipienten als Voyeur einbinden. Sie benennt die ausgewählten Filme ("Peeping Tom" und "Eyes Wide Shut") und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Wandel des Voyeurismus vom einzelnen "Peeping Tom" zum kollektiven Zuschauererlebnis im Kino wird thematisiert.
2 Schaulust, Voyeurismus, Skopophilie - ein Definitionsversuch: Dieses Kapitel bietet eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Begriffen Schaulust, Voyeurismus und Skopophilie. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Voyeurismus", seine negative Konnotation im heutigen Sprachgebrauch und die unterschiedlichen psychologischen und soziologischen Perspektiven auf das Phänomen. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Voyeurismus als sexuell motiviertes Verhalten und als Pathologie des Blicks, wie sie von Widmer beschrieben wird.
3 Kinematographischer Voyeurismus: Dieses Kapitel erörtert die spezifischen Aspekte des Voyeurismus im Medium Film. Es analysiert die symbolische Bedeutung der Leinwand als semipermeable Fläche zwischen intra- und extradiegetischem Raum und diskutiert relevante theoretische Ansätze von Baudry, Metz und anderen, um den kinematographischen Voyeurismus zu verstehen. Der Film als Medium der kollektiven Schaulust wird hier beleuchtet.
4 Die Skopophilie des Rezipienten/der Rezipientin: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen theoretischen Perspektiven auf die Rolle des Zuschauers als Akteur der Skopophilie. Es analysiert den Blick des Anderen (Sartre), den perversen Blick (Freud), den abwesenden Blick (Lacan) und den männlichen Blick (Mulvey). Die Kapitel bieten einen umfassenden Überblick über die relevanten theoretischen Grundlagen, ohne dabei auf die vollständige Komplexität einzugehen.
5 Michael Powell: „Peeping Tom“: Die Zusammenfassung dieses Kapitels wird eine detaillierte Analyse der Blickstrukturen im Film "Peeping Tom" bieten, die Rolle der Mutter und des Vaters, und wie diese Aspekte den Voyeurismus im Film darstellen. Der Fokus liegt auf der Wirkung dieser filmischen Mittel auf den Zuschauer und wie diese Wirkung im Kontext der vorangegangenen theoretischen Überlegungen zu verstehen ist. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Verbindung von Voyeurismus und Gewalt gelegt.
6 Stanley Kubrick: „Eyes Wide Shut“: Diese Kapitel-Zusammenfassung analysiert die Blickstrukturen in "Eyes Wide Shut", die Bedeutung der Maske und des "verbotenen Blicks". Die Zusammenfassung wird untersuchen, inwiefern der Film Traum und Realität vermischt und wie dies die Wahrnehmung des Voyeurismus beeinflusst. Die Vergleichsansätze zu "Peeping Tom" werden ebenfalls in der Zusammenfassung berücksichtigt. Die Analyse wird die spezifischen filmischen Mittel Kubricks untersuchen und im Kontext der etablierten theoretischen Ansätze interpretieren.
Schlüsselwörter
Voyeurismus, Skopophilie, Schaulust, Kinematographischer Voyeurismus, Blickstrukturen, Film, Rezipient, „Peeping Tom“, „Eyes Wide Shut“, Laura Mulvey, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jean-Paul Sartre, Jean-Louis Baudry, Christian Metz.
Häufig gestellte Fragen zu: Kinematographischer Voyeurismus in "Peeping Tom" und "Eyes Wide Shut"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den kinematographischen Voyeurismus anhand der Filme "Peeping Tom" von Michael Powell und "Eyes Wide Shut" von Stanley Kubrick. Der Fokus liegt auf den Blickstrukturen in den Filmen und der Rolle des Zuschauers als Voyeur.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Theorien zum Voyeurismus und zur Skopophilie, darunter die Ansätze von Freud (perverser Blick), Lacan (abwesender Blick), Mulvey (männlicher Blick), Sartre (Blick des Anderen), Baudry (kinematographischer Dispositiv) und Metz (imaginärer Signifikant). Die Arbeit differenziert zwischen den Begriffen Schaulust, Voyeurismus und Skopophilie.
Welche Aspekte der Filme werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Blickstrukturen in "Peeping Tom" und "Eyes Wide Shut". In "Peeping Tom" werden die Rolle der Mutter und des Vaters sowie die Verbindung von Voyeurismus und Gewalt untersucht. Bei "Eyes Wide Shut" stehen die Bedeutung der Maske, der "verbotene Blick" und die Vermischung von Traum und Realität im Mittelpunkt. Ein Vergleich beider Filme wird ebenfalls durchgeführt.
Wie wird der Zuschauer in die Analyse einbezogen?
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Rolle des Rezipienten als Voyeur. Die Analyse untersucht, wie die filmischen Mittel den Zuschauer in die Narration einbinden und seine Rolle als aktiver Teilnehmer der Skopophilie beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definitionsversuch zu Schaulust, Voyeurismus und Skopophilie, kinematographischer Voyeurismus, Skopophilie des Rezipienten, Analyse von "Peeping Tom", Analyse von "Eyes Wide Shut" und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Übersicht kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Voyeurismus, Skopophilie, Schaulust, kinematographischer Voyeurismus, Blickstrukturen, Filmrezeption, "Peeping Tom", "Eyes Wide Shut", sowie die Namen der erwähnten Theoretiker (Mulvey, Freud, Lacan, Sartre, Baudry, Metz).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, theoretische Grundlagen zum kinematographischen Voyeurismus zu erarbeiten und diese auf die ausgewählten Filme anzuwenden. Es soll untersucht werden, wie filmische Stilmittel Voyeurismus ermöglichen und den Rezipienten als Voyeur einbinden.
Wie werden "Peeping Tom" und "Eyes Wide Shut" verglichen?
Die Arbeit vergleicht die filmische Darstellung von Voyeurismus in "Peeping Tom" und "Eyes Wide Shut", indem sie die jeweiligen Blickstrukturen und deren Wirkung auf den Zuschauer analysiert und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitet.
- Quote paper
- Maria Weickardt (Author), 2014, Das Fenster in eine andere Welt. Voyeurismus im Film „Eyes Wide Shut“ und „Peeping Tom“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294271