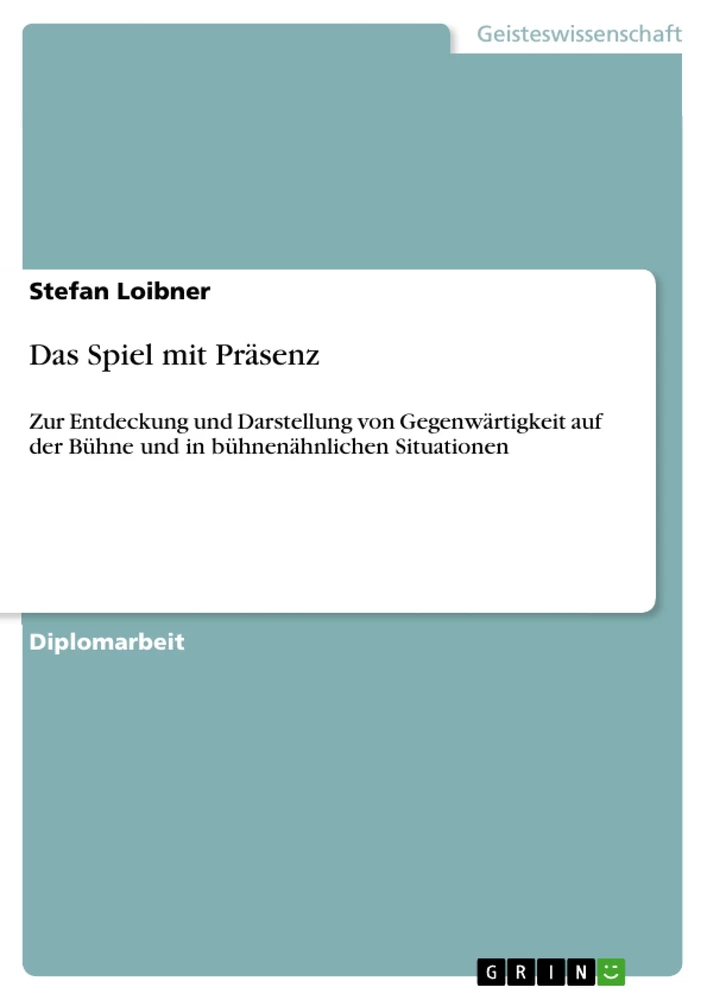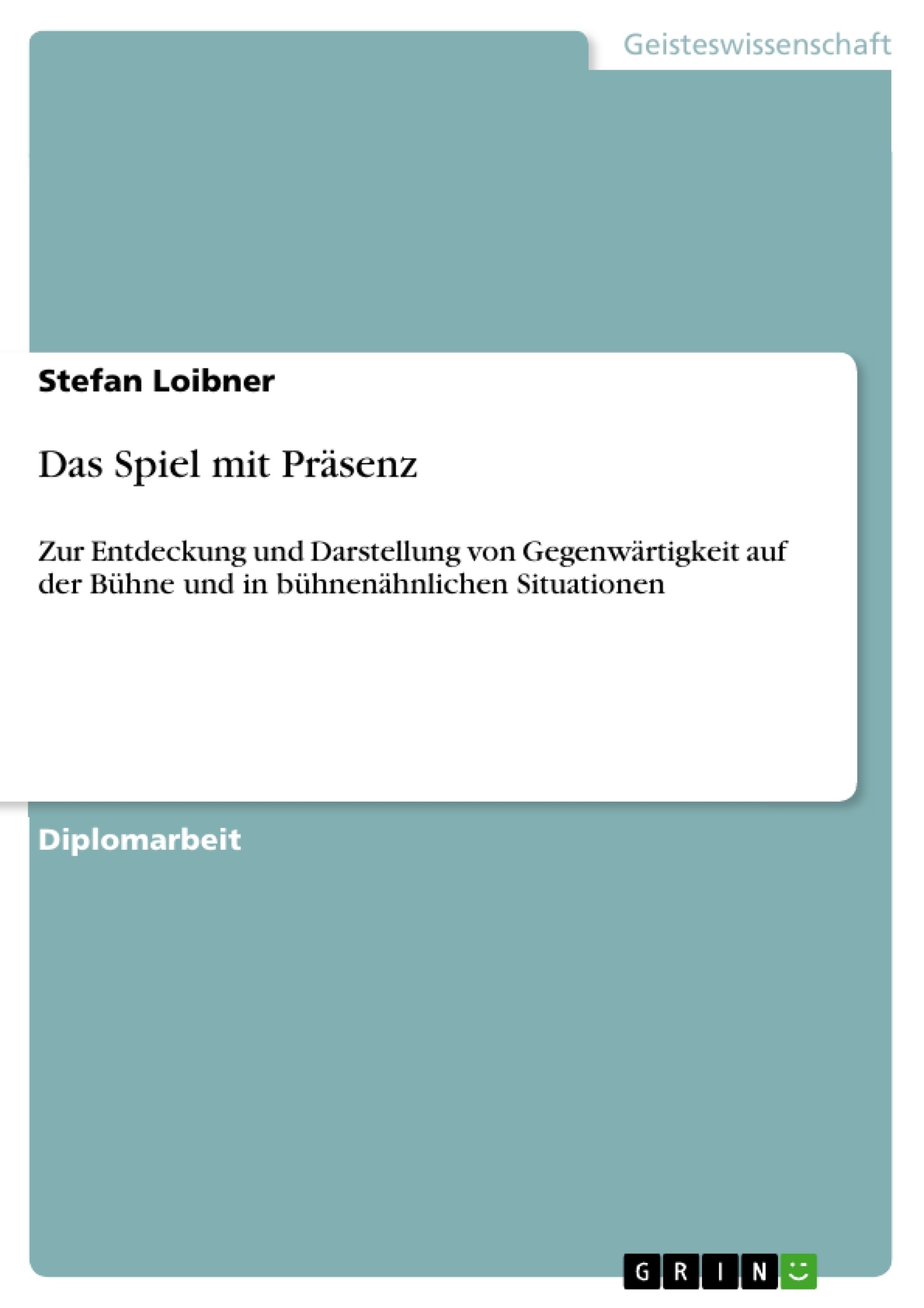Der Begriff der Präsenz hat in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen verstärkt an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Fähigkeit des ‚Gegenwärtig-Seins‘ ist eine grundlegende Basis der darstellenden Kunst und gilt auch in zahlreichen Situationen des privaten und beruflichen Alltags als zunehmend wünschenswert. Gleichzeitig wird Präsenz als mystisches, magisches und schwer zu fassendes Phänomen und die Erforschung von Präsenz als wissenschaftliche Herausforderung beschrieben.
Was hat es mit dem Geheimnis der Präsenz auf sich? Kann Präsenz ‚produziert‘ oder ‚erzeugt‘ werden? Kann die Fähigkeit zur ‚Erzeugung‘ von Präsenz gelehrt und trainiert werden? Was ist Präsenz überhaupt?
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass Präsenz nicht ‚produziert‘ werden muss. Die grundlegende Präsenz ist potentiell immer vorhanden und muss vielmehr entdeckt werden, um zu den gewünschten Wirkungen zu gelangen. Durch Darstellung wird die entdeckte Präsenz gemeinschaftlich gemacht. Sie wirkt ‚ansteckend‘, wenn sie beobachtet wird.
Das beobachtende Bewusstsein ist eine Gemeinsamkeit der Phänomene ‚Präsenz‘ und ‚Zeit‘, zwei Begriffe, die in einem engen etymologischen und inhaltlichen Zusammenhang stehen, wie im ersten der drei Kapitel ausgeführt wird.
Im zweiten Kapitel wird erörtert, wie die grundlegende Präsenz durch lustvolle Beobachtung der individuellen Erscheinungen entdeckt werden kann. Die Wichtigkeit von Ästhetik und Sinnlichkeit, der mystische Einfluss der Beobachtung, die Notwendigkeit des Kontaktes und des Mutes zur Konfrontation mit dem neuen Unbekannten werden erläutert.
Das Darstellen von Präsenz als abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit dem ‚Gemeinschaftlich-Machen‘ der entdeckten Präsenz. Darstellung, Spiel und Tanz stehen in einem etymologischen und inhaltlichen Zusammenhang. Improvisation ist die Darstellungsform des Neuen. Gesetzte Ziele, konkrete Handlungen und das Entdecken des für die aktuelle Tätigkeit nicht notwendigen ‚Zuviels‘ sind Hilfen bei der Wahrnehmung des authentischen Impulses und damit bei der Darstellung von Präsenz.
Präsenz ist schließlich der Wegbereiter in die von Gebser beschriebene integrale Struktur, welche die Zeitfreiheit als vorherrschende Zeitform hat. Die sowohl praktische als auch theoretische Beschäftigung mit Präsenz beinhaltet die Kraft, die nötig ist, um uns mit den noch unbekannten neuen Herausforderungen der sich ändernden gesellschaftlichen Strukturen lustvoll konfrontieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die begehrte Präsenz
- Zur Wortherkunft
- Präsenz im Theater
- Präsenz, Kunst oder Wissenschaft?
- Präsenz durch Körpertechnik?
- Präsenz durch Beobachtung?
- Präsenz und die Zeit
- Das Problem der Zeit
- Das Bewusstsein der Zeit
- Die Zeitformen nach Gebser
- Die Zeitlosigkeit der magischen Struktur
- Die Zeithaftigkeit der mythischen Struktur
- Die Zeitlichkeit der mentalen Struktur
- Die Zeit als Teilerin
- Die Zeitfreiheit der integralen Struktur
- Das Entdecken von Präsenz
- Präsenz ist bereits da
- Entdeckung durch Beobachtung
- Die individuellen Erscheinungen
- Die Lust von Ästhetik und Sinnlichkeit
- Der mystische Einfluss der Beobachtung
- Wie geht es Ihnen?
- Die Wichtigkeit des Kontaktes
- Die Beobachtung des Atems
- Über Angst, Mut und Konfrontation
- Über Wertung und Beurteilung
- Das Darstellen von Präsenz
- Das Darstellen des Selbst
- Angewandte darstellende Kunst
- Darstellung durch Spiel und Tanz
- Die Wichtigkeit des Spiels
- Wann ist das Spiel ein Spiel?
- Über Spiel, Arbeit und Geld
- Über Muster als Schutz und Grenze
- Die Improvisation - das unvorhergesehene Neue
- Der authentische Impuls
- Über Handlung und Ziele
- Die Reduktion des Zuviel
- Die Wichtigkeit der Pause
- Den Impulsen vertrauen
- Zusammenfassung und Conclusio
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Phänomen der Präsenz auf der Bühne und in bühnenähnlichen Situationen. Ziel ist es, die Entdeckung und Darstellung von Gegenwärtigkeit zu erforschen und zu beschreiben. Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen mit praktischen Erfahrungen im Bereich der darstellenden Kunst.
- Die Definition und Bedeutung von Präsenz
- Die Rolle der Körpertechnik und Beobachtung bei der Erzeugung von Präsenz
- Der Einfluss der Zeitwahrnehmung auf Präsenz
- Das Verhältnis von Präsenz zu Spiel, Improvisation und Authentizität
- Die Anwendung der Erkenntnisse im Kontext der darstellenden Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und definiert den Begriff der Präsenz. Sie beleuchtet die Bedeutung von Präsenz im Theater und stellt die Frage nach ihrem Wesen als künstlerisches oder wissenschaftliches Phänomen.
Präsenz durch Körpertechnik?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit Körpertechniken zur Erzeugung von Präsenz beitragen können. Es werden verschiedene Techniken diskutiert und deren Wirkung auf die Wahrnehmung des Schauspielers und des Publikums analysiert.
Präsenz durch Beobachtung?: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Beobachtung bei der Entdeckung und Darstellung von Präsenz. Es beleuchtet die Wichtigkeit des Kontaktes, die Beobachtung des Atems, und die Auseinandersetzung mit Emotionen wie Angst und Mut. Die Kapitel untersuchen den Einfluss der Beobachtung auf die Zeitwahrnehmung und das Erleben von Gegenwärtigkeit.
Das Darstellen von Präsenz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktische Umsetzung von Präsenz in der darstellenden Kunst. Es erörtert die Bedeutung des Spiels, der Improvisation und der Authentizität für die Darstellung des Selbst und analysiert wie Handlung, Ziele und Pausen eingesetzt werden können, um Präsenz zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Präsenz, Gegenwärtigkeit, Bühne, darstellende Kunst, Körpertechnik, Beobachtung, Zeitwahrnehmung, Spiel, Improvisation, Authentizität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Präsenz auf der Bühne
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Phänomen der Präsenz auf der Bühne und in bühnenähnlichen Situationen. Ziel ist die Erforschung und Beschreibung der Entdeckung und Darstellung von Gegenwärtigkeit, wobei theoretische Überlegungen mit praktischen Erfahrungen in der darstellenden Kunst verbunden werden.
Welche Aspekte der Präsenz werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Präsenz, darunter die Definition und Bedeutung von Präsenz, die Rolle der Körpertechnik und Beobachtung bei ihrer Erzeugung, den Einfluss der Zeitwahrnehmung, das Verhältnis von Präsenz zu Spiel, Improvisation und Authentizität sowie die Anwendung der Erkenntnisse im Kontext der darstellenden Kunst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Präsenz durch Körpertechnik und Beobachtung, ein Kapitel zum Darstellen von Präsenz, eine Zusammenfassung und ein Nachwort. Der Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte und Unterpunkte.
Welche Rolle spielt die Körpertechnik bei der Erzeugung von Präsenz?
Die Arbeit untersucht, inwieweit verschiedene Körpertechniken zur Erzeugung von Präsenz beitragen. Es wird diskutiert, wie diese Techniken die Wahrnehmung des Schauspielers und des Publikums beeinflussen.
Welche Bedeutung hat die Beobachtung für die Präsenz?
Die Beobachtung spielt eine zentrale Rolle bei der Entdeckung und Darstellung von Präsenz. Die Arbeit beleuchtet die Wichtigkeit des Kontakts, die Beobachtung des Atems, die Auseinandersetzung mit Emotionen (Angst, Mut) und den Einfluss der Beobachtung auf die Zeitwahrnehmung und das Erleben von Gegenwärtigkeit.
Wie wird Präsenz in der darstellenden Kunst dargestellt?
Das Kapitel zum Darstellen von Präsenz konzentriert sich auf die praktische Umsetzung. Es erörtert die Bedeutung von Spiel, Improvisation und Authentizität für die Darstellung des Selbst und analysiert den Einsatz von Handlung, Zielen und Pausen zur Erzeugung von Präsenz.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Präsenz, Gegenwärtigkeit, Bühne, darstellende Kunst, Körpertechnik, Beobachtung, Zeitwahrnehmung, Spiel, Improvisation, Authentizität.
Welche konkreten Fragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung definiert den Begriff der Präsenz, beleuchtet dessen Bedeutung im Theater und fragt nach seinem Wesen als künstlerisches oder wissenschaftliches Phänomen.
Welche Zeitkonzepte werden im Zusammenhang mit Präsenz diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die Zeitwahrnehmung im Kontext von Präsenz und bezieht sich auf die Zeitformen nach Gebser (magische, mythische, mentale, integrale Struktur), um die unterschiedlichen Zeiterfahrungen zu analysieren.
Welche Rolle spielt die Improvisation?
Die Improvisation wird als wichtiger Aspekt für die Erzeugung authentischer Präsenz betrachtet und im Kontext von Handlung, Zielen und dem Umgang mit dem "Unvorhergesehenen" analysiert.
- Quote paper
- Stefan Loibner (Author), 2014, Das Spiel mit Präsenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294517