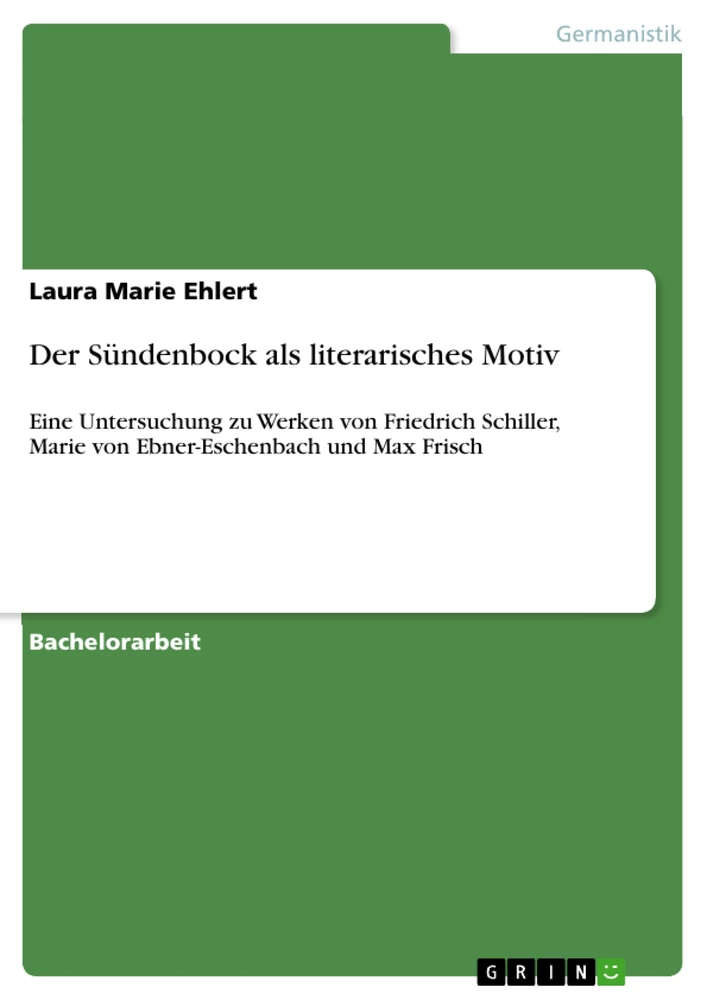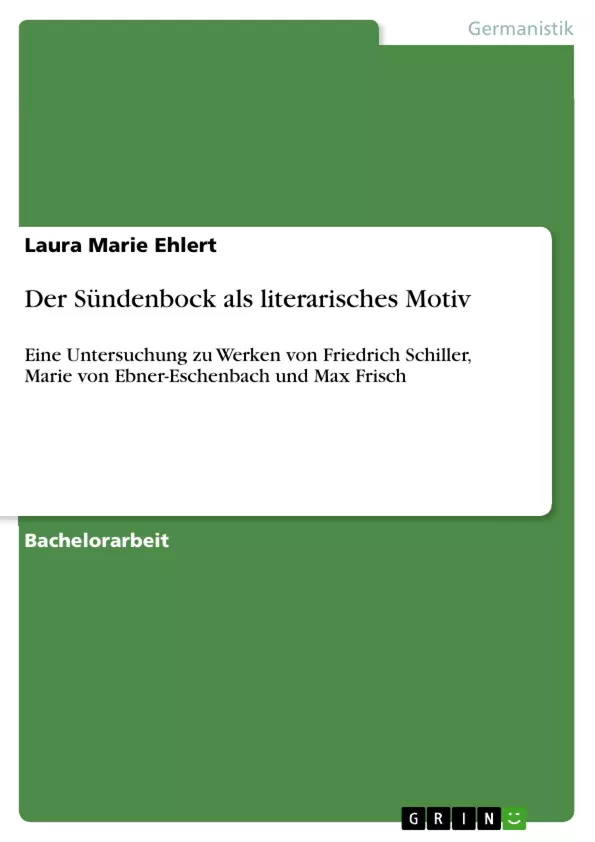In unserer Gesellschaft kommt es immer wieder zu Ausgrenzungen von Menschen auf Grund ihrer Andersartigkeit, sei es ihre Abstammung, ihr Aussehen oder weitere Faktoren, die sie von anderen Personen unterscheiden. Diese Stigmatisierung von Menschen anhand bestimmter Merkmale ist ein Phänomen, das sich durch die Geschichte verschiedener Kulturen zieht. Die ausgegrenzten Menschen werden häufig als Sündenböcke der Gesellschaft bezeichnet. Da dieses Phänomen kulturübergreifend weit verbreitet ist, gibt es auch in der Literatur zahlreiche Autoren, die sich mit der Ausgrenzung von Personen in ihren Werke befassen, indem sie Protagonisten integrieren, die auf Grund verschiedener Merkmale zum Sündenbock stigmatisiert werden. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob es sich bei dem beschriebenen Phänomen der Stigmatisierung eines Protagonisten als Sündenbock um ein literarisches Motiv handelt und welche Facetten dieses Motiv haben kann. Hierbei wird besonders auf die Entwicklung der Person geachtet, die von der Gemeinschaft ausgestoßen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arbeitsdefinition Motiv
- Der „Sündenbock“ in interdisziplinärer Perspektive
- Religionsgeschichtlicher Hintergrund
- Soziologische Perspektive
- Reflexion zur Textauswahl
- Textanalyse
- Friedrich Schiller: Der Verbrecher aus verlorener Ehre - „Ich wollte Böses tun. [...] Ich wollte mein Schicksal verdienen.“
- Marie von Ebner-Eschenbach: Das Gemeindekind – „Ich bleib der einsame Mensch, zu dem ihr mich gemacht habt.“
- Max Frisch: Andorra - „Seit ich höre, hat man mir gesagt, ich sei anders [...]. Und es ist so, Hochwürden: Ich bin anders.“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem literarischen Motiv des Sündenbocks und untersucht dessen Facetten in ausgewählten Werken von Friedrich Schiller, Marie von Ebner-Eschenbach und Max Frisch. Die Arbeit analysiert die Stigmatisierung von Protagonisten als Sündenböcke in den jeweiligen Texten und beleuchtet die Entwicklung der ausgegrenzten Personen.
- Definition des Motivs „Sündenbock“
- Religionsgeschichtlicher und soziologischer Hintergrund des Motivs
- Analyse der Darstellung des Sündenbockmotivs in den ausgewählten Werken
- Die Rolle des Sündenbocks in der Gesellschaft und seine Reaktion auf die Ausgrenzung
- Die Bedeutung des Sündenbockmotivs in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz des Sündenbockmotivs in der Literatur dar. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der einzelnen Kapitel.
Kapitel 2 widmet sich der Definition des Motivbegriffs und entwickelt eine Arbeitsdefinition, die als Grundlage für die Analyse des Sündenbockmotivs dient.
Kapitel 3 beleuchtet den „Sündenbock“ aus interdisziplinärer Perspektive. Es wird der religionsgeschichtliche Hintergrund des Begriffs sowie die soziologische Perspektive des Sündenbockmechanismus nach René Girard erläutert.
Kapitel 4 reflektiert und begründet die Auswahl der Texte, die in Kapitel 5 analysiert werden.
Kapitel 5 analysiert die Erzählungen „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ von Friedrich Schiller, „Das Gemeindekind“ von Marie von Ebner-Eschenbach und das Drama „Andorra“ von Max Frisch. Es werden die Gründe für die Ausgrenzung der Protagonisten untersucht und ihre Reaktion auf die Stigmatisierung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sündenbock, die Stigmatisierung, die Ausgrenzung, die Andersartigkeit, das literarische Motiv, die Textanalyse, Friedrich Schiller, Marie von Ebner-Eschenbach, Max Frisch, „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, „Das Gemeindekind“, „Andorra“, Religionsgeschichte, Soziologie, Sündenbockmechanismus, René Girard.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das literarische Motiv des Sündenbocks?
Es beschreibt die Stigmatisierung und Ausgrenzung eines Protagonisten durch eine Gemeinschaft aufgrund von Andersartigkeit oder zur Entlastung der Gruppe von eigener Schuld.
Welche Werke werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, Ebner-Eschenbachs „Das Gemeindekind“ und Max Frischs Drama „Andorra“.
Was ist der Sündenbockmechanismus nach René Girard?
Girard beschreibt den Sündenbockmechanismus als soziologisches Phänomen, bei dem eine Gruppe ihre internen Spannungen auf ein Opfer überträgt und durch dessen Ausstoßung den inneren Frieden wiederherstellt.
Wie reagiert Andri in Max Frischs „Andorra“ auf seine Rolle?
Andri übernimmt schließlich die ihm von der Gesellschaft aufgezwungene Identität des „Anderen“, obwohl er biologisch gar nicht zu der stigmatisierten Gruppe gehört.
Welchen religionsgeschichtlichen Hintergrund hat der Begriff?
Der Begriff stammt aus dem Alten Testament, wo ein Ziegenbock symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste geschickt wurde.
- Quote paper
- Laura Marie Ehlert (Author), 2012, Der Sündenbock als literarisches Motiv, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294542