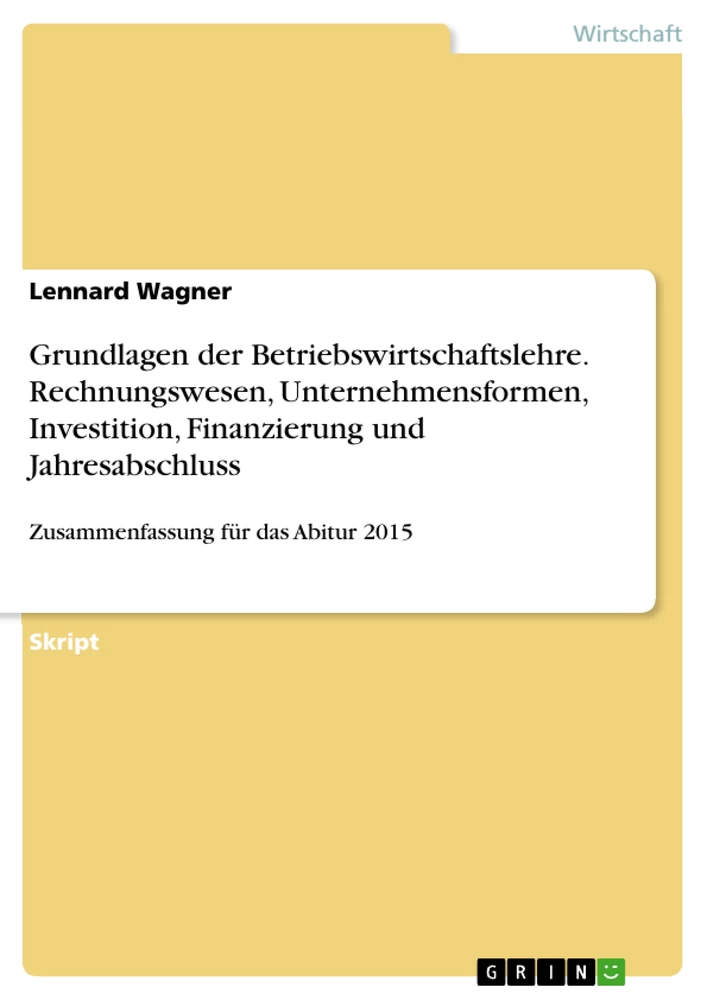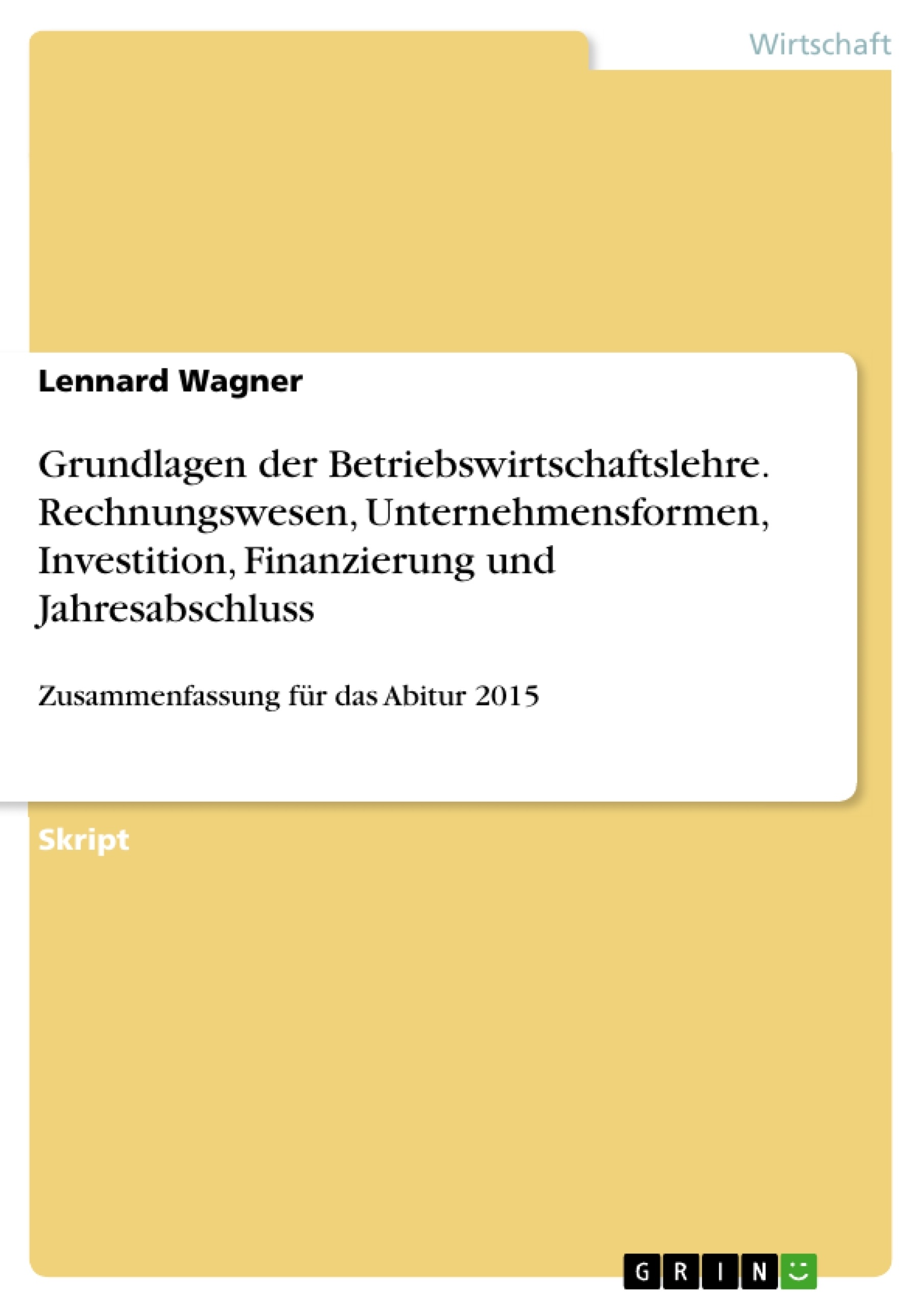Eine Zusammenfassung des gesamten relevanten Stoffes für das Abitur oder die Fachhochschulreife in Wirtschaft (BWL und Rechnungswesen). Auch optimal für das erste Semester eines BWL Studiums oder kaufmännische Ausbildungen.
Zusammenfassung auf etwa 60 Seiten mit ausführlichen Randbemerkungen und Erklärungen.
Inhalt:
Kosten- und Leistungsrechnung
- Vollkostenrechnung
- Prozesskostenrechnung
- Teilkostenrechnung (Deckungsbeitrag)
Unternehmensformen
- OHG
- KG
- AG
- GmbH
Investition und Finanzierung
- Offene Selbstfinanzierung (KG und AG)
- Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten
- Beteiligungsfinanzierung bei der AG
- Kredit- und Leasingfinanzierung
- Sicherheiten
- Amortisationszeit und Bartwertrechnung
Jahresabschluss
- Analyse
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Kennzahlen
Inhaltsverzeichnis
- A. Betriebswirtschaftslehre
- 1. Kosten- und Leistungsrechnung I: Grundlagen, Abgrenzungsrechnung
- 2. Kosten- und Leistungsrechnung II: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
- 3. Kosten- und Leistungsrechnung III: Kostenanalyse und Teilkostenrechnung
- 4. Kosten- und Leistungsrechnung IV: Prozesskostenrechnung
- 5. Rechtsformen I: Grundlagen, Personengesellschaften
- 6. Rechtsformen II: GmbH und GmbH & Co. KG
- 7. Rechtsformen III: Die Aktiengesellschaft
- 8. Finanzierung und Investition: Offene Selbstfinanzierung
- 9. Finanzierung und Investition: Abschreibungsgegenwerte
- 10. Finanzierung und Investition: Beteiligungs-(Eigen-)Finanzierung
- 11. Finanzierung und Investition: Außen- und Fremdfinanzierung (Darlehen)
- 12. Finanzierung und Investition: Sonderform Fremdfinanzierung (Leasing)
- 13. Finanzierung und Investition: Investitionsrechnung
- 14. Der Jahresabschluss der AG
- 15. Jahresabschluss Analyse
- ZUSAMMENFASSUNG
- LENNARD WAGNER
- SEITE: 2,1. Kosten- und Leistungsrechnung I: Grundlagen, Abgrenzungsrechnung
- SEITE: 3,1.2. Grundbegriffe
- SEITE: 4,Rechnungskreis
- SEITE: 5,2. Kosten- und Leistungsrechnung II: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
- SEITE: 6
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text bietet eine umfassende Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung, Rechtsformen und Finanzierung liegt. Die Zielsetzung ist es, den Leser mit den grundlegenden Konzepten und Methoden dieser Bereiche vertraut zu machen und ihm ein solides Fundament für weiterführende Studien zu liefern.
- Kosten- und Leistungsrechnung: Die verschiedenen Methoden der Kostenrechnung, wie Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung und Prozesskostenrechnung, werden vorgestellt und erläutert.
- Rechtsformen: Der Text beleuchtet die verschiedenen Rechtsformen von Unternehmen, darunter Personengesellschaften, GmbH, GmbH & Co. KG und Aktiengesellschaft.
- Finanzierung: Die verschiedenen Finanzierungsformen, wie Selbstfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung und Fremdfinanzierung, werden analysiert und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
- Investitionsrechnung: Die Methoden der Investitionsrechnung werden vorgestellt und ihre Anwendung in der Praxis erläutert.
- Jahresabschluss: Der Text behandelt den Jahresabschluss der Aktiengesellschaft und die Analyse von Jahresabschlüssen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden die Unterschiede zwischen externem und internem Rechnungswesen erläutert und die wichtigsten Grundbegriffe wie Kosten, Leistungen, Aufwand und Ertrag definiert. Die Abgrenzungstabelle wird vorgestellt und die verschiedenen Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung, wie Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung und Prozesskostenrechnung, werden kurz beschrieben.
Kapitel 2 befasst sich mit der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Die Unterscheidung zwischen Einzelkosten und Gemeinkosten wird erläutert und der Aufbau des Betriebsabrechnungsbogens (BAB) wird vorgestellt. Die Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger mit Hilfe von Zuschlagssätzen wird detailliert beschrieben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung?
Die Vollkostenrechnung verteilt alle Kosten auf die Kostenträger, während die Teilkostenrechnung (Deckungsbeitrag) nur die variablen Kosten berücksichtigt.
Welche Rechtsformen für Unternehmen werden unterschieden?
Wichtige Formen sind Personengesellschaften (OHG, KG) und Kapitalgesellschaften (GmbH, AG).
Was bedeutet Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten?
Hierbei werden die in die Verkaufspreise einkalkulierten Abschreibungen als liquide Mittel im Unternehmen behalten, um Reinvestitionen zu finanzieren.
Wie wird eine Investition mittels Amortisationsrechnung bewertet?
Es wird ermittelt, nach welchem Zeitraum das eingesetzte Kapital durch die erwirtschafteten Rückflüsse wieder ins Unternehmen zurückgeflossen ist.
Was gehört zur Analyse eines Jahresabschlusses?
Dazu zählen die Bewertung von Vermögensgegenständen sowie die Berechnung von Kennzahlen zur Liquidität, Rentabilität und Stabilität.
- Arbeit zitieren
- Lennard Wagner (Autor:in), 2015, Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Rechnungswesen, Unternehmensformen, Investition, Finanzierung und Jahresabschluss, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294698