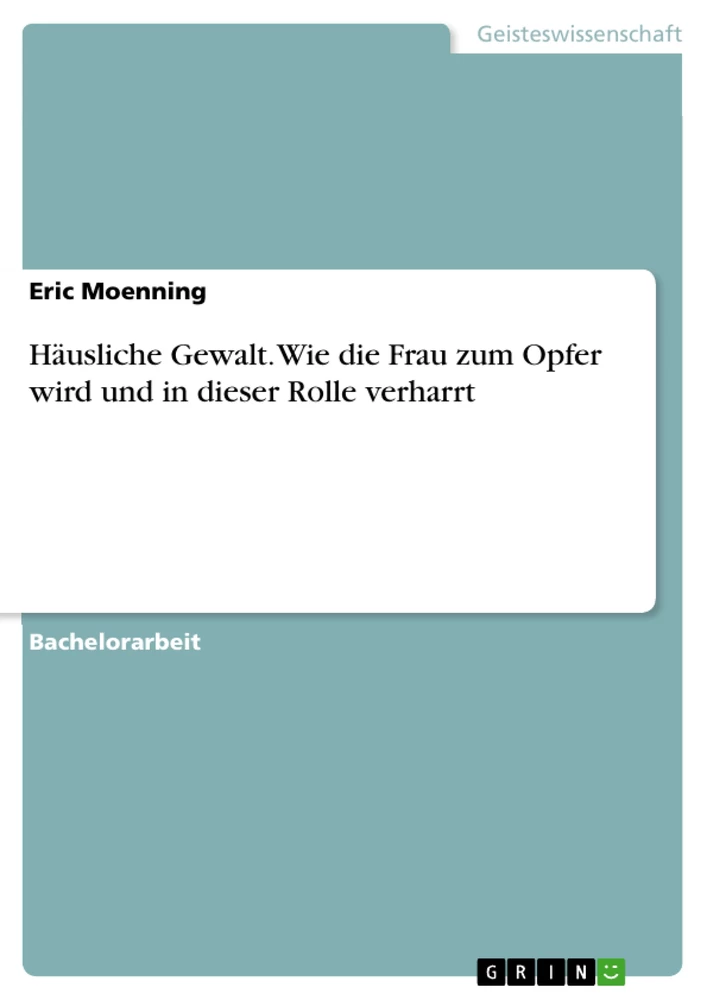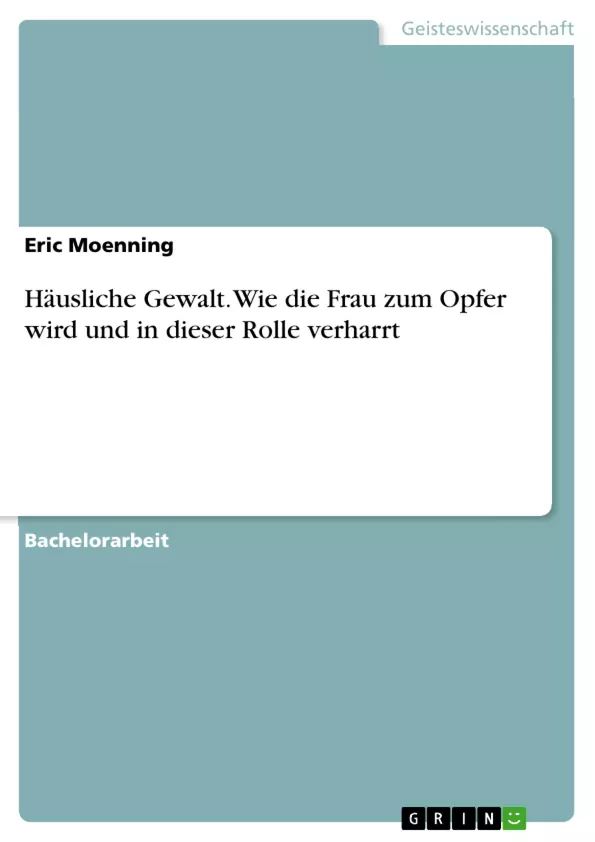Nicht selten hört man in Medien von Fällen häuslicher Gewalt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass allein in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von ihrem Partner sexuell oder körperlich misshandelt wurde. Die Bundesregierung stellte bereits im Jahr 1990 fest, dass Gewalt in Familien die am häufigsten ausgeübte Gewalt in unserer Gesellschaft ist.
Gerade deshalb gibt es mittlerweile mehr als 350 Frauenhäuser in Deutschland. Diese geben an, dass dort jährlich etwa 45.000 Frauen mit ihren Kindern Zuflucht suchen. Sie suchen Zuflucht vor ihren Ehemännern.
Die Polizei geht von einem großen Dunkelfeld im Bereich der häuslichen Gewalt aus, denn viele Frauen wenden sich nicht an die Polizei oder andere Hilfsorganisationen. Frauen werden in ihrem eigenen Zuhause von ihren Lebenspartnern auf massive Art und Weise unterdrückt und misshandelt. Doch selten finden die betroffenen Frauen einen Ausweg aus dieser Situation.
In den 90er Jahren kam es zu gesetzlichen Änderungen, die fortan körperliche Gewalt gegen Frauen nicht mehr als hausherrliche Gewalt behandelten, sondern künftig strafrechtlich verfolgten. Unter anderem wurde in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung im Jahre 1997 auch die Ehe eingeschlossen. Der Gesetzgeber nahm die Vergewaltigung innerhalb der Ehe in den §177 Strafgesetzbuch auf und stellte sie der Vergewaltigung außerhalb der Ehe in einem Straftatbestand gleich.
Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes stellt sich die Frage, auf welche Ursachen zurückgeführt werden kann, dass Frauen so häufig über Jahre hinweg in einer Beziehung leben können, in der sie beinahe täglich Gewalt erfahren, ohne sich aus dieser Situation zu befreien. Ebenso stellt sich die Frage, welche Phasen die Frau durchlebt, bis sie letztendlich als Opfer von häuslicher Gewalt bezeichnet werden kann. Dies soll das Thema dieser Bachelorarbeit darstellen.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dazu dienen, Polizeibeamte, andere Interessierte und ebenso Betroffene für das Handeln oder auch Nicht-Handeln dieser Frauen zu sensibilisieren. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden die facettenreichen Gründe für ihre Situation zu verstehen und dadurch entsprechend sensibel und mit „geöffneten Augen“ den Dienst zu versehen und Signale aus dem näheren Umfeld zu erkennen, um so sachgerecht, gründlich und sensibel intervenieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen
- Häusliche Gewalt
- Begriffsbestimmung „Häusliche Gewalt“
- Formen von häuslicher Gewalt
- Physische Gewalt
- Psychische Gewalt
- Sexuelle Gewalt
- Ökonomische Gewalt
- Soziale Gewalt
- Die Zyklustheorie der häuslichen Gewalt - Gewaltspirale
- 1. Phase - Stufe des Spannungsaufbaus
- 2. Phase - Der akute Gewaltakt
- 3. Phase - Zuwendung und reuiges, liebevolles Verhalten
- Viktimologie
- Begriffsbestimmung „Viktimologie“
- Begriffsbestimmung „Opfer“
- Der Prozess der Viktimisierung - Das Karrieremodell
- Primäre Viktimisierung - Primärschäden
- Sekundäre Viktimisierung - Sekundärschäden
- Tertiäre Viktimisierung - Tertiärschäden
- Täter-Opfer-Beziehung
- Warum verharrt die Frau in der Opferrolle?
- Opferschutz
- §§406 d-h StPO
- Historische Entwicklung
- Begriffsbestimmung „Verletzter“
- Befugnisse des Verletzten
- Mitteilung an den Verletzten nach §406 d StPO
- Akteneinsicht nach §406 e StPO
- Beistand durch einen Anwalt nach §406 f Abs. 1 StPO
- Hinzuziehung einer Vertrauensperson nach §406 f Abs. 2 StPO
- Rechtsanwaltlicher Beistand des Nebenklagebefugten nach §406g StPO
- Hinweispflicht nach §406 h StPO
- §§406 d-h StPO
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der häuslichen Gewalt und analysiert die Gründe, warum Frauen in dieser Rolle verharren. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Prozesse der Viktimisierung zu beleuchten und die Faktoren zu identifizieren, die Frauen daran hindern, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu befreien.
- Definition und Formen häuslicher Gewalt
- Die Zyklustheorie der häuslichen Gewalt
- Der Prozess der Viktimisierung
- Die Täter-Opfer-Beziehung
- Opferschutzmaßnahmen im Strafprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der häuslichen Gewalt ein und beleuchtet die Relevanz des Themas anhand von Statistiken und persönlichen Erfahrungen. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für das Verharren von Frauen in der Opferrolle und die Ziele der Arbeit dar.
Der Abschnitt „Rahmenbedingungen“ definiert die in der Arbeit verwendeten Begriffe und legt den Fokus auf die Frau als Opfer und den Mann als Täter.
Das Kapitel „Häusliche Gewalt“ definiert den Begriff der häuslichen Gewalt und beschreibt die verschiedenen Formen, die diese Gewalt annehmen kann. Die Zyklustheorie der häuslichen Gewalt wird vorgestellt, um den Kreislauf der Gewalt zu erklären, der Frauen in der Opferrolle gefangen hält.
Das Kapitel „Viktimologie“ beschäftigt sich mit der Definition von Viktimologie und Opfer. Der Prozess der Viktimisierung wird anhand des Karrieremodells erläutert, das die verschiedenen Phasen der Opferwerdung beschreibt.
Das Kapitel „Warum verharrt die Frau in der Opferrolle?“ analysiert die Beziehung zwischen Täter und Opfer und untersucht die Gründe, die Frauen daran hindern, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu befreien.
Das Kapitel „Opferschutz“ beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen des Opferschutzes im Strafprozess und analysiert die Neuerungen der Strafprozessordnung hinsichtlich der Opferwerdung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen häusliche Gewalt, Viktimologie, Opferwerdung, Täter-Opfer-Beziehung, Zyklustheorie der Gewalt, Opferhilfe, Strafprozessordnung, Frauenrechte und Gewaltprävention. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Ursachen und Folgen von häuslicher Gewalt und analysiert die Faktoren, die Frauen in der Opferrolle verharren lassen.
Häufig gestellte Fragen
Warum verharren Frauen oft jahrelang in gewalttätigen Beziehungen?
Ursachen sind oft psychische Abhängigkeit, ökonomische Not, soziale Isolation sowie die Hoffnung auf Besserung durch die Versöhnungsphasen im Gewaltzyklus.
Was ist die Zyklustheorie der häuslichen Gewalt?
Sie beschreibt eine Gewaltspirale in drei Phasen: Spannungsaufbau, akuter Gewaltakt und schließlich reuiges, liebevolles Verhalten ("Flitterwochen-Phase").
Welche Formen häuslicher Gewalt werden unterschieden?
Neben physischer Gewalt umfasst sie psychische, sexuelle, ökonomische und soziale Gewalt.
Was versteht man unter sekundärer Viktimisierung?
Dies ist die zusätzliche Schädigung des Opfers durch unsensibles Verhalten der Umwelt, der Polizei oder der Justiz während der Aufarbeitung der Tat.
Welche Rechte haben Opfer im Strafprozess?
Die StPO gewährt Verletzten unter anderem das Recht auf Akteneinsicht, Beistand durch einen Anwalt und die Hinzuziehung einer Vertrauensperson.
- Arbeit zitieren
- Eric Moenning (Autor:in), 2014, Häusliche Gewalt. Wie die Frau zum Opfer wird und in dieser Rolle verharrt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294714