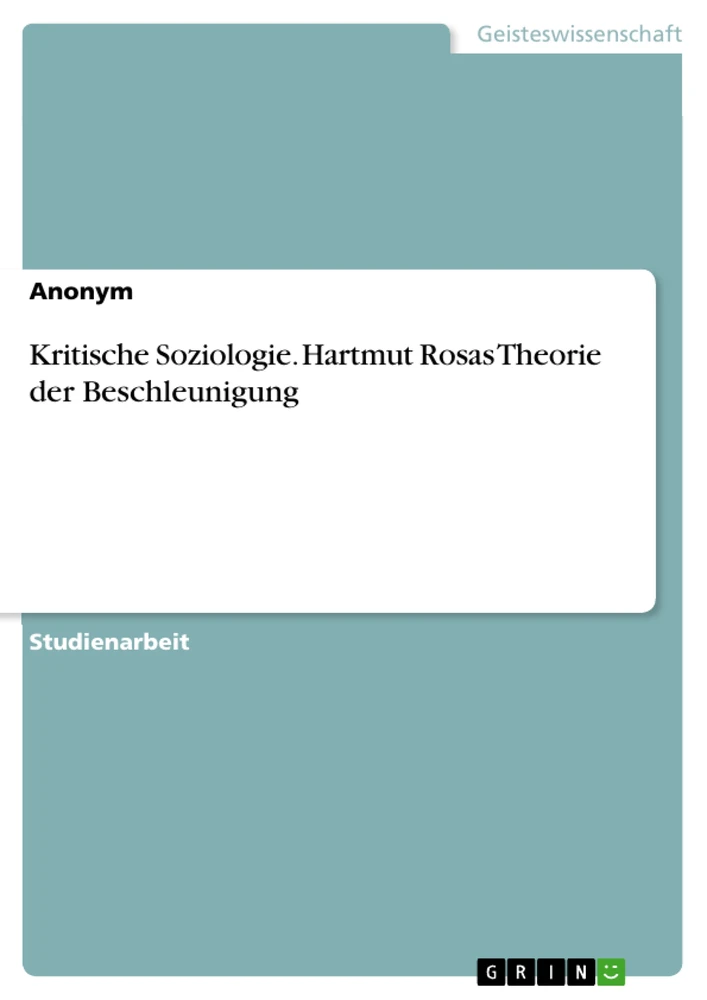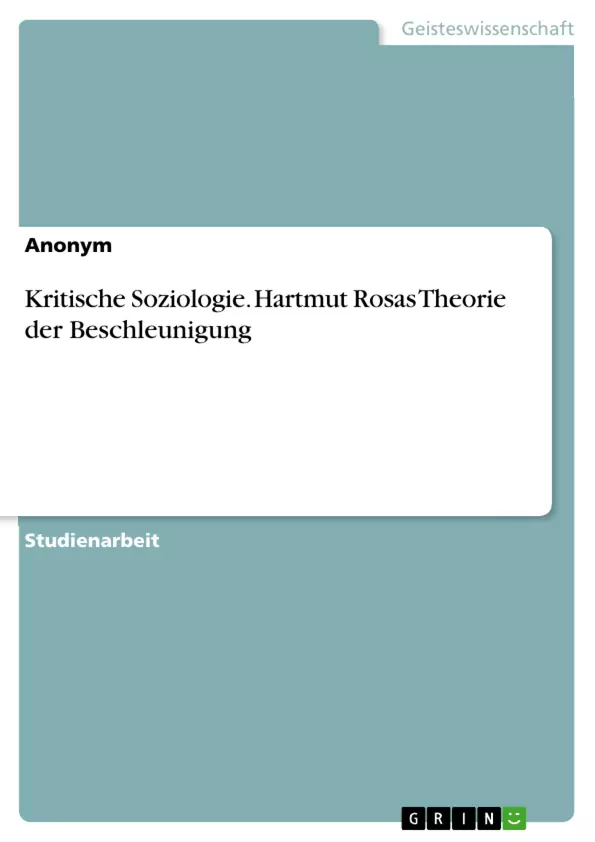„Gemeinsam teilen wir die Überzeugung, dass in der Tat ein großer Akt der »Erneuerung« ansteht, […]: die Rückkehr der Kritik in die Soziologie.“ schreiben Dörre, Lessenich und Rosa 2009. In ihrem Buch „Soziologie-Kapitalismus-Kritik“ geht es den drei Jenaer Soziologen dabei um die Wiederbelebung einer kritischen Praxis in der Soziologie, die Rückkehr zu einer Wissenschaft, die Kritik als Hauptaufgabe ihrer Theoriebildung begreift. Trotz der zunehmenden Kapitalismuskritik in Zeiten der „Krise“ sind die Autoren der Überzeugung, dass es der Soziologie als Disziplin bisher nicht gelungen sei, sich in einer Art und Weise mit dem aktuellen Wandel des Kapitalismus auseinanderzusetzen, die ihrem „kritisch-aufklärerischen Selbstverständnis gerecht würde“
Sie sind sich einig, dass eine kritische Soziologie in der modernen Gesellschaft vor allem auf den Kapitalismus und seine gesellschaftlichen Konsequenzen abzielen müsse.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Hartmut Rosas Theorie der Beschleunigung. Da auch Rosa die Auffassung vertritt, dass Gesellschaftskritik die wesentliche Aufgabe der Soziologie sei, werde ich mich im ersten Teil mit der Frage nach der Rolle soziologischer Kritik auseinandersetzen. Immer wieder entstehen Debatten über die Legitimation und Sinnhaftigkeit der Soziologie als Wissenschaft. Dabei steht entweder die Wertneutralität soziologischer Studien oder ihr gesellschaftlicher Nutzen zur Disposition. Auch innerhalb der Soziologie selbst gibt es Verwerfungen über die Motivation, Aufgaben und Zielstellungen, die die Soziologie hat/haben sollte.
Die wesentliche Frage, der ich mich in meinen Betrachtungen widmen möchte, ist ob Soziologie sich auf Analysen beschränken muss oder ob sie selbst kritisch werden kann.
Im zweiten Teil meiner Arbeit werde ich Hartmut Rosas Theorieansatz erläutern. Dabei werde ich mich vor allem auf die Texte aus „Soziologie-Kapitalismus-Kritik“ beziehen.
Abschließend möchte ich zu der anfänglichen Problemstellung zurückkehren und mit Hilfe von Rosas Ansätzen auf die Frage antworten, ob Soziologie kritisch sein sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritische Soziologie oder Soziologie der Kritik?
- Wertneutralität soziologischer Erkenntnis
- Soziologie der Kritik
- Kritische Soziologie
- Rosas Theorie der Beschleunigung
- Wachstum und Beschleunigung
- Das Grundversprechen der Moderne
- Die Gefahr der Beschleunigungsprozesse
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text setzt sich mit Hartmut Rosas Theorie der Beschleunigung auseinander und erörtert die Frage, ob die Soziologie kritisch sein soll. Der Fokus liegt auf der Rolle soziologischer Kritik in der heutigen Gesellschaft und der Frage, ob Soziologie sich auf Analysen beschränken soll oder selbst kritisch werden kann.
- Die Rolle von Gesellschaftskritik in der Soziologie
- Die Debatte über die Wertneutralität soziologischer Erkenntnis
- Rosas Theorie der Beschleunigung als Ansatzpunkt für gesellschaftliche Kritik
- Das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Objektivität und politischem Engagement
- Die Bedeutung von soziologischer Kritik im Kontext der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das zentrale Thema der Arbeit vor, die Frage nach der Rolle der Kritik in der Soziologie. Im zweiten Kapitel wird die Debatte über die Wertneutralität soziologischer Erkenntnisse beleuchtet und es wird argumentiert, dass eine wertneutrale Soziologie nicht möglich ist. Anschließend werden die Positionen von Georg Vobruba und Stephan Lessenich zur Frage "Kann Soziologie kritisieren?" dargestellt, wobei Lessenich die Notwendigkeit einer kritischen Soziologie betont. Hartmut Rosa, dessen Theorie der Beschleunigung im Fokus der Arbeit steht, geht noch einen Schritt weiter und argumentiert, dass Kritik der Ursprung der Soziologie sei.
Das dritte Kapitel widmet sich Rosas Theorie der Beschleunigung. Es werden die Kernaussagen des Theorieansatzes erläutert, darunter die Dynamisierungsspirale des Kapitalismus, das Grundversprechen der Moderne und die Gefahren der Beschleunigungsprozesse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Gesellschaftskritik, Soziologie, Wertneutralität, Beschleunigung, Kapitalismus, Moderne, Kritikfähigkeit, Dynamisierungsspirale, Grundversprechen der Moderne, Gefahren der Beschleunigungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Hartmut Rosas Beschleunigungstheorie?
Rosa analysiert die moderne Gesellschaft als eine durch die Dynamisierungsspirale des Kapitalismus getriebene, permanente Beschleunigung, die zu Entfremdung und Krisen führt.
Darf Soziologie wertend und kritisch sein?
Die Arbeit diskutiert das Spannungsfeld zwischen Max Webers Postulat der Wertneutralität und dem Anspruch einer kritischen Soziologie, die Gesellschaftskritik als ihre Hauptaufgabe sieht.
Was wird unter dem „Grundversprechen der Moderne“ verstanden?
Das Versprechen der Moderne war Zeitgewinn durch technischen Fortschritt. Rosa zeigt auf, dass das Gegenteil eingetreten ist: der Zeitdruck nimmt stetig zu.
Warum ist Kapitalismuskritik für die Soziologie wichtig?
Nach Rosa und anderen Jenaer Soziologen muss eine kritische Soziologie den Kapitalismus und seine gesellschaftlichen Konsequenzen als zentrales Problemfeld untersuchen.
Welche Gefahren ergeben sich aus der gesellschaftlichen Beschleunigung?
Zu den Gefahren zählen der Verlust von Autonomie, die Überforderung politischer Institutionen und eine zunehmende Desynchronisation zwischen Mensch und Umwelt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Kritische Soziologie. Hartmut Rosas Theorie der Beschleunigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294815