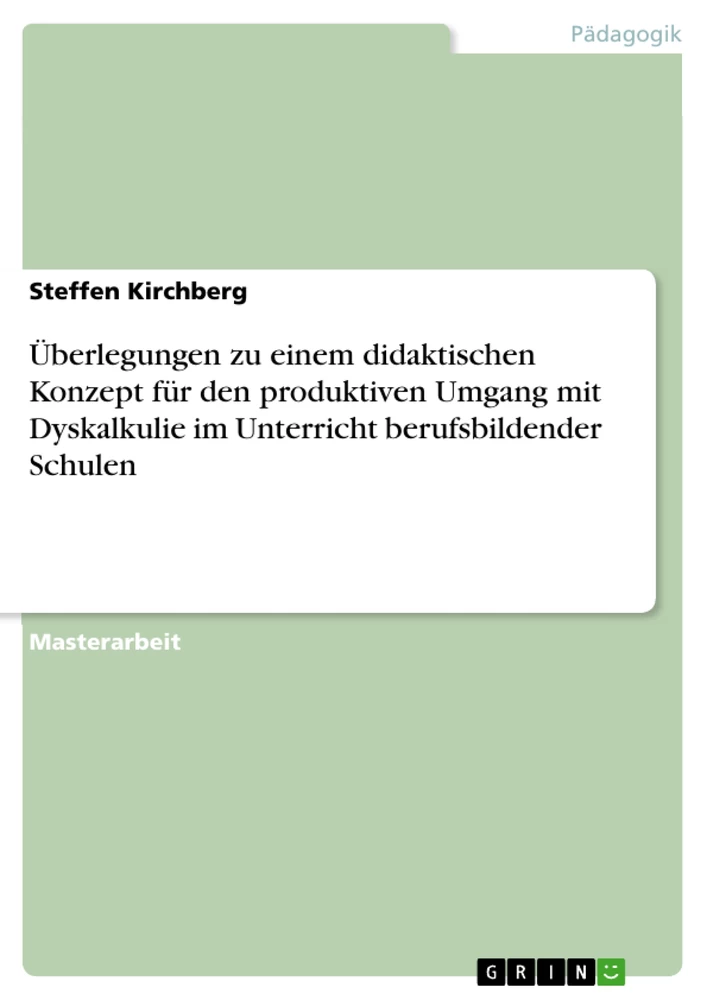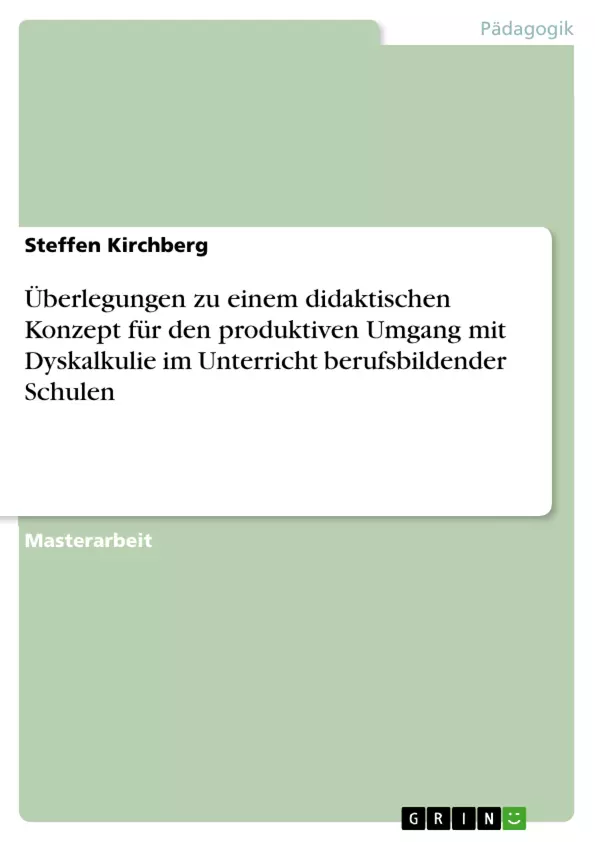Dyskalkulie oder Rechenschwäche sollte im besten Fall während der Grundschulzeit bemerkt werden. Oftmals werden die Symptome einer Dyskalkulie jedoch nicht erkannt und somit quälen sich die Betroffenen durch ihr gesamtes Leben. Über die Langzeiteffekte von Dyskalkulie ist bisher wenig bekannt. Es wird aber vermutet, dass die negativen Auswirkungen auf die Schullaufbahn und das Berufsleben massiver sind als bei Legasthenie. In einer englischen Studie (Bynner / Parsons 1997) ist zu lesen, dass die Arbeitslosenqote 37-jähriger Männer mit adäquater Rechen- und Leseleistung bei 8 %
lag. Bei rechenschwachen Personen jedoch bei 48 % und somit sogar höher als bei Personen mit schwachen Leseleistungen (41 %). Aber nicht nur das Berufsleben stellt für Erwachsene mit Rechenschwäche eine unüberwindbare Hürde dar, auch der Alltag ist massiv beeinträchtigt. Die Preise in Kaufhallen sagen den Betroffenen nichts, sie wissen nie, ob ihr Geld zum Einkaufen reicht, eine Kontrolle des Wechselgelds ist nicht möglich oder das Lesen von Fahrplänen ist kaum zu bewerkstelligen. „Eine Rechenschwäche, die nicht erkannt und behandelt wird, bleibt bestehen. Aus rechenschwachen
Kindern werden rechenschwache Erwachsene. Von einer hohen Dunkelziffer bei Erwachsenen geht der Bundesverband Legasthenie / Dyskalkulie aus, da die Betroffenen dazu neigen, ihre Probleme im Umgang mit Zahlen aus Scham zu verbergen. Erwachsene mit Rechenschwäche haben meist viele
Jahre des Misserfolgs hinter sich. Schlechte Mathematiknoten, verunglückte Schullaufbahnen sowie soziale Ängste und Minderwertigkeitsgefühle sind bei ihnen die Regel. Die Angst vor Zahlen und Rechenaufgaben hat sie geprägt und behindert täglich ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Rechenschwäche ist ein Problem verpasster Lernchancen, nicht etwa mangelnder Intelligenz.“
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Phänomene des Rechnens
- Wie rechnen Menschen?
- Denk- und lernpsychologische Grundlagen des Rechnens
- Die Betrachtung des Begriffs „Dyskalkulie“
- Ein Versuch der Definition
- Grundformen der Rechenschwäche
- Mögliche Ursachen der Dyskalkulie
- Anzeichen für Rechenschwäche
- Diagnostik
- Allgemeine Verfahrensweise
- Besonderheiten bei der Diagnostik im Jugend- und Erwachsenenalter
- Diagnoseprobleme
- Förderung von Menschen mit Rechenschwäche
- Erste grundlegende Aspekte der Förderung im Unterricht
- Rechtliche Grundlagen
- Vom Umgang mit Rechenschwäche in und außerhalb der Schule
- Ein didaktisches Konzept für den Umgang mit Rechenschwäche
- Forschungsdesign
- Vorüberlegungen
- Datenerhebung und Untersuchungsinstrument
- Vorgehensweise bei der Datenanalyse
- Datenauswertung
- Stichprobenbeschreibung
- Ergebnisse im Kontext der Hypothesen
- weitere Befunde
- Grenzen der Studie
- Forschungsdesign
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Herausforderungen im Umgang mit Dyskalkulie bei erwachsenen Schülern an Berufsschulen. Ziel ist es, Lehrkräften Handlungsempfehlungen für die Identifizierung und Förderung dieser Schüler zu geben. Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche und Interviews mit Therapeuten.
- Erkennen von Dyskalkulie bei erwachsenen Berufsschülern
- Herausforderungen der Diagnostik von Dyskalkulie im Erwachsenenalter
- Geeignete Fördermaßnahmen im Berufsschulunterricht
- Kompensationsstrategien von Dyskalkulie-Betroffenen
- Langzeitfolgen von unerkannter und unbehandelter Dyskalkulie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die weitreichenden Folgen unerkannter Dyskalkulie, insbesondere im Erwachsenenalter und im Berufsleben. Sie betont die hohe Dunkelziffer und die negativen Auswirkungen auf den Alltag, die Ausbildung und die psychische Gesundheit Betroffener. Die Arbeit zielt darauf ab, Lehrkräfte an Berufsschulen für dieses Problem zu sensibilisieren und geeignete pädagogische Strategien aufzuzeigen.
Die Phänomene des Rechnens: Dieses Kapitel erörtert die kognitiven Prozesse des Rechnens beim Menschen, von den grundlegenden Rechenoperationen bis hin zu den komplexeren mathematischen Fähigkeiten. Es werden denk- und lernpsychologische Grundlagen des Rechnens beleuchtet, um ein besseres Verständnis für die Schwierigkeiten von Dyskalkulie-Betroffenen zu schaffen. Der Fokus liegt auf den zugrundeliegenden mentalen Prozessen und wie diese bei Dyskalkulie beeinträchtigt sein können.
Die Betrachtung des Begriffs „Dyskalkulie“: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Begriff der Dyskalkulie, einschließlich Definition, verschiedenen Ausprägungsformen, möglichen Ursachen und Anzeichen. Es werden verschiedene Aspekte der Rechenschwäche differenziert dargestellt, um ein ganzheitliches Bild der Problematik zu liefern. Die Erläuterung der möglichen Ursachen ist essenziell, um die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen im Unterricht besser zu verstehen und zu berücksichtigen.
Diagnostik: Der Abschnitt beschreibt die allgemeine Vorgehensweise bei der Diagnostik von Dyskalkulie und hebt Besonderheiten im Jugend- und Erwachsenenalter hervor. Es werden Schwierigkeiten bei der Diagnose angesprochen und mögliche Lösungsansätze skizziert. Der Fokus liegt auf der Differenzierung zwischen Schwierigkeiten im Rechnen und der tatsächlichen Diagnose von Dyskalkulie. Die Kapitel beschreibt die Notwendigkeit einer differenzierten und umfassenden Diagnostik.
Förderung von Menschen mit Rechenschwäche: Dieses Kapitel präsentiert erste grundlegende Aspekte der Förderung im Unterricht, rechtliche Grundlagen und den Umgang mit Rechenschwäche innerhalb und außerhalb der Schule. Es wird ein Überblick über verschiedene Förderansätze gegeben und deren Wirksamkeit diskutiert. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie die Fördermaßnahmen im Schulkontext effektiv implementiert werden können.
Ein didaktisches Konzept für den Umgang mit Rechenschwäche: Dieser Teil beschreibt das Forschungsdesign der empirischen Studie, inklusive der Datenerhebung und -analyse. Die Auswertung der Daten, die Beschreibung der Stichprobe und die Interpretation der Ergebnisse werden detailliert dargestellt. Der Abschnitt beleuchtet das entwickelte didaktische Konzept für den Umgang mit Rechenschwäche an Berufsschulen.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Berufsschule, Erwachsenenbildung, Diagnostik, Förderung, Kompensationsstrategien, inklusive Bildung, empirische Forschung, Handlungsempfehlungen, Berufsschulunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Umgang mit Dyskalkulie bei erwachsenen Berufsschülern
Was ist der Inhalt dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit befasst sich mit den Herausforderungen im Umgang mit Dyskalkulie bei erwachsenen Schülern an Berufsschulen. Sie untersucht die Identifizierung und Förderung dieser Schüler und gibt Lehrkräften Handlungsempfehlungen. Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche und Interviews mit Therapeuten. Sie umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Phänomenen des Rechnens, dem Begriff „Dyskalkulie“, Diagnostik, Förderung und ein didaktisches Konzept für den Umgang mit Rechenschwäche, inklusive einer empirischen Studie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Erkennen von Dyskalkulie bei erwachsenen Berufsschülern, die Herausforderungen der Diagnostik im Erwachsenenalter, geeignete Fördermaßnahmen im Berufsschulunterricht, Kompensationsstrategien der Betroffenen und die Langzeitfolgen unerkannter und unbehandelter Dyskalkulie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Problematik der unerkannten Dyskalkulie im Erwachsenenalter beleuchtet. Es folgen Kapitel zu den kognitiven Prozessen des Rechnens, einer umfassenden Betrachtung des Begriffs „Dyskalkulie“ (Definition, Formen, Ursachen, Anzeichen), Diagnostik (allgemeine Vorgehensweise und Besonderheiten im Erwachsenenalter), Fördermöglichkeiten im Unterricht und rechtlichen Grundlagen. Ein zentrales Kapitel beschreibt ein didaktisches Konzept mit Forschungsdesign, Datenerhebung, -analyse und -auswertung einer empirischen Studie. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und Interviews mit Therapeuten. Ein wichtiger Bestandteil ist eine empirische Studie mit eigenem Forschungsdesign, Datenerhebung und -analyse, um ein didaktisches Konzept für den Umgang mit Rechenschwäche zu entwickeln und zu evaluieren.
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Die primäre Zielgruppe sind Lehrkräfte an Berufsschulen. Die Arbeit soll sie für das Problem der Dyskalkulie bei erwachsenen Schülern sensibilisieren und ihnen geeignete pädagogische Strategien aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Berufsschule, Erwachsenenbildung, Diagnostik, Förderung, Kompensationsstrategien, inklusive Bildung, empirische Forschung, Handlungsempfehlungen, Berufsschulunterricht.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Studie?
Die detaillierten Ergebnisse der empirischen Studie, inklusive Stichprobenbeschreibung, Ergebnisse im Kontext der Hypothesen, weitere Befunde und Grenzen der Studie, sind im Kapitel "Ein didaktisches Konzept für den Umgang mit Rechenschwäche" detailliert dargestellt. Der Abschnitt beschreibt das Forschungsdesign, die Datenerhebung und -analyse.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit gibt konkrete Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte an Berufsschulen zur Identifizierung und Förderung von erwachsenen Schülern mit Dyskalkulie. Diese Empfehlungen basieren auf der Literaturrecherche, den Interviews und den Ergebnissen der empirischen Studie.
Welche Aspekte der Dyskalkulie werden besonders betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Dyskalkulie, inklusive Definition, verschiedenen Ausprägungsformen, möglichen Ursachen und Anzeichen, sowie Besonderheiten der Diagnostik und Förderung im Jugend- und Erwachsenenalter, Kompensationsstrategien und Langzeitfolgen.
- Arbeit zitieren
- Steffen Kirchberg (Autor:in), 2014, Überlegungen zu einem didaktischen Konzept für den produktiven Umgang mit Dyskalkulie im Unterricht berufsbildender Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295025