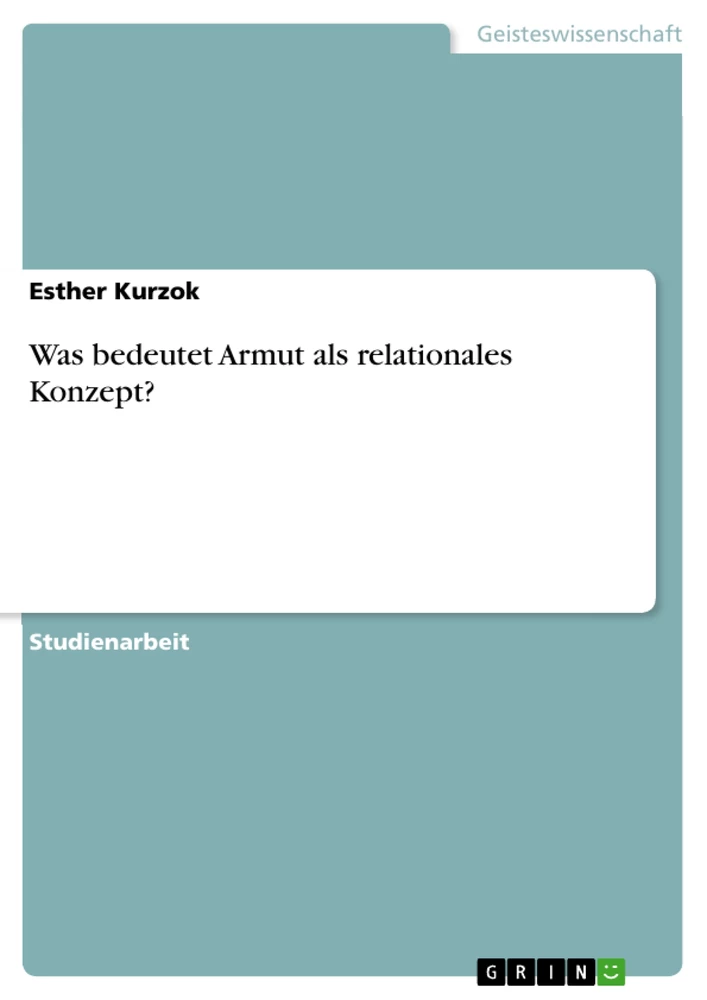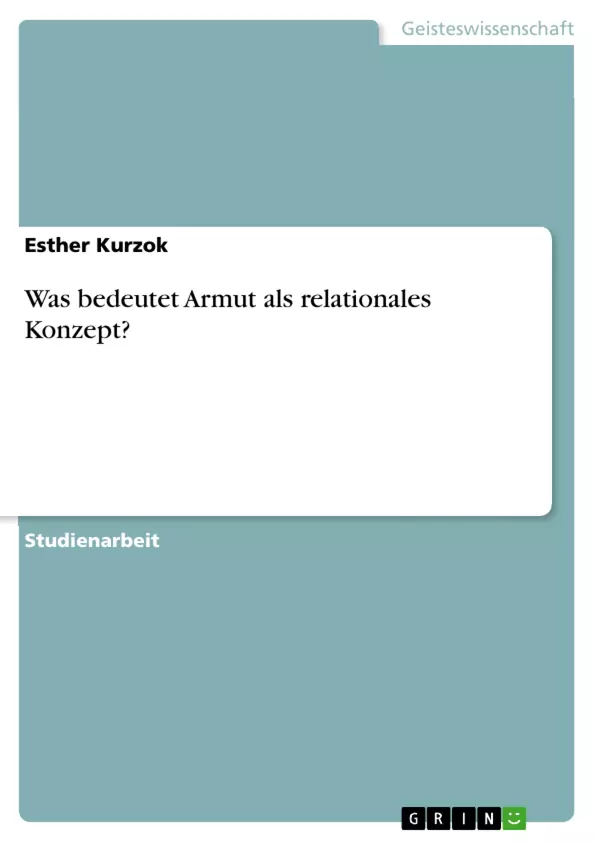Prof. Dr. Barlösius legte in dem 2001 erschienen Buch „Die Armut der Gesellschaft“ einen Text vor, der zu einer neuen „theoretischen Konzeption einer Soziologie der Armut“ anregt.
Die vorliegende Hausarbeit wird dieses Konzept vorstellen. Zunächst wird die Frage aufgeworfen, wozu und für wen Konzepte von Armut entwickelt werden und welches Konzept sich gesellschaftlich und sozialpolitisch in Wohlfahrtsstaaten durchgesetzt hat. Andere Konzepte der Armut werden nicht
erwähnt, da die Beschreibung des offiziellen Konzepts lediglich begründen soll, warum Barlösius es für nötig hält, zu einem neuen Verständnis von Armut zu gelangen. Der Fokus bleibt somit beim Konzept relationaler Armut.
Zur Bearbeitung des Themas stützt sich die Hausarbeit im wesentlichen auf die Auslegung dreier Texte: „Das gesellschaftliche Verhältnis der Armen - Überlegungen zu einer theoretischen Konzeption einer Soziologie der Armut“ von Barlösius und Vesters Texte „Soziale Milieus zwischen Individualisierung und Deklassierung“ und „Soziale Milieus in gesellschaftlichem Strukturwandel“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Armut als Konzept
- Wozu ein Konzept von Armut?
- Das offizielle Konzept: zu viel verdeckte Armut
- „arm sein“ ist etwas anderes als Armut
- „arm sein“ in der eigenen Schicht
- Ursachen
- Die Feinen Unterschiede: Abgrenzung o. Ausgrenzung?
- Der gesellschaftlich überholte Habitus
- Widersprüche in der Sozialstruktur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Armut als relationales Konzept, basierend auf Barlösius' theoretischer Konzeption einer Soziologie der Armut. Sie hinterfragt die bestehenden Armutsdefinitionen und beleuchtet die Grenzen des offiziellen Armutsverständnisses.
- Kritik am offiziellen Armutsbegriff und seinen methodischen Grenzen
- Die Bedeutung relationaler Armut und die Berücksichtigung sozialer Einbettung
- Der Einfluss gesellschaftlicher Strukturen und Habitus auf Armut
- Die Rolle von Statistiken und deren politische Instrumentalisierung
- Alternative Perspektiven auf Armutserfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Barlösius' Ansatz einer relationalen Armutstheorie vor. Sie skizziert den Fokus der Arbeit und die verwendeten Quellen. Die Arbeit argumentiert, dass das offizielle Armutsverständnis unzureichend ist und ein relationaler Ansatz notwendig ist, um die Komplexität von Armut zu erfassen. Die Einleitung betont die Bedeutung verschiedener Perspektiven auf Armut, insbesondere die der Betroffenen selbst.
Armut als Konzept: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Konzepte von Armut. Es beginnt mit der Frage nach dem Zweck von Armutsdefinitionen und untersucht, wer diese Konzepte entwickelt und welche Interessen dahinterstehen. Im Fokus steht eine Kritik des offiziellen, an statistischen Daten orientierten Armutsbegriffs. Es wird argumentiert, dass dieser viele Formen von Armut übersieht, die nicht in den offiziellen Statistiken erfasst werden, und dass die Definition selbst zu Ausgrenzung beiträgt. Das Kapitel legt den Grundstein für die Betrachtung der relationalen Armut als Alternative.
Schlüsselwörter
Relationale Armut, Armutsbegriff, Soziologie der Armut, offizielles Armutsverständnis, gesellschaftliche Strukturen, Habitus, soziale Ausgrenzung, Statistiken, politische Instrumentalisierung, Wohlfahrtsstaat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Armut als relationales Konzept
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Armut als relationales Konzept, basierend auf Barlösius' theoretischer Konzeption einer Soziologie der Armut. Sie hinterfragt bestehende Armutsdefinitionen und beleuchtet die Grenzen des offiziellen Armutsverständnisses. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kritik des offiziellen Armutsbegriffs und der Bedeutung relationaler Armut unter Berücksichtigung sozialer Einbettung, gesellschaftlicher Strukturen und Habitus.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Kritik am offiziellen Armutsbegriff und seinen methodischen Grenzen; die Bedeutung relationaler Armut und die Berücksichtigung sozialer Einbettung; den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen und Habitus auf Armut; die Rolle von Statistiken und deren politische Instrumentalisierung; und alternative Perspektiven auf Armutserfahrungen. Sie analysiert verschiedene Konzepte von Armut, untersucht den Zweck von Armutsdefinitionen und beleuchtet die Interessen dahinter.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu Armut als Konzept (inkl. Unterkapiteln zu verschiedenen Aspekten von Armut und deren Definition), einem Kapitel zu den Ursachen von Armut (inkl. Aspekten wie Abgrenzung/Ausgrenzung, Habitus und Widersprüche in der Sozialstruktur) und einem Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Argumente der Hausarbeit?
Die Hausarbeit argumentiert, dass das offizielle Armutsverständnis unzureichend ist und ein relationaler Ansatz notwendig ist, um die Komplexität von Armut zu erfassen. Sie kritisiert den an statistischen Daten orientierten Armutsbegriff, da dieser viele Formen von Armut übersieht und selbst zu Ausgrenzung beiträgt. Die Arbeit betont die Bedeutung verschiedener Perspektiven auf Armut, insbesondere die der Betroffenen selbst, und untersucht den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen und Habitus auf Armutserfahrungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Relationale Armut, Armutsbegriff, Soziologie der Armut, offizielles Armutsverständnis, gesellschaftliche Strukturen, Habitus, soziale Ausgrenzung, Statistiken, politische Instrumentalisierung, Wohlfahrtsstaat.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Hausarbeit basiert auf Barlösius' theoretischer Konzeption einer Soziologie der Armut. Die genaue Quellenangabe ist im Text der Hausarbeit enthalten.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist für alle relevant, die sich akademisch mit dem Thema Armut auseinandersetzen, insbesondere für Studierende der Soziologie und verwandter Disziplinen. Sie bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dem offiziellen Armutsverständnis und liefert alternative Perspektiven.
- Quote paper
- Esther Kurzok (Author), 2011, Was bedeutet Armut als relationales Konzept?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295032