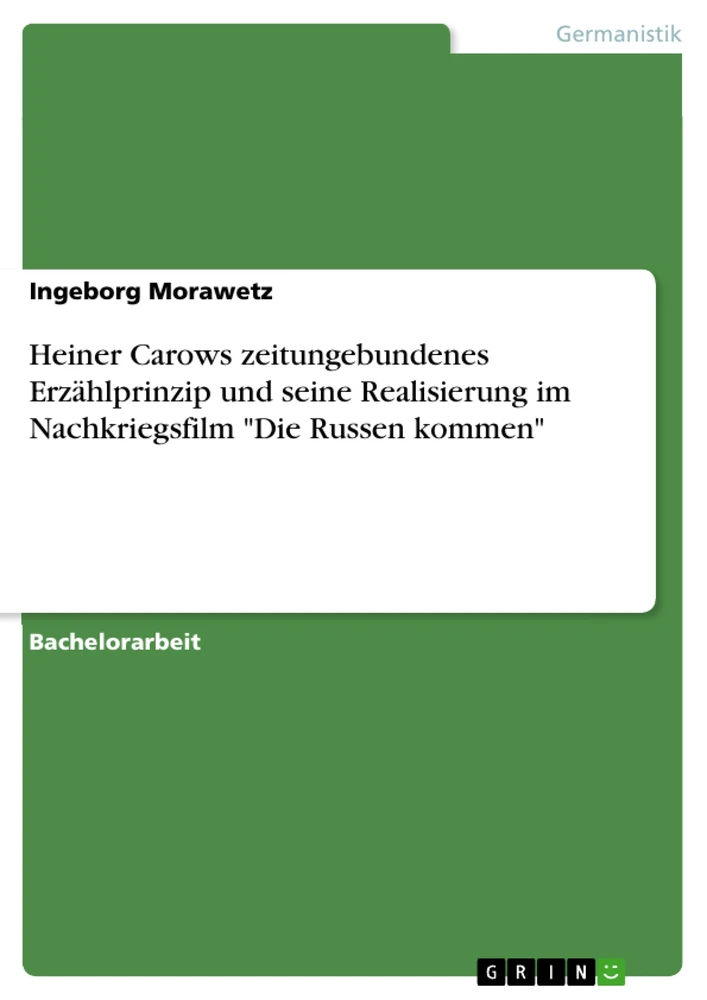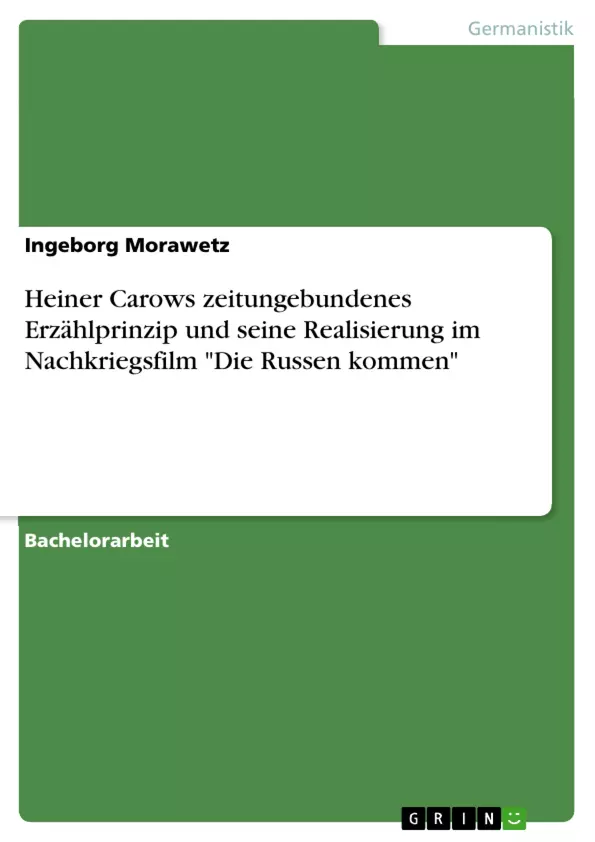Heiner Carows Schwarz-Weiß-Film „Die Russen kommen“ lässt sich beinahe nur noch thematisch als ein Film der Nachkriegszeit betrachten. In seinem Entstehungsjahr 1968 war die Welle der Filme mit explizit antifaschistischer Thematik bereits abgeebbt.
Die DDR, die sich in ihren Gründungsjahren als Gegenmodell zu einem faschistischen Staat gesehen hatte, setzte nun auch durch politische Weisung auf Filme, die einen sozialistischen Helden gegenüber einem einsichtigen Übeltäter oder einem engagierten Regimegegner favorisierten. Filme, die den nationalsozialistischen Faschismus durch die Darstellung von Einzelschicksalen - auch in Übertragung auf andere Epochen - verurteilten, waren für Meinungsbildung und Propaganda in der DDR nur noch wenig relevant. Wenn sie gezeigt wurden, sollten sie jedoch immer in Ausrichtung auf die Gegenwart der DDR verstanden werden können.
Als Carow durch eine Kurzgeschichte von Egon Richter zu „Die Russen kommen“ inspiriert wurde, waren seit dem Kriegsende bereits 23 Jahre vergangen. Im Gegensatz zu dem zur gleichen Zeit gedrehten Werk „Ich war neunzehn“ von Konrad Wolf wurde die Aufführung von Carows Film verboten. Die dafür genannten Gründe waren pragmatischer Natur, wirken aber heute beinahe zu einfach, um plausibel zu sein. Die Geschichte, die Carow erzählt, und die Art und Weise, auf die er sie erzählt, irritierten und irritieren. Die schließlich genehmigte Schnittfassung „Karriere“ von 1971 hat nur noch wenig mit dem Ausgangsthema gemein. Erstmals gezeigt wurde „Die Russen kommen“ schließlich 1987 nach einer Arbeitskopie aus dem Fundus von Evelyn Carow.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Russen kommen
- Analyse der filmischen Gestaltung: Stilistik, Ästhetik und Intertextualität
- Der Film und seine literarische Grundlage „Die Anzeige“
- „Die Russen kommen“ als die „zweite Seite der Medaille“ zu „Ich war neunzehn\" von Konrad Wolf
- Das Verbot von „Die Russen kommen“ und die Aufführung als „Karriere
- Heiner Carows zeitungebundenes Erzählprinzip der Ideale in Kollision mit dem antifaschistischen Film -,,Die Russen kommen“ im schematischen Vergleich mit anderen Filmen Carows
- Fazit
- Endnoten
- Bibliographie
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Film „Die Russen kommen“ von Heiner Carow und untersucht dessen filmische Mittel, die literarische Grundlage, den Vergleich zu anderen Filmen Carows, sowie die Gründe für das Verbot und die spätere Aufführung des Films.
- Filmische Gestaltung und ihre Wirkung
- Verhältnis zur literarischen Vorlage „Die Anzeige“
- Vergleich zu „Ich war neunzehn“ von Konrad Wolf
- Gründe für das Verbot von „Die Russen kommen“ und die Zulassung von „Karriere“
- „Die Russen kommen“ als Spiegelung von Carows filmischer Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Film „Die Russen kommen“ als ein Werk der Nachkriegszeit vor, das sich mit der Thematik des antifaschistischen Films auseinandersetzt. Sie beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen der DDR und die Entstehung des Films im Kontext der Zeit.
- Die Russen kommen: Dieser Abschnitt widmet sich der Analyse der filmischen Gestaltung und der Wirkung der verwendeten Mittel. Zudem wird das Verhältnis zur literarischen Vorlage „Die Anzeige“ beleuchtet. Der Vergleich mit dem Film „Ich war neunzehn“ von Konrad Wolf sowie die Gründe für das Verbot und die spätere Aufführung von „Die Russen kommen“ stehen ebenfalls im Fokus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen filmische Gestaltung, Intertextualität, antifaschistischer Film, Nachkriegszeit, DDR, Heiner Carow, „Die Anzeige“, „Ich war neunzehn“, Verbot, „Karriere“ sowie der Thematik von Idealen in Kollision mit der Realität.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Heiner Carows Film „Die Russen kommen“?
Der Film thematisiert die Endphase des Zweiten Weltkriegs und setzt sich mit antifaschistischen Themen durch die Darstellung von Einzelschicksalen auseinander.
Warum wurde der Film in der DDR verboten?
Die filmische Gestaltung und die Art der Erzählung irritierten die politische Führung; der Film entsprach nicht dem gewünschten Schema des sozialistischen Helden.
Auf welcher literarischen Vorlage basiert der Film?
Der Film basiert auf der Kurzgeschichte „Die Anzeige“ von Egon Richter.
Wann wurde „Die Russen kommen“ erstmals gezeigt?
Obwohl er 1968 gedreht wurde, fand die Uraufführung erst 1987 statt, basierend auf einer Arbeitskopie aus dem Fundus von Evelyn Carow.
Was war die Fassung „Karriere“ von 1971?
„Karriere“ war eine genehmigte Schnittfassung, die jedoch nur noch wenig mit dem ursprünglichen Thema von „Die Russen kommen“ gemein hatte.
- Arbeit zitieren
- Ingeborg Morawetz (Autor:in), 2014, Heiner Carows zeitungebundenes Erzählprinzip und seine Realisierung im Nachkriegsfilm "Die Russen kommen", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295127