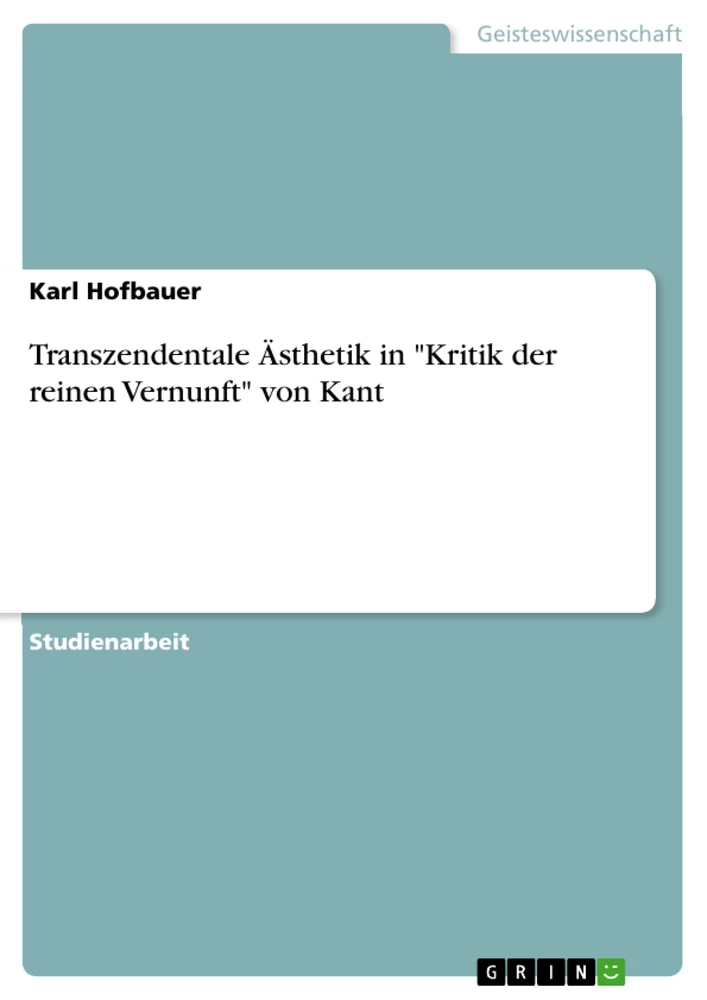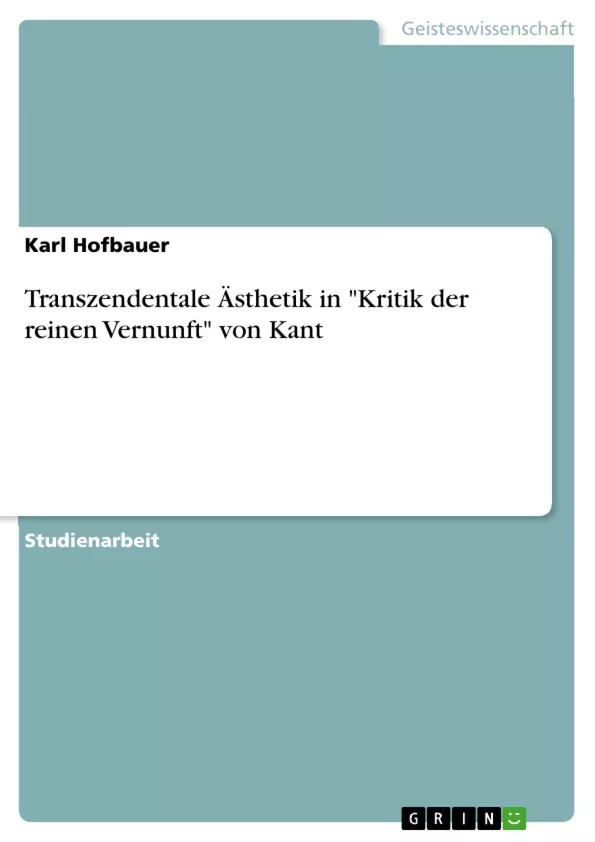Philosophen haben es wesentlich leichter als Historiker - sie brauchen sich, wie schon Kurt Walter Zeidler ausführte, strenggenommen nur zwei Daten zu merken: den Tod Sokratens 399 vor Christus und 1781 nach Christus - in diesem Jahr erschien die erste Ausgabe (A) von Kantens „Kritik der reinen Vernunft“ - durch die das Denken der Neuzeit so stark verändert wurde wie durch kein anderes Werk - bezeichnete sie doch von Schopenhauer als „das wichtigste Buch, das jemals in Europa geschrieben worden ist“.
Sowohl der Deutsche Idealismus als auch später der Neukantianismus orientierten sich an diesem Werk, für Adorno spielt es eine kaum geringere Rolle als Hegels Dialektik.
Charles Sanders Peirce bezeichnet die Kritik als „meine Muttermilch in der Philosophie“ und nach Jean Paul ist Kant "kein Licht der Welt, sondern ein ganzes strahlendes Sonnensystem auf einmal". Und auch Karl Jaspers schreibt enthusiastisch: „Sein Ethos ist der Ethos des Alltags und jeden Augenblicks. Ihn brauchen wir nicht als ein Fremdes zu bewundern. Mit ihm können wir leben. Ihm möchten wir folgen.“
Man könnte auch den berühmten Ausspruch von Alfred North Whitehead, demzufolge alle Philosophie aus „Fußnoten zu Platon“ besteht, dahingehend erweitern, daß alle Philosophie seit 1781 - dem Erscheinungsjahr der „Kritik der reinen Vernunft“ - in gleicher Weise „Fußnoten zu Kant “ darstellt.
So paßt auch das Gedicht Friedrich Schillers: „Kant und seine Ausleger“ wunderbar hierher: „Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung setzt! Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu tun.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen
- Kurzer Streifzug durch das wissenschaftliche Leben von Immanuel Kant und einige,,schlaglichtartige\" Vorwegnahmen zu Kantens „Kritik der reinen Vernunft“.
- Auszugsweiser Einblick in den Aufbau der „Kritik der reinen Vernunft“.
- Versuch eines Kommentares zu den Begriffen von „Raum“ und „Zeit“ in Kantens „Transzendentaler Ästhetik“
- Einige Worte zum Raumbegriff Kantens in der „Transzendentalen Ästhetik“.
- Erörterungen zum Begriffe der Zeit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der „Transzendentalen Ästhetik“ in Immanuel Kantens „Kritik der reinen Vernunft“. Sie analysiert zentrale Konzepte wie Raum und Zeit im Kontext von Kantens Philosophie und untersucht deren Bedeutung für die Erkenntnistheorie.
- Der Raumbegriff in Kantens „Transzendentaler Ästhetik“
- Die Zeit als apriorische Form der Anschauung
- Die Bedeutung von Raum und Zeit für die menschliche Erkenntnis
- Die Beziehung zwischen Raum, Zeit und der „Kritik der reinen Vernunft“
- Die Rolle der Transzendentalen Ästhetik in Kantens Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Bemerkungen
Die Einleitung stellt Immanuel Kant als einen der bedeutendsten Denker der Neuzeit vor und beleuchtet die Relevanz seiner „Kritik der reinen Vernunft“ für die Philosophiegeschichte. Sie betont die revolutionäre Bedeutung des Werkes und skizziert kurz die wichtigsten Themenfelder der Arbeit.
Kurzer Streifzug durch das wissenschaftliche Leben von Immanuel Kant und einige,,schlaglichtartige\" Vorwegnahmen zu Kantens „Kritik der reinen Vernunft“
Dieses Kapitel bietet einen kurzen Einblick in das Leben und Werk Immanuel Kant. Es beleuchtet wichtige Stationen seiner wissenschaftlichen Laufbahn und skizziert die konzeptionellen Grundzüge seiner „Kritik der reinen Vernunft“.
Auszugsweiser Einblick in den Aufbau der „Kritik der reinen Vernunft“
Das Kapitel gibt einen Überblick über den Aufbau der „Kritik der reinen Vernunft“ und stellt die wichtigsten Abschnitte und Themenbereiche des Werkes vor. Es erläutert die methodische Vorgehensweise und die zentralen Argumentationslinien Kantens.
Versuch eines Kommentares zu den Begriffen von „Raum“ und „Zeit“ in Kantens „Transzendentaler Ästhetik“
Dieses Kapitel stellt die „Transzendentale Ästhetik“ als einen zentralen Abschnitt der „Kritik der reinen Vernunft“ vor und erörtert die Bedeutung von Raum und Zeit als apriorischen Formen der Anschauung für die menschliche Erkenntnis.
Einige Worte zum Raumbegriff Kantens in der „Transzendentalen Ästhetik“
Das Kapitel befasst sich mit Kantens Raumbegriff und untersucht dessen Bedeutung für die Erkenntnistheorie. Es analysiert die Argumentation Kantens und diskutiert die Konsequenzen seines Raumverständnisses für die Frage nach der Möglichkeit von Erkenntnis.
Erörterungen zum Begriffe der Zeit
Dieses Kapitel widmet sich Kantens Zeitbegriff und erörtert seine Bedeutung für die menschliche Wahrnehmung und Erkenntnis. Es untersucht die Argumentation Kantens und diskutiert die philosophischen Implikationen seines Zeitverständnisses.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der „Transzendentalen Ästhetik“ in Immanuel Kantens „Kritik der reinen Vernunft“. Zu den Schlüsselbegriffen gehören: Raum, Zeit, apriorische Formen der Anschauung, transzendentale Deduktion, menschliche Erkenntnis, Erfahrung, Phänomen und Ding an sich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der „Transzendentalen Ästhetik“ bei Kant?
Sie untersucht die apriorischen (erfahrungsunabhängigen) Formen der sinnlichen Anschauung, nämlich Raum und Zeit, die als notwendige Bedingungen für jede Erfahrung gelten.
Warum bezeichnet Kant Raum und Zeit als „Formen der Anschauung“?
Für Kant sind Raum und Zeit keine Eigenschaften der Dinge an sich, sondern Strukturen unseres Erkenntnisapparates, durch die wir Sinnesdaten ordnen.
Wann erschien die „Kritik der reinen Vernunft“?
Die erste Auflage (A) des Werkes erschien im Jahr 1781.
Welche Bedeutung hat das Werk für die moderne Philosophie?
Es gilt als eines der wichtigsten Bücher der europäischen Geistesgeschichte und markiert die „kopernikanische Wende“ in der Erkenntnistheorie.
Was unterscheidet Phänomene von Dingen an sich?
Phänomene sind die Dinge, wie sie uns erscheinen (geprägt durch Raum und Zeit), während wir über die „Dinge an sich“ (wie sie unabhängig von unserer Wahrnehmung sind) keine Erkenntnis haben können.
- Citar trabajo
- Karl Hofbauer (Autor), 2009, Transzendentale Ästhetik in "Kritik der reinen Vernunft" von Kant, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295142