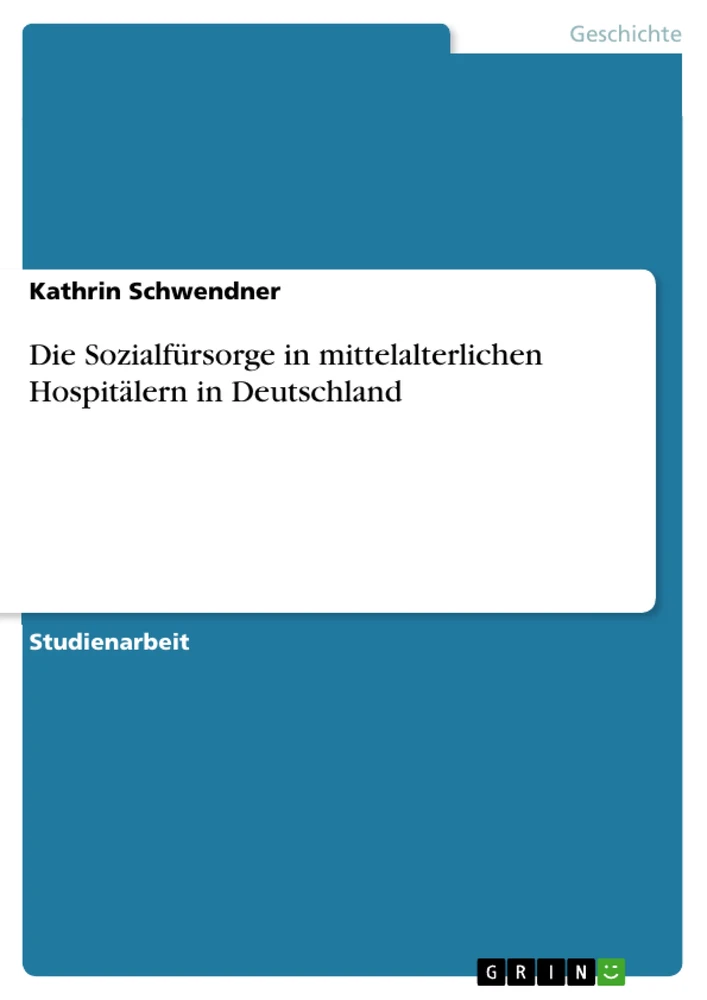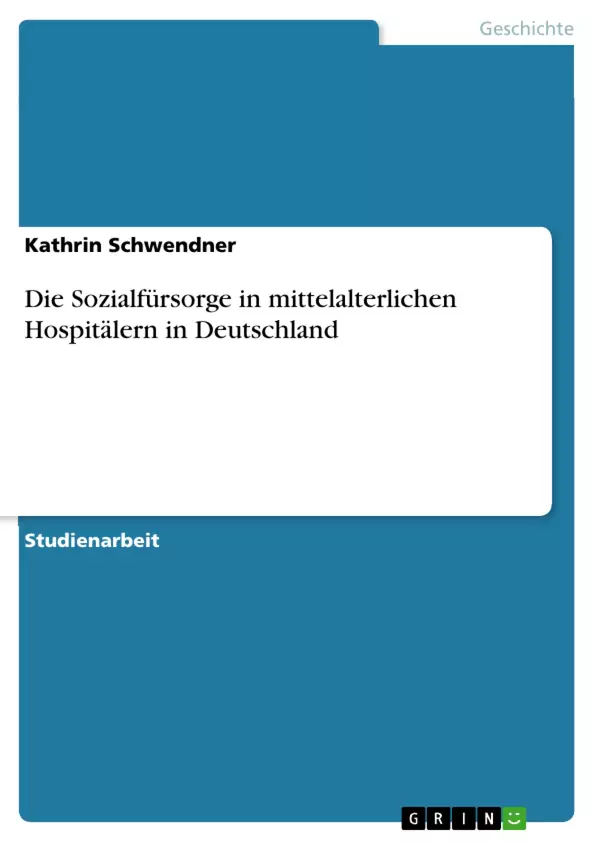Um sich genauer mit der Geschichte des Hospitals zu befassen, sollte man zuerst den Begriff Hospital erläutern und auf die Herkunft dieses Namens eingehen. Der Ursprung des Wortes Hospital liegt in dem lateinischen Wort hospes, welches Gast bedeutet. Das mittellateinische Wort hospitale beschreibt “ein öffentliches Gasthaus”. Daraus geht hervor, dass das Hospital generell eine Unterkunft für jedweden Gast ist. Die Begriffe Spital und Hospital unterscheiden sich nicht in ihrer Bedeutung. Spital ist lediglich die kürzere Variante.
Bereits im Mittelalter wurde der Begriff Hospital spezifiziert, indem man die Funktion dieses Ortes als eine der Allgemeinheit zugängliche und guttätige Anstalt, in welcher arme, kranke und alte Personen, sowie Waisenkinder oder Reisende aufgenommen werden, verstand.1 Aufgrund der verschiedenen Aufgaben des Spitals gibt es diverse Spitaltypen, welche sich jeweils spezialisiert haben. Zu diesen gehören unter anderem das Armenhaus, das Krankenhaus, das Waisenhaus, das Leprosenspital, das Siechhaus oder das Pilgerspital.In der Neuzeit wurde der Fokus dieser Anstalt auf die Pflege der Insassen gelegt und die Aufenthaltsdauer im Spital verkürzte sich. Reisende und Pilger wurden nun in Gast- und Wirtshäusern aufgenommen, welche weniger einem Spital als einem Hotel glichen. Doch trotz der Verlagerung des Schwerpunktes dieser Anstalten behielten alle ein gemeinsames Anliegen: Die Erholung und die Wiedererlangung der Gesundheit. Dieses Ziel wurde sowohl durch pädagogisches, als auch medizinisches Eingreifen erreicht.
Das Spital verlor somit im Laufe der Jahrhunderte seinen allgemeinen und multifunktionalen Charakter und spezialisierte sich auf bestimmte Personengruppen.
Daher kann die Spitalgeschichte heutzutage von vielerlei Sichtweisen analysiert werden. Man kann das Spital unter anderem kirchengeschichtlich, erziehungsgeschichtlich, sozialgeschichtlich oder medizingeschichtlich betrachten und analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist ein Hospital?
- Entstehung des Spitals
- Baugeschichtliche Entwicklung des Hospitals
- Auswahlkriterien zur Aufnahme in ein Hospital
- Die Spitaltypen
- Bürgerspitäler
- Das städtische Pfründhaus
- Fremden- und Pilgerspitäler
- Armen- und Seelenhäuser
- Blatter- oder Franzosenhäuser
- Leprosenspitäler
- Bürgerspitäler
- Die Insassen des Hospitals
- Pflege und medizinische Versorgung
- Heilberufe
- Alltagsleben im Hospital
- Pflege und medizinische Versorgung
- Die Rolle der Kirche in den Hospitälern
- Das Seelenheil in Hospitälern
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sozialfürsorge in mittelalterlichen Hospitälern in Deutschland. Sie erläutert die Entstehung und Entwicklung der Hospitäler, ihre verschiedenen Typen und die Aufgaben, die sie erfüllten. Darüber hinaus beleuchtet sie die Rolle der Kirche in den Hospitälern und die Bedeutung des Seelenheils in diesem Kontext.
- Die Entstehung und Entwicklung des Hospitals in Deutschland
- Die verschiedenen Spitaltypen und ihre Aufgaben
- Die Rolle der Kirche in den Hospitälern
- Die Bedeutung des Seelenheils in den Hospitälern
- Die Sozialfürsorge der Hospitäler für verschiedene Bevölkerungsgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff "Hospital" und zeigt seine Entwicklung vom öffentlichen Gasthaus zur spezialisierten Einrichtung für Bedürftige. Kapitel zwei untersucht die Entstehung des Hospitals, die durch die Kirchenreform des frühen Mittelalters angestoßen wurde und auf der Nächstenliebe des christlichen Glaubens basierte. Im dritten Kapitel wird die baugeschichtliche Entwicklung der Hospitäler beleuchtet, die von der Architektur der frühen mittelalterlichen Hospitäler, die oft an Kirchen erinnerten, bis hin zu den mehrgeschossigen Gebäuden mit Einzelzimmern des späten Mittelalters reicht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Hospital, mittelalterliche Sozialfürsorge, Kirche, Nächstenliebe, Spitaltypen, Baugeschichte, Krankenversorgung, Pflege, Seelenheil.
Häufig gestellte Fragen
Was war die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Hospital“?
Das Wort leitet sich vom lateinischen „hospes“ (Gast) ab und bezeichnete ursprünglich ein öffentliches Gasthaus oder eine Unterkunft für Reisende.
Welche Arten von mittelalterlichen Spitälern gab es?
Es gab spezialisierte Typen wie Bürgerspitäler, Leprosenhäuser, Pilgerspitäler, Armen- und Seelenhäuser sowie Waisenhäuser.
Welche Rolle spielte die Kirche in den Hospitälern?
Die Kirche war zentral für die Entstehung, da die Spitalstiftung auf dem christlichen Gebot der Nächstenliebe und der Sorge um das Seelenheil basierte.
Wie entwickelte sich die Architektur der Hospitäler?
Die Bauten entwickelten sich von kirchenähnlichen Sälen im frühen Mittelalter hin zu mehrgeschossigen Gebäuden mit Einzelzimmern im späten Mittelalter.
Was war das Hauptziel der Versorgung im Spital?
Das Ziel war die Erholung und Wiedererlangung der Gesundheit, wobei sowohl medizinische Pflege als auch die geistliche Begleitung (Seelenheil) wichtig waren.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Schwendner (Autor:in), 2011, Die Sozialfürsorge in mittelalterlichen Hospitälern in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295175