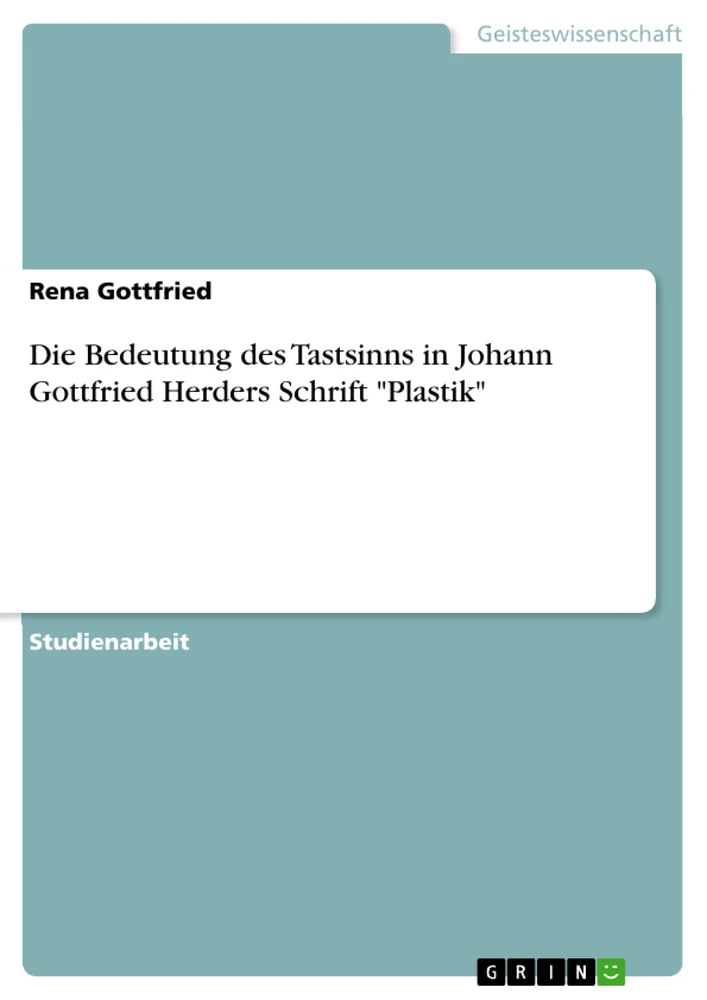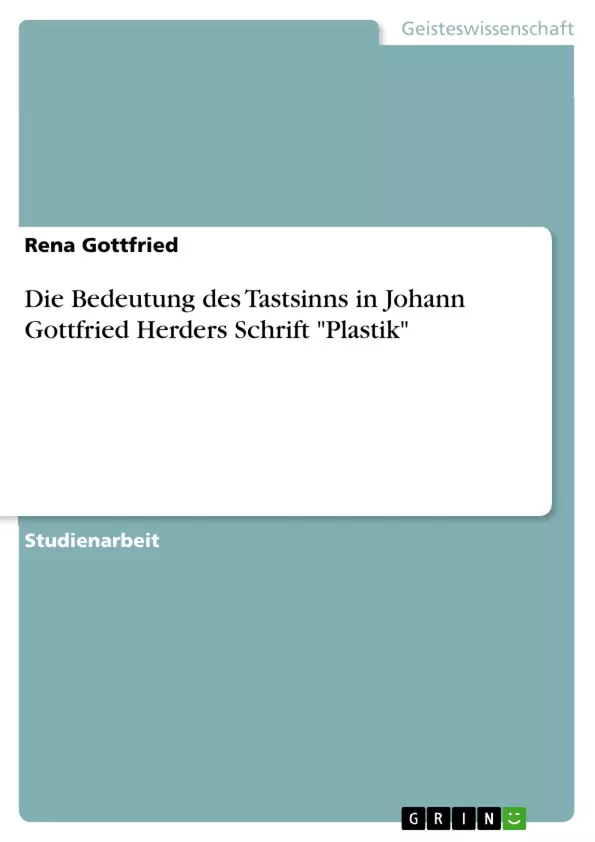„Seht jenen Liebhaber, der tiefgesenkt um die Bildsäule wanket. Was tut er nicht, um sein Gesicht zum Gefühl zu machen, zu schauen als ob er im Dunkeln taste?“
So heißt es in Johann Gottfried Herders Schrift „Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume“ aus dem Jahr 1778. Das Zitat verweist auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit: die sinnliche Erfahrung des Menschen insbesondere durch den Tastsinn, von Herder Gefühl genannt, und ihre Bedeutung in seinem anthropologischen und ästhetischen Programm.
Bereits seit der Antike lässt sich in der Philosophie eine Hierarchisierung der Sinne verfolgen. Die traditionell angenommenen fünf Sinne des Menschen lassen sich im Allgemeinen wie folgt ordnen: Gesichtssinn, Gehörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn und Tastsinn. Dabei wird zusätzlich zwischen den höheren Sinnen, dem Auge und dem Ohr, und den niederen Sinnen, dem Geruch, dem Geschmack und dem Tasten, unterschieden. Die Annahme, dass wir diese fünf Sinne haben und sie in dieser Rei-henfolge für den Menschen qualitativ bewerten, ist nie unumstritten gewesen, doch seit Aristoteles allgemeinen anerkannt. Insbesondere das Primat des Gesichtssinns zieht sich mit der Begründung des größten Erkenntnisgewinns durch die Jahrhunderte bis zur Aufklärung, der Epoche der Lichtmetaphorik.
Herder hat in seinen Schriften den Tastsinn als hervorragenden Sinn des Menschen herausgestellt, der dem optischen Sinn angeblich als „Organ authentischer körperlicher Erfahrung“ überlegen und von allen Sinnen „der Gewissheit des Seins“ am nächsten ist. Damit nimmt Herder eine historische Schlüsselrolle in der Aufwertung des Tast-sinns ein.
Die folgende Arbeit wird auf die Bedeutung des Tastsinns in Herders „Plastik“ genauer eingehen, besonders in Bezug auf ästhetische und anthropologische Aspekte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Überblick: Der Tastsinn in der Philosophie bis zur Aufklärung
- 2. Johann Gottfried Herder: „Plastik“
- 2.1 Abwertung der optischen Wahrnehmung …
- 2.2 Die Aufwertung des Tastsinns und die Erkenntnis des Schönen
- 2.3 Die Zusammenführung der Sinne im „sensorium commune“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Tastsinns in Johann Gottfried Herders Werk „Plastik“ im Hinblick auf seine anthropologischen und ästhetischen Aspekte. Sie betrachtet die historische Entwicklung der Sinnesphilosophie bis zur Aufklärung, analysiert Herders Kritik am optischen Sinn und seine Aufwertung des Tastsinns, und untersucht die Rolle des Tastsinns in Herders Theorie des Schönen.
- Die historische Entwicklung der Sinnesphilosophie und die hierarchische Ordnung der Sinne
- Herders Kritik am Primat des Gesichtssinns und die Aufwertung des Tastsinns als „Organ authentischer körperlicher Erfahrung“
- Die Bedeutung des Tastsinns für die Erkenntnis des Schönen
- Die Rolle des „sensorium commune“ in Herders Theorie der Sinneswahrnehmung
- Die anthropologische Bedeutung des Tastsinns für die Selbstwahrnehmung und die Beziehung zur Außenwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Sinnesphilosophie von der Antike bis zur Aufklärung, wobei der Fokus auf die hierarchische Ordnung der Sinne und die Bedeutung des Tastsinns für die Erkenntnis und die Lebenserhaltung liegt.
Das zweite Kapitel analysiert Herders Werk „Plastik“ im Hinblick auf seine Theorie der Empfindungen und die Rolle des Tastsinns. Es untersucht Herders Kritik am optischen Sinn, die Aufwertung des Tastsinns, seine Theorie des Schönen und die Zusammenführung aller Sinneswahrnehmungen im „sensorium commune“.
Schlüsselwörter
Tastsinn, Sinnesphilosophie, Johann Gottfried Herder, Plastik, Ästhetik, Anthropologie, optischer Sinn, sensorium commune, Erkenntnis, Schönheit, Selbstwahrnehmung, Körperlichkeit, Geschichte der Sinne, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung misst Herder dem Tastsinn bei?
Herder wertet den Tastsinn als „Organ authentischer körperlicher Erfahrung“ auf und sieht in ihm den Sinn, der der „Gewissheit des Seins“ am nächsten steht.
Warum kritisiert Herder den Gesichtssinn?
Er sieht im optischen Sinn eine Distanzierung von der Materie. Wahre Erkenntnis von Form und Gestalt (insbesondere in der Plastik) könne nur durch das „Gefühl“ (Tasten) erreicht werden.
Was ist das „sensorium commune“?
Das sensorium commune ist der Ort der Zusammenführung aller Sinneswahrnehmungen im menschlichen Bewusstsein, wobei der Tastsinn bei Herder die fundamentale Basis bildet.
Wie ordnete die Philosophie vor der Aufklärung die Sinne?
Traditionell herrschte eine Hierarchie, die das Auge und Ohr als „höhere“ Sinne über die „niederen“ Sinne wie Geruch, Geschmack und Tasten stellte.
Welche Rolle spielt der Tastsinn in Herders Ästhetik?
In seiner Schrift „Plastik“ argumentiert Herder, dass die wahre Schönheit einer Skulptur nicht allein durch das Sehen, sondern durch das (imaginierte) Ertasten ihrer Form erfahren wird.
- Quote paper
- Rena Gottfried (Author), 2014, Die Bedeutung des Tastsinns in Johann Gottfried Herders Schrift "Plastik", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295183